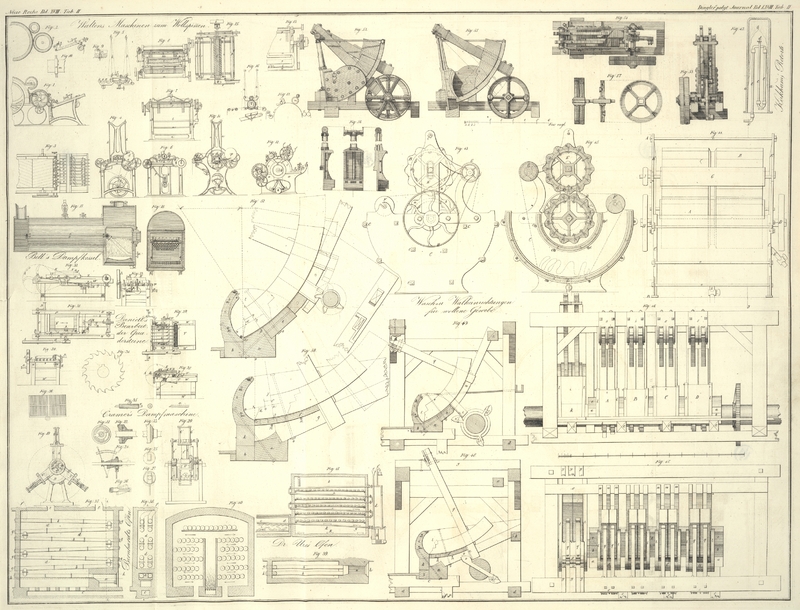| Titel: | Construction der Wasch- und Walkeinrichtungen für wollene Gewebe; von Hrn. Wedding. |
| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. XXIV., S. 99 |
| Download: | XML |
XXIV.
Construction der Wasch- und
Walkeinrichtungen fuͤr wollene Gewebe; von Hrn. Wedding.
(Aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des
Gewerbfleißes in Preußen, 1837, fuͤnfte
Lieferung.)
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Wedding, uͤber die Construction der Wasch- und
Walkeinrichtungen fuͤr wollene Gewebe.
Bei der Verarbeitung der Schafwolle zu Streichgarn wird der Wolle etwas Oehl
zugesezt, um ihre Fasern dadurch geschmeidiger und fuͤr die Maschinenarbeit
mehr geeignet zu machen; endlich aber werden insbesondere die Kettenfaden beim Weben
mit Leim, sogenannter Schlichte, gestaͤrkt, um sie waͤhrend des
Kreuzens und dann mit der Loke beim Festschlagen der eingeschossenen Einschlagfaden
weniger zu beschaͤdigen. Alle diese Zusaͤze, so wie auch Schmuz, der
in das Gewebe hineingekommen ist, muͤssen demnaͤchst aus demselben
entfernt und das Tuch zur Annahme der Farben gereinigt werden.
Die mechanischen Einrichtungen, deren man sich hiezu bedient, sind die
Waschmuͤhlen. Sie bestehen entweder aus einem Systeme von Walzen, die genarbt
und stark auf einander gepreßt sind, und zwischen denen hindurch das mit Wasser und
anderen Reinigungsmitteln, als Urin, Seife, Schweinekoth etc. getraͤnkte Tuch
ohne Ende und so lange geleitet und dabei gequetscht und geknetet wird, bis alle
Unreinigkeiten geloͤst und durch Nachfuͤllung von reinem Wasser
beseitigt sind. – Oder man bedient sich hiezu Haͤmmer, die in
Grubenloͤchern arbeiten und das in Falten eingelegte und mit jenen
Reinigungsmitteln genezte Tuch wieder so lange kneten, schieben und wenden, bis auch
hier wieder der vorerwaͤhnte Zwek, vollstaͤndige Reinigung, erreicht
wird. Um sich von derselben zu uͤberzeugen, muß bei fortwaͤhrendem
Zufluß von reinem Wasser lezteres endlich auch rein wieder ablaufen.
Die gereinigten Tuͤcher sind nach der Reinigung noch lokeres, offenes Gewebe,
welches aber bei der eigenthuͤmlichen Form der Wollfasern, und in Folge der
Verarbeitung derselben zu Garnen, und deren Verwendung beim Weben (beilaͤufig
naͤmlich wird der Kettenfaden gewoͤhnlich rechts und der
Einschlagfaden links gedreht, ersterer auch schaͤrfer, lezterer dagegen mehr
loker gesponnen) die Eigenschaft besizt, durch gelinde nasse Waͤrme zusammen
zu fahren, zu filzen (nach einem technischen Ausdruk), und dieß ganz besonders dann in der Richtung der
Breite und der Lange vollstaͤndig und egal zu thun, wenn diese Waͤrme
nicht durch aͤußere Mittel, sondern durch ein fortwaͤhrendes, schnell
auf einander folgendes Durcharbeiten, Kneten. Schieben und Reiben des Tuches selbst
in einem beengten Raume durch Hammerschlaͤge erzeugt wird. Da die Kettenfaden
scharfer als die Einschlagfaͤden gesponnen sind, so haben auch besonders
leztere mehr noch die Eigenschaft zusammenzuschrumpfen, und die ersteren weniger.
Ein Stuͤk durch die Arbeit des Knetens, Schiebens und Reibens von Tuch auf
Tuch in sich erwaͤrmtes, wollenes Gewebe und Streichgarn laͤuft oder
filzt daher auch mehr in der Breite als in der Laͤnge zusammen. Dieses Filzen
ist aber ferner abhaͤngig von der Zeit der Arbeit, so wie auch ganz besonders
von der Beschaffenheit des Gewebes und der zu demselben verwandten Wolle.
Die mechanischen Einrichtungen, welche die oben erwaͤhnte Arbeit verrichten
sollen, nennt man die Walken, oder Dik- oder Filzmuͤhlen. Sie sind den
Waschmuͤhlen mit Haͤmmern in so fern aͤhnlich, als auch hier
Haͤmmer in Anwendung kommen, die auf das in einem eigenthuͤmlich
geformten Loche zusammengelegte, gefaltete Tuch schlagen, weichen aber darin von
jenen ab, als das Tuch hier mehr geschlagen, geknetet und gewendet werden muß, um
die noͤthige Waͤrme zum Filzen selbst zu erreichen.
Eine aus Walzen bestehende Waschmuͤhle ist auf Tab. II in Fig. 43, 44 und 45 abgebildet. Sie wird
fuͤr zwekmaͤßig und gut gehalten. Ihre Hauptbestandtheile sind 2
Walzen A und B, welche aus
Holzstaͤben a auf gußeisernen Ringen b befestigt und kannelirt sind (die Theilung der schwach
abgerundeten und nicht tiefen Kannelirungen betraͤgt = 2 1/2 Zoll). Die
untere derselben liegt mit den Zapfenenden in Pfannen, welche in die aus Gußeisen
gefertigten Seitenwaͤnde C, C der Maschine
eingelegt sind. Sie empfangt die Bewegung durch einen Betriebsriemen, der auf die
Riemenscheibe D aufgebracht wird. Die obere Walze B dagegen laͤuft mit ihren Zapfenenden in
Schlizen des Obergestelles E; ihre Bewegung
empfaͤngt sie von der unteren Walze. Das Gewicht der Walzen ist bedeutend,
indem der aus Holzstaͤben bestehende und wie der Durch, schnitt, Fig. 45,
naͤher nachweist, mit versenkten Schrauben auf die gußeisernen Ringe
befestigte Mantel ziemlich dik ist, und eine Laͤnge hat, die gleichzeitig das
Waschen von 2 Stuͤk Tuͤchern neben einander gestattet. Dieses Gewicht
preßt das zwischen den beiden Walzen hindurchgefuͤhrte Tuch zusammen,
waͤhrend die Kanneluren ein Quetschen und geringes Reiben verursachen. Die
Zufuͤhrung des Tuches erfolgt zuvoͤrderst uͤber die Leitwalze
F, welche aus Holz gefertigt ist, und mit Zapfen in
Pfannen der Seitenwaͤnde C der Maschine sich bewegt. Nachdem
das Tuch die Walzen A und B
verlassen hat, wird es uͤber die Leit- und Zugwalze G gefuͤhrt, und nun beide Tuchenden verloren
aneinander geheftet. Die Walze G ist auch von Holz, ruht
aber in Pfannen des Obergestelles und wird durch einen Riemen von der Hauptwalze A aus bewegt. Es befindet sich hiezu auf dem anderen
Zapfenende der Walze A eine Riemenscheibe H, auf der Zugwalze G aber
eine kleinere Riemenscheibe F. Da beide Riemenscheiben
in der Groͤße von einander abweichen, und zwar leztere kleiner ist als jene,
so erfolgt ein Fort- und Straffziehen des Tuches, in so weit es die
Arbeitswalzen A und B
gestatten.
Unter der unteren Walze A sind zwei concentrisch mit
einander und aus Bohlen gefertigte Maͤntel angeordnet. Die Enden der
Bohlenstuͤke greifen in Ruthen ein, die, wie Fig. 45 deutlich zeigt,
an die Seitenwaͤnde angegossen sind, und bilden, indem sie durch Feder und
Nuthe mit einander verbunden sind, zwei wasserdichte Troͤge. Zum
Zusammenhalten der Seitenwaͤnde und dichten Verbindung mit den
Holzmaͤnteln dienen starke schmiedeiserne, und an den Enden mit Gewinde und
Muttern versehene Bolzen c, c.
In den unteren Trog wird nun die Fluͤssigkeit zum Auswaschen der
Tuͤcher, aus Urin, Seife, Walkererde, Schweinekoth und Wasser bestehend,
eingelassen, und die zu waschenden Tuͤcher hierin durchgefuͤhrt. Um
ein Stuͤk Tuch zur baldigen Aufnahme dieser Fluͤssigkeit mehr geeignet
zu machen, wirft man es gewoͤhnlich erst in ein Walkloch und laͤßt es
einige Mal mit Zufuͤhrung von Wasser rundlaufen und somit
durchnaͤssen. Die beiden Arbeitswalzen quetschen und reiben nun das in Falten
durchgeleitete Tuch zusammen, die Reinigungsmittel werden mehr mit demselben in
Beruͤhrung gebracht, laufen aber ausgepreßt in den oberen, und unmittelbar
unter der Walze A gelagerten Trog ab, um von hieraus
wieder zuruͤk in den unteren Trog gelassen oder durch ein Rohr K mit Hahn ganz abgelassen zu werden. Sind die dem Tuche
beigemischten und meist fetten Bestandtheile geloͤst, so wird mit dem
eigentlichen Reinwaschen begonnen. Dieses erfolgt nach Ablassen der
Loͤsungsmittel aus dem unteren Troge durch den Hahn L, durch fortwaͤhrendes Zulassen von reinem Wasser in den unteren
Trog und Abfuͤhren des ausgepreßten schmuzigen Wassers aus dem oberen
Troge.
Die Zeit, in welcher zwei nebeneinander und zwischen den Walzen bearbeitete
Tuͤcher rein gewaschen werden, haͤngt vorzugsweise von den
auszuwaschenden Beimischungen ab, und kann 2–4 und mehrere Stunden dauern. Es
wird jedenfalls so lange fortgefahren, bis das abgefuͤhrte Wasser aus dem
oberen Troge keine Beimischungen mehr zeigt, mithin so rein ablauft, als es vorher
zugeleitet worden ist.
Eine solche Waschmuͤhle, die in England fast allgemein, indeß auch in Berlin
gebraucht wird, erfordert eine Arbeitskraft von einem Pferde, wenn die Walzen in der
Minute 60 Umgaͤnge machen.Nach der vorliegenden Zeichnung hat der Mechanikus Hr. Hummel in Berlin dergleichen Maschinen gebaut, und berechnet den
Preis einer solchen zu 328 Thlr.
Die Waschmuͤhlen mit Haͤmmern sind meist mit den Walkwuͤhlen
zusammengebaut. Eine Abbildung der Verbindung beider ist in Fig. 46–51 in
Vorder-, Oberansicht und in mehreren Durchschnitten enthalten. Wie bereits
erwaͤhnt, besteht die Anordnung in Haͤmmern, welche, nachdem sie durch
Daumen an einer durch Maschinenkraft in Umlauf gesezten Welle zu einer bestimmten
Hoͤhe gehoben worden sind, frei herabfallend die in einem Loche darunter
befindlichen Tuͤcher treffen, und durch ihr Gewicht ein
Zusammendruͤken, durch ihre eigenthuͤmlich geformte Bahnflaͤche
ein Fortschieben derselben veranlassen, welches noch durch die Form des Loches
dergestalt befoͤrdert wird, daß es sich an der vorderen Wandung (Brustlehne)
erhebt, und wieder zuruͤkfallend einer neuen Einwirkung des Hammers ausgesezt
wird. Zur Raumgewinnung arbeiten immer zwei Haͤmmer in einem Loche auf zwei
neben einander mit Sorgfalt eingelegte Tuͤcher. Bei gleicher Laͤnge
eines Stuͤkes wollenen Tuches weicht auch die Breite so wie die Feinheit der
Faͤden des Gewebes von einander ab, wodurch das Stuͤk schwerer als ein
anderes wird, und daher auch einen anderen Rauminhalt verlangt. Die Loͤcher
(Walkloͤcher) sind daher der Groͤße nach fuͤr die im Gewichte
von einander abweichenden Tuͤcher auch verschieden. In Fig. 46 und 47 ist
Ruͤksicht darauf genommen; die mit A, B, C und
D bezeichneten, zum Wallen bestimmten Walkkasten
(sind die Walkloͤcher in einem starken Bauholz ausgearbeitet, so nennt man
dasselbe den Walkstok) nehmen an Groͤße zu, und zwar in der Breite, in der
Hoͤhe und Tiefe immer um 1 Zoll, so daß der erstere 9 Zoll breit, etwa 13
Zoll hoch und tief, der leztere aber bei 12 Zoll Breite schon 16, auch wohl 18 Zoll
hoch und tief gemacht werden muß; die Walkloͤcher wuͤrden bei dieser
Groͤße zum Walken von 26 bis 50pfuͤndigen Tuͤchern geeignet
seyn.
Beim Waschen brauchen die Tuͤcher nicht so gepreßt zu arbeiten, wie beim
Wallen, wo durch das gegenseitige Aneinanderreihen gerade das Warmwerden und sonach
das Filzen beabsichtigt wird; man macht daher ein Waschloch, welches fuͤr 4
Walkloͤcher zureicht, nicht kleiner als die Breite des groͤßten
Walkloches, zieht es oft sogar vor, dasselbe noch um 1 Zoll breiter zu halten. Auch hier
arbeiten zwei Haͤmmer auf zwei Stuͤk eingelegte Tuͤcher in
einem Loche (Waschloch).
Da durch das Waschen die den Haaren des Gewebes anhaͤngenden Unreinigkeiten
beseitigt, leztere aber erst durch die bereits bemerkten Loͤsungsmittel
loͤsbar gemacht werden sollen, so muͤssen diese in die Tuͤcher
eingearbeitet werden. Hiezu ist ein geringes Quetschen am geeignetsten, wie solches,
zwischen den Waschwalzen erreicht wurde; aber auch ein fortwaͤhrendes
Zufuͤhren der Tuͤcher unter die Bahnflaͤchen der
Haͤmmer. Die Woͤlbung (Brustlehne, Busen) des Waschloches,
demnaͤchst auch die Form der Bahnflaͤchen der Haͤmmer
befoͤrdern dieses Zufuͤhren und Wenden des Tuches, waͤhrend
leztere aber auch das noͤthige Quetschen veranlaͤßt. Die
Woͤlbung der Brustlehne des Waschloches so wie die Form der
Bahnflaͤche der Haͤmmer muͤssen daher die hiezu geeignete
Construction erhalten.
Bei dem mehr fuͤhlbaren Mangel an starken Bauhoͤlzern zu Walk-
und Waschstoͤken ist in der Zeichnung auf eine Zusammensezung aus mehreren
Hoͤlzern Ruͤksicht genommen. Die beiden Sohlhoͤlzer a und b gehen, mit einander
verbolzt, unter allen Loͤchern hindurch, und sind in die Querhoͤlzer
c eingeschnitten. Leztere muͤssen besonders
fest lagern, weßhalb sie auf eingerammte Pfahle aufgezapft und in die Schwelle d des Geruͤstes der Walke eingelegt werden. Vor
dem Walkgeruͤste dienen sie zugleich zum Aufbringen der Diehlung.
Die Ruͤklehne der Walkloͤcher besteht auch aus einem durchlaufenden und
mit dem Sohlholze a durch Schrauben verbundenen
Stuͤke Holz e. Fuͤr das Waschloch sind
dagegen zum Tragen der aus Bohlen verbundenen Ruͤklehne f drei Leitschienen g aus
Bohlen angeordnet, und verzahnt in das Sohlholz a und
den Riegel h des Geruͤstes befestigt. Die
Brustlehnen oder Busen i der Walkloͤcher so wie
auch der Waschloͤcher sind kurze, die Weite eines Loches messende, auf die
hohe Kante aufgestellte Hoͤlzer. Fuͤr die Walkloͤcher sind
diese Hoͤlzer unmittelbar mit den Sohlhoͤlzern b und a durch starke Schraubenbolzen
verbunden; fuͤr das Waschloch ist noch das Unterlagsholz k erforderlich. Die Befestigung mit diesem und dem
Sohlholze a geschieht ebenfalls durch Schraubenbolzen.
Die Seitenwandungen l, l der Loͤcher sind aus
Bohlen, und mit den Brustlehnen durch die Schraubenbolzen m,
m (diese sind nur kurz, und die zugehoͤrigen Muttern von Vorne in
die Brustlehnen eingelassen, so daß man sie herausschrauben und ein Walkloch
zerlegen kann, ohne das nebenliegende g auch beseitigen
zu muͤssen), mit den Ruͤklehnen aber durch eine halb
schwalbenschwanzfoͤrmige Feder und durch einen dahinter getriebenen Keil verbunden.
Diese leztere Verbindung findet jedoch nur fuͤr die Wandungen der
Walkloͤcher Statt, fuͤr diejenigen des Waschloches gehen die
Bohlenstuͤke bis zu den Stielen n des
Geruͤstes durch, und sind hieran und mit den Ruͤklehnen verbunden. Zum
besseren Zusammenhalten dienen auch noch die unter der Ruͤklehne f des Waschloches angeordneten Schraubenbolzen n, n, so wie uͤberhaupt die Schraubenbolzen o, o.
Zu den Brust- und Ruͤklehnen, so wie zu den Wandungen der
Loͤcher waͤhlt man am besten ausgelaugtes Eichenholz, zu den
Sohlhoͤlzern aber Kiehnenholz. Zu dem Haͤmmer wird auch ausgelaugtes
Eichenholz genommen, zu den Armen (Schwingen) entweder Eichenholz oder Kiehnenholz.
Das Gewicht eines Walkhammers muß 2 1/2–3 1/2 Cntr. betragen, dasjenige eines
Waschhammers nicht ganz so viel. Jeder Haͤmmer ist nach einem
Bogenstuͤk bearbeitet, wozu der Mittelpunkt im Zapfen-
(Spillen-) mittel des Armes sich befindet; die Dike des Holzes
betraͤgt genau so viel, daß die beiden in einem Loche arbeitenden
Haͤmmer die Breite des Loches fast ausfuͤllen; der nothwendige
Zwischenraum zwischen den Haͤmmern und denselben und den Wandungen darf nur
etwa 1/8 bis 1/4 Zoll seyn. Die Laͤnge des Hammers muß dem ganzen
vorbemerkten Gewichte genuͤgen.
Die Zapfen q, um welche die Hebung der Haͤmmer
erfolgt, sind von hartem Holze und in das geschlizte Ende des Haͤmmerarmes
q mittelst Keilen r
dergestalt befestigt, daß ein Verstellen desselben, und somit auch des Hammers
selbst moͤglich ist. Der Haͤmmer muß naͤmlich uͤber der
nach demselben Bogen geformten Ruͤklehne in einem genauen Abstande von etwa
1/8 bis 1/4 Zoll hinstreichen. Damit das Armenende nicht gesprengt werden kann, wird
noch eine Schraube angeordnet. Die Zapfenhalter s
koͤnnen von Holz, am zwekmaͤßigsten aber von Gußeisen gefertigt und an
das Rahmstuͤk des, wie die Zeichnung nachweist, einfach, aber fest
verbundenen Geruͤstes festgeschraubt werden. Zur Unterstuͤzung und
Anbringung der Zapfenhalter fuͤr die Arme der Waschhaͤmmer dienen die
uͤber und auf den Naͤhmen des Geruͤstes gelagerten und
befestigten Hoͤlzer y, y. Die Befestigung der
Arme in den Haͤmmern geschieht durch Holzkeile. Fuͤr den Waschhammer
wird der verlaͤngerte Arm zugleich als Hebelatte benuzt, fuͤr den
Walkhammer aber muß eine eigene Hebelatte t in den
Haͤmmer selbst eingezapft, durch Keile mit demselben verbunden, in beiden
Anwendungen aber durch untergelegte eiserne Schienen u
gegen das Abarbeiten durch die Daumen v geschuͤzt
werden. Da der erste Zahn der Haͤmmerbahn (der Treibzahn) nach seinem vollen
Einfalle nicht die tiefste Stelle des Loches erreichen darf, sondern in einer
Entfernung von 1 bis 1 1/2 Zoll verbleiben muß, so ist bei der Einlage des Armes in
dem Waschhammer und der Befestigung der Hebelatte in dem Walkhammer Ruͤksicht
hierauf genommen worden. Zur Fuͤhrung der Waschhammer beim Heben und Fallen
dienen die Gleitschienen g, zu der der Walkhammer aber
die Gleitschienen w, w. Leztere sind in das die
Ruͤklehne des Loches bildende Leistenholz e
eingezapft, mit dem anderen Ende dagegen in das auf die Riegel des Geruͤstes
aufgelegte und befestigte Holz x mittelst Versazung
verbunden.
Hinter den Walk- und Waschloͤchern und innerhalb des Geruͤstes
wird die Daumenwelle gelagert. Fuͤr schwere Haͤmmer an kurzen Armen
macht man die Welle dreihuͤbig und laͤßt sie 15 bis 20 Umdrehungen in
der Minute machen, so daß 45 bis 60 Schlaͤge von den Walkhaͤmmern in
derselben Zeit gemacht werden. Die Waschhaͤmmer duͤrfen nur eben 30
bis 40 Schlaͤge machen, weßhalb die Welle auch nur zweihuͤbig ist. Das
gewoͤhnliche Verfahren, die Daumen zum Heben der Walkhammer mit halbem
Schwalbenschwanz und durch Keile in der Welle zu befestigen, schwaͤcht
leztere sehr; es ist daher zwekmaͤßig, gußeiserne Daumenringe auf die Welle
aufzukeilen, und diese mit Holz zu verschuhen (Fig. 49.). Wenn nur, wie
in der Zeichnung, ein Waschloch mit zwei Haͤmmern angeordnet ist, so werden
die Daumen von Holz gemacht und in der Welle, wie Fig. 48 anzeigt,
befestigt.
Bei Anwendung einer schmiedeisernen Welle und Uebertragung einer vorhandenen Bewegung
an dieselbe durch Riemen oder BaͤnderAm besten eignen sich hiezu und uͤberhaupt da, wo Naͤsse
vorwaltet, die in angemessener Breite gewebten leinenen Baͤnder,
uͤber welche von beiden Seiten ein aus Segeltuch geschnittener
Streifen mittelst Kautschukaufloͤsung durch heißes Plaͤtten
dergestalt befestigt wird, daß die Stoßfuge gerade in die Mitte der Breite
des Bandes trifft. Dergleichen Baͤnder sind in Nordamerika
gebraͤuchlich, und von daher dem koͤnigl. Gewerbeinstitute in
Berlin mitgetheilt worden. Da man sie sehr lang anfertigen und gerade halten
kann, so bieten sie wesentliche Vortheile. Sie sind, nach allen Nachrichten,
auch sehr dauerhaft., die, wenn diese Uebertragung mit Vortheil geschehen soll, nie mit
abnehmender, sondern immer mit zunehmender Geschwindigkeit geschehen muß, bedient
man sich auch der in Fig. 51 gezeichneten
Construction. Hienach sind fuͤr jeden Haͤmmer drei Daumen in drei
hinter einander liegenden Ebenen und von einer solchen Laͤnge angeordnet, daß
wenn der erste Daumen den Haͤmmer durch Angriff gegen und unter die ebenfalls
in drei Abstufungen aus Gußeisen gefertigte und auf Holz befestigte Hebelatte bis zu
1/3 des Hubes gehoben hat und eben loslassen will, der zweite Daumen und endlich der
dritte Daumen zur Thaͤtigkeit gelangen. Das Erheben des Hammers auf den
ganzen Betrag des Hubes erfolgt also in drei Abstufungen.
Die Daumen sind von Gußeisen und mit Schmiedeisen belegt; die Befestigung auf der
Welle geschieht durch einen Schluͤssel oder Keil. Auf der Welle selbst wird
mit Vortheil ein Schwungrad angeordnet.
Von der Zahl der Huͤbe, die in der Zeit von einer Minute gemacht werden, und
von dem Gewichte der Haͤmmer ist die Kraft zur Bewegung der Haͤmmer
eines Walk- oder Waschloches abhaͤngig. Zu 45 bis 60 Huͤben,
die etwa 18 bis 20 Zoll betragen, und dem Gewichte eines Hammers von 2 1/2 bis 3 1/2
Cntr. gehoͤren fuͤr ein Walkloch 1 1/2 bis 2 Pferde, fuͤr ein
Waschloch aber nur 1 bis 1 1/2 Pferde.
Die Menge oder das Gewicht des Tuches zu bestimmen, welches in irgend einer Zeit bei
der angegebenen Zahl von Huͤben durch die Haͤmmer gewalkt werden kann,
ist bei der Verschiedenheit der Waare im Gewichte, der groͤßeren oder
geringeren Dichtigkeit des Gewebes, der Feinheit der Wollhaare, der Farbe etc. nicht
moͤglich, auch von der Einsicht und Geschiklichkeit des Walkers
abhaͤngig. Indeß hat hierauf auch die Form des Loches und der Haͤmmer
Einfluß. Bei kalter Walkmethode, die insbesondere zu einer starken und dauerhaften
Waare zwekdienlich ist, soll das Wenden und Quetschen der eingelegten Tuͤcher
bei einer dem Tuchquantum anpassenden Groͤße des Loches regelmaͤßig
und schnell erfolgen. Je staͤrker die Brustlehne des Walkloches
gewoͤlbt ist, desto rascher wird das eingelegte Tuch wenden, wenn der hinter
und auf das Tuch schlagende Haͤmmer dasselbe gegen die Brustlehne
andruͤkt und an dieser in die Hoͤhe schiebt. Zur Verzahnung der
Bahnflaͤche eines Walkhammers verfaͤhrt man in folgender Art:
Man zieht durch die Mitte des Zapfens des Armes eines Walkhammers (Fig. 49 und 51) die
Horizontale γ, δ, traͤgt hierauf
von δ nach γ =
2 Fuß 6 Zoll ab, und faͤllt die Lothlinie γ,
α Beschreibt man nun mit der Laͤnge von 6 Fuß 5 Zoll aus δ die aͤußere Kruͤmmung des
Hammers, so wird der Durchschnittspunkt α die
tiefste Stelle des Walkloches (den Grund) und die Schaͤrfe des ersten Zahnes
des Hammers (des Treibzahnes) angeben. Man theilt hierauf die Staͤrke des
Hammerholzes β, ε (etwa 14 bis 16 Zoll
betragend) in 5 Theile, macht α, β = 3 1/2
solcher Theile, zieht den Radius β, δ und
traͤgt von β nach η 3 Theile ab; η, ι = ε, η weniger 1/2 Zoll und rechtwinklig auf
ε, η gibt eine Verzahnung. ι, κ in der Richtung des Radius und 1 1/4
bis 1 1/2 Zoll lang gemacht, gibt den Punkt κ,
nach welchem von α aus die Linie α, κ gezogen wird, um den Treibzahn zu
erhalten, der in der Regel um 1 1/2 Zoll abgestumpft wird, und auch um so viel von
der tiefsten Stelle des Loches entfernt bleibt, wenn der Hammer gefallen ist, und die Hebelatte auf der
Leiste oder der Ruͤklehne aufliegt.
Die Woͤlbung der Brustlehne wird aus den beiden in einer geraden Linie
befindlichen Mittelpunkten λ, μ
beschrieben, die rechtwinklicht den Radius β,
δ in einer Entfernung von 2/5 der Starke des Haͤmmerholzes
schneidet; das Bogenstuͤk α, ν wird
mit dem Halbmesser μ, α = 3/5 β, ε und der Bogen ν, ο mit ν, λ =
6/5 β, ε weniger 1 1/2 Zoll
beschrieben.
Um das Loch fuͤr etwas staͤrkere Tuͤcher zu erweitern, das
Wenden weniger rasch machen zu lassen, und endlich um den oberen Theil der
Brustlehne, als den am meisten der Abnuͤzung unterworfenen Theil des Loches
mit Leichtigkeit herstellen zu koͤnnen, sezt man das Einsazbrett w mit einer Versazung in die Brustlehne ein, und bewirkt
die Befestigung desselben durch zwei von der Seite eingestekte eiserne Bolzen.
– Viele Fabrikanten ziehen es vor, die Waare erst zu walken und dann erst zu
waschen, und behaupten auf diese Weise derbere und reinere Waare zu erhalten, als
wenn sie erst waschen und hierauf walken. – Die Waare selbst wird dann in der
Regel in zwei Stuͤken in das Loch (auch der Kumm genannt) eingelegt, kalter
Urin und aufgeloͤste Seife darauf gegossen, und muß etwa 20 bis 30 Minuten
herumgehen. Sie wird hierauf herausgenommen, umgelegt (uͤbergerichtet) und
mit Zusaz von Urin und Seife das Walken selbst begonnen, nach Verlauf von 2 bis 3
Stunden wieder herausgenommen, uͤbergerichtet, und mit dem Walken so
Laͤnge fortgefahren, bis die verlangte Laͤnge und Breite erreicht ist.
Nach Beschaffenheit der Waare, nach der Farbe etc. kann das Walken einen Zeitaufwand
von 12 bis 24 Stunden erheischen. Troken darf die Arbeit nicht fortgesezt, und es
muß daher so oft etwas in Urin aufgeloͤste Seife zugesezt werden, als
erforderlich ist. Die Einwirkung der Haͤmmer auf die Waare, das Wenden bei
gedraͤngter Einlage, wodurch ein Reiben der Tuchflaͤchen gegeneinander
und den Waͤnden des Loches Statt findet (daher die dem Tuchquantum am
gemessene Groͤße des Loches), verursacht das Warmwerden der Waare, und somit
das Filzen. Warmes Wasser veranlaͤßt nur ein theilweises Filzen, und sollte
daher gar nicht anders als zur Aufloͤsung der Seife verwendet werden, die
sehr verduͤnnt mit Urin zulezt an das Tuch gethan wird, um es zum Steigen zu
bringen. Ist das Walken beendigt, so wird das Tuch durch fortwaͤhrendes
Hinzufuͤhren von kaltem und reinem Wasser ausgewaschen. – Die
Zuleitung des Wassers erfolgt durch eine Rinne und Roͤhre in dem hohlen Raum,
am oberen Theile der Brustlehne jedes Walkloches, aus welchem es durch
Loͤcher in das Loch selbst gelangen kann. Zum Abfuͤhren des Wassers dient die am
Grunde und in der Seite des Loches angebrachte Oeffnung, die beim Nichtgebrauch
durch einen Stoͤpsel verstopft wird.
Die Construction der Verzahnung der Waschhammer und des Loches weicht von derjenigen
der Walkhammer und des Walkloches ab. Nach der tiefsten Lage des Treibzahns eines
Waschhammers ist der Mittelpunkt des Zapfens des Haͤmmerarmes etwa 3 Zoll zur
Seite der Lothlinie α, ο die jenen trifft,
angenommen. Die Entfernung des Zapfenmittels von der aͤußeren Kante des
Hammers betraͤgt 7 Fuß 7 Zoll (Fig. 48 und 50), und die
Staͤrke des Hammerholzes etwa 12 bis 14 Zoll. Diese Staͤrke wird hier
in 4 Theile getheilt, und hievon wieder 3 Theile (etwas reichlich) zur
Bogenlaͤnge α, β genommen. Der
Radius β, γ bestimmt wieder den ersten
Zahn, der durch γ, δ (= 1/4 β, γ) und ε,
δ gebildet wird. ε, δ
steht senkrecht auf β, γ. Der zweite Zahn
wird durch ε, η und η, ι gebildet, deren Abmessungen denen des ersten Zahnes
gleich sind; der Treibzahn endlich ergibt sich, wenn α, κ gezogen wird, nachdem ι,
κ = 1 1/4 bis 1 1/2 Zoll gemacht worden. Auch hier wird der
Treibzahn etwa 1 1/2 Zoll abgestumpft.
Die Woͤlbung der Brustlehne wird auch hier durch zwei Kreisbogen aus den
beiden Mittelpunkten λ und μ beschrieben. Der Punkt λ liegt
in der Lothlinie α, ο und zwar 6 1/2 Zoll
uͤber α; der Punkt μ in der Linie μ, ν, die
durch λ so gezogen ist, daß die Entfernung des
Punktes μ von β etwa 7 Zoll betraͤgt.
Im oberen Rande ist wieder die Rinne zur Zuleitung des Wassers, in der
Ruͤklehne f des Waschloches aber mehrere
Loͤcher angebracht, durch welche das schmuzige Wasser ablaufen kann.
Das Waschen erfolgt mit Zusaz von den Loͤsungsmitteln, die fruͤher
angegeben wurden, in einer dem Walken aͤhnlichen Art. Die zwei
Haͤmmer, die in Abstanden von 1/8 Zoll von einander von der Ruͤklehne
und den Wandungen arbeiten, quetschen und wenden das eingelegte Tuch, und bringen
die Loͤsungsmittel so Laͤnge in Beruͤhrung mit den Wollhaaren,
bis der Schmuz geloͤst und demnaͤchst durch Spuͤlen mit reinem
Wasser moͤglichst beseitigt werden kann.
Ein Waschloch ist zureichend fuͤr den Bedarf von vier Walktuͤchern. Das
Urtheil hiesiger Fabrikanten uͤber die Vorzuͤge der
Walzenwaschmaschine vor den Waschhaͤmmern ist nicht uͤbereinstimmend;
in England gibt man den ersteren den Vorzug vor den lezteren. Vor mehreren Jahren
kaufte das koͤnigl. Gewerbe-Institut einen Walkstok von Lee in
Trowbridge bei Leeds in England an. Der Gebrauch solcher Walkstoͤke ist in
England fast allgemein, und die in Berlin damit angestellten Versuche haben
genuͤgend ihre zwekmaͤßige Construction bewaͤhrt. Eine
Abbildung dieses Walkstokes wird in Fig. 52, 53 und 54 in Seiten-,
Stirn- und Oberansicht, Fig. 55 im
Laͤngendurchschnitt mitgetheilt. Außerdem enthalten Fig. 56 mehrere Ansichten
und Durchschnitt des aus Gußeisen gefertigten Zapfentraͤgers und der Wand zur
Befestigung der Brustlehne, die, wie uͤberhaupt die Ruͤklehne und die
Wandungen, von Holz sind; Fig. 57 die Daumenwelle
mit Riemen- und Daumenscheibe aus Gußeisen. Der Mechanikus Mohl (in Berlin) baut solche Walkstoͤke, und
berechnet den Preis zu 400 Thlrn.
Vergleicht man hier den Laͤngendurchschnitt Fig. 55 mit in Fig. 46
gegebenen Abbildungen von der in Holz mehrfach ausgefuͤhrten Walke, so ergibt
sich, daß Form der Verzahnung der Haͤmmer und Woͤlbung der Brustlehne
mit der englischen Walke uͤbereinstimmen. Die Brustlehne ist nur gegen die
Rippen der Wand von Gußeisen angelehnt, und durch die Ausfuͤtterung der aus
Holz gemachten und an gußeiserne Seitenplatten angeschraubten Wandungen
gegengedruͤkt. Die durch die hoͤlzerne Ruͤklehne gezogenen
Schraubenbolzen halten die Wandungen in der richtigen und festen Entfernung von
einander. Die Gleitschienen sind auch von Holz, in die Ruͤklehne eingezapft,
und oben durch zwei schmiedeiserne Zugstangen mit dem gußeisernen
Zapfentraͤger verbunden.
Die in der Zeichnung deutlich angegebene Verbindung der einzelnen Theile dieses
Walkstokes bedarf wohl kaum einer Erklaͤrung. Fuͤr die Erreichung
guter Resultate ist es indessen Bedingung, den Walkstok genau in der bemerkten
Stellung zu befestigen. Die Haͤmmerarme bilden verlaͤngert die
Hebelatten; sie sind gegen Abnuͤzung mit schmiedeisernen Platten verschuht.
Zum Heben der Haͤmmer dient eine in Fig. 57 abgebildete
Daumenscheibe. Die hoͤlzernen Daumen werden hier fuͤr beide
Haͤmmer an einer Scheibe, und zwar von jeder Seite zwei gegen die Scheibe,
und in hier angegossene Kaͤstchen eingelegt und festgeschraubt. Die Scheibe
ist in der Zeichnung nur zweihuͤbig; die Erfahrung hat indessen gelehrt, daß
es vortheilhafter ist dieselben groͤßer und dreihuͤbig zu machen.
Tafeln