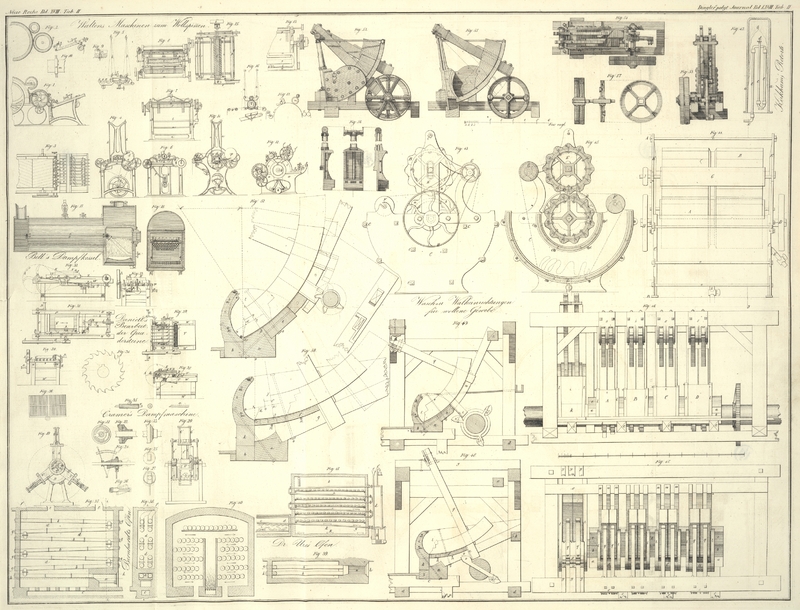| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Fabriciren und Appretiren von Wollen- und anderen Zeugen, worauf sich James Walton, Wollenwaaren-Fabrikant von Sowerby Bridge Mills in der Grafschaft York, am 21. März 1837 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. XXV., S. 109 |
| Download: | XML |
XXV.
Verbesserungen an den Maschinen zum Fabriciren
und Appretiren von Wollen- und anderen Zeugen, worauf sich James Walton,
Wollenwaaren-Fabrikant von Sowerby Bridge Mills in der Grafschaft York, am 21. Maͤrz 1837 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions.
Maͤrz 1838, S. 139.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Walton's Maschinen zum Fabriciren von Wollenzeugen.
Meine Erfindung betrifft: 1) die dem Wollenspinn-Processe vorangehende
Verwandlung der Wollenvließe in sogenannte Wikler oder Floͤthen. 2) die
Zusammensezung einer Maschine zum Aufrauhen oder Aufbuͤrsten des Haares
wollener und anderer Zeuge. 3) endlich das Scheeren wollener und anderer das
Scheeren beduͤrfender Zeuge.
Fig. 1 ist
eine Abbildung eines Theiles einer Kardaͤtschmaschine, an der einige meiner
Verbesserungen angebracht sind. Fig. 2 ist ein
Durchschnitt, und Fig. 3 ein Grundriß von Fig. 1. An allen diesen
Figuren ist a, a eine Reihe endloser lederner oder
anderer Laufbaͤnder, welche um die Walze b und um
die Rollen c, c laufen. Diese Rollen sind, um die
Floͤthenbreiten von einander zu trennen, unter einem Winkel gestellt. Auf
jedem der Laufbaͤnder a, a ruht eine Spindel, die
nicht umzulaufen braucht, sondern die durch einen entsprechenden Haͤlter
unter einem Winkel erhalten wird, und auf ihr endloses Laufband druͤkt. Die
Spindelhaͤlter sind so eingerichtet, daß der Winkel, unter dem die Spindeln
erhalten werden, abgeaͤndert werden kann. d, d
ist eine Reihe kreisrunder Schneidinstrumente, die ich vorzugsweise aus
gehaͤrtetem Stahle verfertigen lasse, und die mit ihren Schneiden auf der
Walze e, deren Oberflaͤche zur Aufnahme der
Schneidinstrumente d, d gehaͤrtet ist, ruht. Wenn
der Walze e eine langsame Bewegung mitgetheilt wird, so
erhalten auch die Schneidinstrumente, indem sie sachte gegen die Oberflaͤche
der Walze e angedruͤkt werden, gleichfalls eine
rotirende Bewegung mitgetheilt. Das von dem Cylinder herlaufende endlose breite
Wollenvließ wird durch die Schneidinstrumente in mehrere Streifen oder Breiten
zerschnitten, und alle diese Streifen gelangen, indem sie von den endlosen
Laufbaͤndern a, a vorwaͤrts
gefuͤhrt werden, unter die Spindeln, wo sie dann in spiralfoͤrmiger
Richtung um die Spindeln gewunden, und durch irgend eine der bekannten Vorrichtungen
gerollt oder verdichtet werden, so daß sie zum Spinnen bereit sind. In der hier
gegebenen Zeichnung sieht man zu diesem Behufe eine aus drei Walzen
f, g, g bestehende Vorrichtung angebracht. Die Walze f theilt ihre rotirende Bewegung an die Walzen g, g mit, und diesen lezteren wird außerdem noch auf
irgend eine der bekannten Weisen in der Richtung ihrer Laͤnge eine
Hin- und Herbewegung gegeben. Da die in Floͤthen geschnittenen
Wollenstreifen offenbar auch gerollt werden koͤnnen, ohne daß man ihnen eine
spiralfoͤrmige Richtung zu geben braucht, so kann man die Spindeln und die
Laufbaͤnder oder die zur Bewegung dienenden Oberflaͤchen wohl auch
entbehren, und in diesem Falle zum Rollen bloß bewegliche Oberflaͤchen
anwenden. Ich gebe jedoch der den Faden mitgetheilten spiralfoͤrmigen
Richtung den Vorzug. Man wird finden, daß die spiralfoͤrmige Drehung der
Fasern mehr oder minder stark ist, je nachdem der Winkel, den die Spindeln mit der
Linie der Laufbandwelle bilden, ein mehr oder minder spizer ist.
Bei den gewoͤhnlichen Methoden, die man zum Behufe des Aufstellens oder
Aufbuͤrstens und Scheerens des Haares der Wollentuͤcher und sonstigen
Wollenzeuge zu befolgen pflegt, laͤuft der Zeug ohne Unterbrechung
vorwaͤrts, waͤhrend sich sowohl der Rauch- als der
Scheercylinder in unbeweglichen Zapfenlagern dreht. Findet nun an dem Rauhcylinder
irgend eine Unvollkommenheit Statt, so wird hieraus auch ein unvollkommenes
Aufrauhen erfolgen, und eben so wird das Scheeren unvollkommen von Statten gehen,
wenn der Scheercylinder eine Unvollkommenheit darbietet. Diese Bemerkungen treffen
hauptsaͤchlich die gewoͤhnlichen Rauh- oder Gigmuͤhlen,
ausgenommen sie sind nach dem Patente gebaut, welches ich unterm 23. Oktober 1835
erhielt.Man findet dieses Patent im Polyt. Journ. LXI. S. 382. Dieser meiner fruͤheren Erfindung gemaͤß wird naͤmlich
dem Tuche nicht bloß eine ununterbrochene Vorwaͤrtsbewegung mitgetheilt,
sondern das Lager, auf dem sich das Tuch bewegt, wird zugleich auch einer
excentrischen Bewegung theilhaftig. Das Lager und das auf diesem befindliche Tuch
beschreibt in Folge der darauf wirkenden Excentrica mit jedem seiner Punkte
fortwaͤhrend Kreise, so daß das Tuch nicht nur seitlich uͤber die
Laͤnge des Scheercylinders, sondern auch in seiner Laͤngenrichtung
wieder zuruͤkbewegt wird, wie dieß aus der Beschreibung meines
fruͤheren Patentes mit der demselben beigegebenen Zeichnung deutlich erhellt.
Durch meine gegenwaͤrtigen Verbesserungen beabsichtige und erzweke ich
nunmehr eine solche Verbindung der Maschinerie, daß das Tuch nebst seiner
fortschreitenden Bewegung in Hinsicht auf die Schneiden des Scheercylinders auch
noch eine Bewegung erhaͤlt, durch die es immer und immer wieder dem
Scheerprocesse ausgesezt wird: so zwar, daß jeder Theil des Tuches, auf den in irgend
einem Zeitmomente die Schneiden wirkten, durch den Gang der Maschine abermal in den
Bereich des Scheercylinders gelangt. Da jedoch der Scheercylinder
fortwaͤhrend umlaͤuft, so wird kein auf der Oberflaͤche des
Tuches befindlicher Punkt, der ein Mal mit einem bestimmten Theile des
Scheercylinders in Beruͤhrung gekommen ist, noch ein Mal unter den Bereich
derselben Stelle der Schneiden des Cylinders gelangen. Der einzige Unterschied, der
zwischen meiner jezigen und meiner fruͤheren Methode besteht,
beschraͤnkt sich darauf, daß, was das Scheeren betrifft, das Tuch sich bei
ersterer jeder Zeit und ununterbrochen in einer geraden Linie bewegt,
waͤhrend bei lezterer die Bewegung in einer durch die Anwendung der
Excentrica bedingten Curve Statt findet. Zu bemerken kommt uͤbrigens, daß,
obgleich ich oben von derlei Bewegungen des Tuches gesprochen habe, dieß relativ mit
der Bewegung der Achse der Scheermaschine gemeint ist, denn die auf die
Tuchoberflaͤche und auf die Oberflaͤche des Scheercylinders
bezuͤglichen Bewegungen lassen sich entweder dadurch, daß man den
Zapfenlagern der Welle des Scheercylinders eine Hin- und Herbewegung
mittheilt, oder dadurch, daß man dem Tuche selbst die noͤthigen Bewegungen
gibt, erzielen. Ich ziehe es vor, den Scheercylinder neben seiner fortlaufenden
rotirenden Bewegung auch noch einer queren Hin- und Herbewegung theilhaftig
zu machen. Ich will nun versuchen meine auf das Scheeren des Tuches
bezuͤglichen Verbesserungen zuerst zu beschreiben.
Fig. 4 ist ein
Endaufriß einer mit meinen Erfindungen ausgestatteten Scheermaschine, und Fig. 5 ein
Querdurchschnitt der arbeitenden Theile durch die Mitte der Maschine genommen. An
dem Gestelle a, a bemerkt man den Rigger oder die
Treibrolle b. Die Laufbandrolle c dient zum Umtreiben des Scheercylinders, die Rolle d hingegen zum Umtreiben der Kurbelwelle e, die durch das Rad g die
Zugwalze f in Bewegung sezt. Die Verbindungsstange h bewegt sich mit dem einen Ende an einem in die
Flaͤche der Scheibe e eingelassenen Kurbelzapfen,
mit dem anderen hingegen an einem in den Scheerenwagen i
eingelassenen Zapfen. Dieser Wagen ist an den Stangen k,
die sich um die Welle l bewegen, aufgehaͤngt. Der
Scheercylinder ist nach der herkoͤmmlichen Art gebaut; das Tuch ruht auf dem
Lager m, welches durch die excentrischen Rollen n, die ihrerseits durch den Hebel o ihre Bewegung mitgetheilt erhalten, auf und nieder bewegt wird. Die
Walzen p, p erhalten das Tuch gespannt; zwei derselben
senken sich mit dem Lager herab, damit man das Tuch leichter in die Maschine bringen
kann. q ist der Scheercylinder und die in dem Wagen i sinne Buͤrste, womit das Haar des Tuches aufgestellt
wird, waͤhrend sich der Wagen hin und her schwingt. Nach der ganzen
Laͤnge der Maschine laͤuft unter dem Lager die Zahnstange s, an der sich der eiserne Buͤgel t frei schiebt, wenn er mittelst des Getriebes u und des Griffes v in
Bewegung gesezt wird. Von den Enden dieses Buͤgels aus ist uͤber die
Flaͤche des Lagers ein Stuͤk elastischen Stahles oder eines anderen
Metalles oder auch eines Zeuges festgespannt, wie man dieß in Fig. 9 und 10 bei w sieht. Dieses laͤßt sich je nach der Breite des
Tuches so bewegen, daß es die Sahlbaͤnder bedekt, damit, wenn man will, deren
Haar nicht abgeschnitten wird. Die Pfeile deuten an, in welcher Richtung sich das
Tuch bewegt.
Diese Maschine arbeitet nun auf folgende Weise. Wenn das Lager m und die Walzen p herabgesenkt worden sind,
was dann geschieht, wenn man den Hebel o in die aus Fig. 11 zu
ersehende Stellung bringt, so fuͤhrt man das Ende des Zeuges zwischen den
Spannungswalzen hindurch und uͤber das Lager an die mit Karden,
Pluͤsch oder Tuch uͤberzogene Zugwalze f.
Wenn man hierauf das Lager m in die in Fig. 4 angedeutete
Stellung emporbringt, so kann die Maschine in Gang gesezt werden. Befindet sie sich
wirklich in Gang, so bewegt sich sowohl der Scheercylinder q, als die Aufrauhbuͤrste r mit dem
Wagen i auf der Tuchoberflaͤche hin und her,
wodurch beide mehrere Mal uͤber einen und denselben Theil des Tuches bewegt
werden.
Fig. 6 ist ein
End-, Fig.
7 ein Frontaufriß und Fig. 8 ein Grundriß einer
zwar nach demselben Principe, aber nach einer etwas anderen Anordnung gebauten
Maschine. In dem Gestelle a, a bemerkt man gleichfalls
die Treibrollen b, so wie auch die Laufbandrollen c und d, von denen erstere
zum Umtreiben der Scheerwerkzeuge, leztere hingegen zum Treiben der Zugwalze dient.
Die Kurbeln c sezen durch die Verbindungsstangen g den Wagen f in Bewegung.
h ist das elastische Lager, i der rotirende Scheercylinder, j die
Zugwalze, k, k die Falzen, in denen sich das Lager auf
und nieder bewegt, l eine Welle, an der sich zwei zum
Emporheben des Lagers bestimmte Kaͤmme oder Excentrica befinden, m Schrauben zur Adjustirung des Lagers nach den
Scheerenblaͤttern, n eine Welle zur Bewegung
dieser mit den abgestuzt kegelfoͤrmigen Raͤdern o in Verbindung stehenden Schrauben. Der einzige Unterschied zwischen
dieser und der naͤchst vorher beschriebenen Maschine beruht darauf, daß der
Wagen oben auf dem Gestelle mit Raͤdern auf Schienenbahnen laͤuft. Die
Schneiden der Scheerwerkzeuge bewegen sich demnach mit dem Lager parallel, anstatt
nach der oben angegebenen Methode einen Kreisbogen zu beschreiben.
Fig. 11 ist
ein Endaufriß einer Maschine zum Scheeren wollener und anderer Tuͤcher, an
der auch die zum Aufrauhen des Haares dienenden Vorrichtungen angebracht seyn
koͤnnen. Fig. 12 ist ein Durchschnitt durch einige Maschinentheile, in der Mitte
der Maschine genommen. Fig. 13 endlich ist ein
Frontaufriß, woran die Zugwalzen und ein Theil des Raͤderwerkes beseitigt
sind. In dem Gestelle a laͤuft die Treibwelle b lose um die Welle des Cylinders c, den ich das Lager der Maschine nennen will. Die Laufbandrolle d ist mit einer der Treibrollen aus einem Stuͤke
gegossen oder auf irgend andere Weise daran befestigt. An ihr ist auch die Laufband,
rolle e festgemacht, so daß sich alle drei Rollen
gemeinschaftlich an der Welle des cylindrischen Lagers bewegen. Der gußeiserne
Rahmen l ist so gebohrt, daß er sich lose an der Welle
des Lagers bewegen kann; mit jedem Ende des Lagers steht ein solcher Rahmen durch
drei Querstangen g in Verbindung. Oben auf diesem Rahmen
ist sowohl der Scheer- als der Aufrauhcylinder i
angebracht. Die Wechselbewegung oder Zahnstange k treibt
diese beiden Cylinder concentrisch mit dem Lager hin und her, welche Bewegung aber
uͤbrigens auch durch eine Kurbel oder durch eine excentrische Scheibe
hervorgebracht werden kann. An dem einen Ende der Welle l befindet sich ein Getrieb, welches in die Zahnstange eingreift; an dem
anderen Ende dagegen befindet sich eine Laufbandrolle, die von der Rolle e her umgetrieben wird. Die Zugwalzen m erhalten ihre Bewegung von der Laufbandrolle n her. Von den zur Spannung dienenden Walzen
laͤßt sich eine zum Behufe der Regulirung der Spannung des Tuches mit
Huͤlfe der Schraube p adjustiren. Die mit Karden
oder Borsten besezte Walze q laͤuft mit zwei Mal
groͤßerer Geschwindigkeit um als der Aufrauhcylinder, damit sie lezteren von
den auf ihn angesammelten Fasern reinigt, und sie in das fuͤr sie bestimmte
Gehaͤuse schafft. Aus dieser Beschreibung erhellt, daß diese Maschine, wie
sehr sie auch in der Anordnung ihrer Theile abweichen mag, doch auf demselben
Principe beruht; d.h. das rotirende Scheerinstrument bewegt sich hin und her, und
wiederholt den Schnitt mehrere Mal, wobei jedoch nie wieder derselbe Punkt desselben
auf denselben Punkt der Tuchoberflaͤche wirkt.
Fig. 14 ist
ein Endaufriß einer Maschine zum Aufrauhen des Haares und zum Niederbuͤrsten
und Reinigen wollener und anderer Tuͤcher. Fig. 15 ist ein Grundriß
oder eine Ansicht im Vogel-Perspektive. Fig. 16 endlich zeigt
einige der arbeitenden Theile im Durchschnitte. In dem Gestelle a, a sieht man die Treibrolle b und die Buͤchse, mit deren Huͤlfe die Maschine angehalten
oder in Gang gesezt wird. Die Laufbandrolle c dient zum
Umtreiben des mit Karden besezten Rauhcylinders d. die Einrichtung dieses
lezteren erhellt am besten aus Fig. 15, wo d, d, d ein spiralfoͤrmig um den Cylinder
gewundenes Kardenleder ist und e, e, e eine zwischen die
einzelnen Kardenreihen gebrachte Rippe, welche bis in die Naͤhe der
Kardenspizen emporreicht, und sie hindert zu stark in das Tuch einzudringen. Diese
Rippe ist zur Verhuͤtung der Reibung auf dem Tuche mit einem duͤnnem
Zinkbleche oder mit einem anderen glatten Metalle bedekt. Fuͤr feinere
Tuͤcher fand ich es noch zwekmaͤßiger, anstatt dieser
Metalloberflaͤchen eine spiralfoͤrmige Buͤrste zwischen den
spiralfoͤrmig laufenden Karden anzubringen. Der mit Karden besezte Cylinder
f dient zum Austreiben der zwischen den Karden des
Cylinders d angesammelten Fasern, zu deren Aufnahme die
Buͤchsen g, g bestimmt sind. Der Rauhcylinder ist
in dem durch die Stangen i, i zusammengehaltenen Rahmen
h aufgehaͤngt; diese Stangen gewaͤhren
auch dem Tuche eine Unterlage, wenn dasselbe durch die Spannung des Stuͤkes
emporsteigt. Das elastische Lager k ist als herabgesenkt
und außer Dienst befindlich dargestellt; soll es in Anwendung gebracht werden, so
laͤßt sich's mit Huͤlfe des Excentricums l
und des Hebels m emporbewegen, wo man ihm dann den
Cylinder mittelst der Schraube n adjustirt. p ist eine Kurbelwelle, die von der Rolle q her mittelst eines Laufbandes umgetrieben wird, r eine Zugwalze, die ihre Bewegung von der Kurbelwelle
her mitgetheilt erhaͤlt, s Spannungswalzen, t eine Stell- oder Adjustirschraube, n Aufhaͤngstangen, an denen sich der
Aufrauh-Apparat schwingt; v Verbindungstangen,
womit der Rahmen h in Bewegung gesezt wird. Man kann
sich dieser Maschine auch bedienen, um auf einem festen Lager, uͤber welches
sich das Tuch bewegt, und welches aus einem etwas nach der Flaͤche
gewoͤlbten Holz- oder Metallstabe besteht, aufzurauhen oder zu
buͤrsten.
Wenn man die Rauhmaschinen diesem Theile meiner Erfindung gemaͤß anfertigt, so
ergibt sich in Folge des geringen Umfanges, den der Rauhcylinder erheischt, und in
Folge des kleineren Raumes, den eine zur Verrichtung einer bestimmten Arbeit
dienende Maschine einnimmt, eine bedeutende Ersparniß. Es erhellt aus meiner
Beschreibung, daß der Zwek meiner Erfindung, in so fern sie sich auf das Aufrauhen
und Scheeren wollener und anderer dieses Processes beduͤrfender Zeuge
bezieht, darauf hinausgeht, dem Tuche in Hinsicht auf die Aufrauh- und
Scheercylinder eine solche Bewegung zu geben, daß es, anstatt sich ununterbrochen
unter Cylindern, die ihre Stellung nicht veraͤndern, fort zu bewegen,
wiederholt in den Bereich des Aufrauh- und Scheercylinders kommt. Ob sich
hiebei die Cylinder in Beziehung auf das Tuch bewegen, oder ob eine Bewegung des Tuches in Hinsicht
auf die Cylinder Statt findet, ist nicht von Belang. Der einzige Grund, warum ich
jedoch lieber den Cylindern der Rauh- sowohl als der Scheermaschine die
Hin- und Herbewegung gebe, beruht darin, daß diese Bewegung leichter zu
erzielen ist, als jene des Tuches. Diese Bewegungen lassen sich durch mancherlei
Mittel hervorbringen; ich habe jene angegeben, die mir als die zwekmaͤßigsten
erschienen, binde mich aber keineswegs an sie allein; so wenig als ich irgend einen
der einzelnen Theile der beschriebenen Maschinen als meine Erfindung in Anspruch
nehme. Endlich muß ich noch bemerken, daß der Aufrauh- oder Scheercylinder
nicht durch- aus nach der Breite des Tuches angebracht zu seyn und in dieser
Richtung zu spielen hat; sondern daß man ihn auch unter einem Winkel stellen und
unter diesem arbeiten lassen kann, wenn die Maschine demgemaͤß eingerichtet
wird.
Tafeln