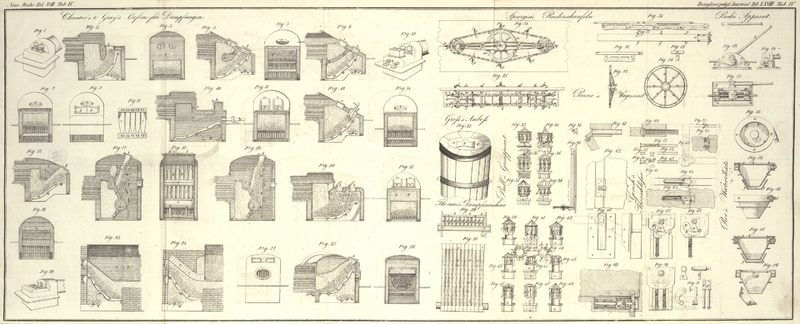| Titel: | Verbesserungen an den Oefen für Locomotiven und andere Maschinen, worauf sich John Chanter Esq. in Earl Street in der City of London, und John Gray, Ingenieur von Liverpool, am 17. Februar 1837 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. LI., S. 242 |
| Download: | XML |
LI.
Verbesserungen an den Oefen fuͤr
Locomotiven und andere Maschinen, worauf sich John Chanter Esq. in Earl Street in der City of
London, und John Gray,
Ingenieur von Liverpool, am 17. Februar 1837
ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April
1838, S. 193.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Chanter's und Gray's verbesserte Oefen.
Fig. 1 gibt
eine perspectivische Ansicht des Aeußeren eines Theiles eines Locomotivkessels und
Ofens. Fig. 2
ist ein Laͤngen- und Fig. 3 ein
Querdurchschnitt eines unserer Erfindung gemaͤß gebauten Ofens.
An diesen Figuren sieht man, daß die Roststangen a, a
gebogen sind, und mithin einen schief geneigten Rost bilden, damit das Brennmaterial
in dem Maaße, als dessen untere Theile der Verbrennung unterliegen und mithin an
Tragkraft verlieren, von Oben bestaͤndig nachrutscht. Das Eintragen der
frischen Kohle geschieht durch die Oeffnung b, welche
mit einem entsprechenden Thuͤrchen verschlossen wird. Die zur Aufnahme von
Wasser bestimmte Scheidewand c, c, welche den oberen
Theil der Heizstelle vor Verbrennung zu schuͤzen hat, reicht so weit hinab,
daß sie, wie man aus Fig. 2 sieht, einen Raum oder eine Kammer fuͤr die unverkohlte
Steinkohle bildet. Das Brennmaterial, welches sich am unteren Theile des Ofens
befindet, ist hienach in voller Verbrennung begriffen und stoͤßt keinen diken
schwarzen Rauch aus, waͤhrend die uͤber dem unteren Rande der
Scheidewand c befindliche Steinkohle in Folge der Hize,
die ihr von Unten herauf mitgetheilt wird, allmaͤhlich destillirt und
entzuͤndet wird. Da die hiebei sich entwikelnden Gase und Duͤnste in
keiner anderen Richtung als unter der Scheidewand c
hinweg entweichen koͤnnen, so muͤssen sie durch das unter dieser
Scheidewand in Verbrennung begriffene Brennmaterial stroͤmen und hiedurch
selbst wieder verbrannt werden. Es erhellt daher, daß bei einer solchen Einrichtung
des Ofens die Verbrennung ohne die laͤstige Verbreitung von Rauch
laͤngs der Bahn von Statten gehen kann. Man sieht in der Zeichnung diesen Theil unserer
Erfindung an einem Kessel angebracht, wie sie dermalen auf der
Liverpool-Manchester und anderen Eisenbahnen gebraͤuchlich sind. Da
diese Art von Kessel zur Genuͤge bekannt ist, so bedarf es bei der
Deutlichkeit der Zeichnung keiner weiteren Beschreibung. Wir bemerken nur, daß
dieser Theil unserer Erfindung wie gesagt in einer solchen Verbindung der
Scheidewand c mit den schraͤg gestellten
Roststangen besteht, daß das frisch eingetragene Brennmaterial zwischen ihnen
zuruͤkgehalten wird; und daß aller daraus entwikelte oder destillirte Dampf
und Rauch gezwungen wird durch jenes Brennmaterial, welches sich innerhalb in
lebhafter Verbrennung befindet, zu streichen. Alle hiebei aus dem frisch eine
getragenen Brennmateriale entwikelte Hize wird zur Erhizung des in der Scheidewand
c enthaltenen Wassers, welches mit dem Wasser im
Kessel communicirt, verwendet. Die durch die Scheidewand c fuͤhrenden Oeffnungen e, e, welche
Schiebthuͤren haben, gestatten dem Maschinisten Einsicht in die Feuerkammer,
und erlauben auch die Einfuͤhrung eines Hakens, im Falle sich die
Roͤhren, aus denen der horizontale Feuerzug besteht, verlegen sollten.
In Fig. 4 sieht
man einen Laͤngen- und in Fig. 5 einen
Querdurchschnitt eines Ofens, welcher dem eben beschriebenen im Wesentlichen
vollkommen aͤhnlich ist, sich aber durch die Gestalt der Feuerkammer, durch
die Kruͤmmung der Roststangen und durch die Stellung der Scheidewand c, c davon unterscheidet. Die Roststangen bilden hier
naͤmlich nicht eine ununterbrochene Curve, sondern sie bestehen aus einer
Schraͤgflaͤche und aus einer Curve. Die Scheidewand c, c, welche an dem zuerst beschriebenen Ofen von dem
oberen Theile des Kessels aus senkrecht herabstieg, und in der sich Oeffnungen
befanden, durch die der Maschinist schauen koͤnnte, bildet hier mit ihrer
unteren Flaͤche eine Curve, welche die Daͤmpfe und den Rauch, die sich
aus den auf dem oberen Theile der Roststangen liegenden Steinkohlen entwikeln, in
das Feuer ableitet. Die zur Einsicht dienende Oeffnung befindet sich hier an dem
oberen Theile der Feuerkammer, welche mit Wasser umgeben ist. Aus dieser Einrichtung
ergibt sich der Unterschied, daß in Folge der geringeren Neigung der Roststangen die
unentzuͤndete Kohle nicht nothwendig an der Scheidewand c, c anliegen muß, wie dieß bei der ersten Art von Ofen
der Fall war; dagegen findet aber in Hinsicht auf die Verbrennung der aus dieser
Kohle entwikelten Daͤmpfe und Rauchmassen ganz die fruͤher angegebene
Wirkung Statt. Wegen der Erweiterung der Scheidewand c
sind, wie man aus Fig. 4 sieht, mehrere Bindestangen durch dieselbe gefuͤhrt und mit
deren beiden Waͤnden durch Bolzen verbunden, um ihr dadurch mehr Festigkeit
zu geben.
Fig. 6 ist ein
Laͤngen-, Fig. 7 ein
Querdurchschnitt und Fig. 8 eine Endansicht einer anderen Modification unseres Locomotivofens.
Der Unterschied liegt hier lediglich in dem Baue der Scheidewand c, c die, wie man namentlich aus Fig. 9 sieht, aus einer
Reihe von Roͤhren, welche den vorderen oberen Theil der Feuerkammer mit deren
Ruͤken verbinden, zusammengesezt ist. Diese Roͤhren, durch welche das
Wasser frei stroͤmen kann, sind so gebildet, daß sie mit ihren oberen Enden
an einander liegen und hiedurch eine Scheidewand bilden, die die aus der
unentzuͤndeten oder zum Theile brennenden Steinkohle entwikelten
Daͤmpfe und Rauchmassen abhaͤlt und sie zwingt nach Abwarts gegen den
unteren Theil der Roststangen zu treten, um daselbst uͤber die lebhaft
brennende Steinkohle zu streichen und hiedurch verbrannt zu werden, so daß sich
keine dunklen schwarzen Rauchwolken entwikeln koͤnnen.
In Fig. 10
sieht man eine weitere Modification unseres Locomotivofens im Laͤngen-
und in Fig.
11 im Querdurchschnitte abgebildet. Hier ist, wie durch Punkte angedeutet
ist, der ganze obere Theil der Feuerkammer gewoͤlbt, um auf diese Weise eine
Art von Scheidewand c zu erzeugen, welche den auf dem
oberen Theile der Roststangen entwikelten Dunst und Rauch nach Unten ableitet, wo er
bei der daselbst Statt findenden lebhaften Verbrennung verzehrt wird. Da zur
Bezeichnung der einzelnen Theile die fruͤher gewaͤhlten Buchstaben
beibehalten sind, so bedarf es keiner weiteren Beschreibung dieses Ofens, von dem
Fig. 11
eine perspectivische Ansicht gibt.
Fig. 13 zeigt
abermals eine Modifikation desselben Ofens im Laͤngen-, und Fig. 14 im
Querdurchschnitte. Da dieser Ofen mit Steinkohlen und Kohks gespeist werden kann, so
sind an dem oberen Theile der Feuerkammer zwei mit Thuͤren versehene
Oeffnungen angebracht, von denen die eine zum Eintragen von Steinkohle, die andere
hingegen zum Eintragen von Kohks bestimmt ist. Zum Behufe des Eintragens der
Steinkohle bringe Ich in diesen Thuͤren der Quere nach zwei oder mehrere
kleine Trichter an, damit die Kohlen nicht eine einzige Masse bilden, wie es bei der
Anwendung eines einzigen Trichters der Fall seyn wuͤrde, sondern damit sie
mehrere von einander gleichsam unabhaͤngige Massen ausmachen. Einen dieser
kleinen Trichter sieht man bei f, f, und zwar in einer
geringeren Neigung angebracht, als die Roststangen a
haben. Die in diese Trichter geschaffte Kohle rutscht hinab, und druͤkt auf
das unterhalb befindliche Brennmaterial, so daß in dem Maaße als die am weitesten
unten befindlichen Kohle verbrennt, die obere immer nachruͤkt. Der untere
Theil der Roststangen wird hienach bestaͤndig mit einem in hoͤchster Gluth
begriffenen Brennstoffe gespeist. Damit dieß auch sicher geschehe, und damit,
ungeachtet hier die Scheidewand c fehlt, dennoch der aus
der Steinkohle entwikelte Rauch zum Theil verzehrt werde, wird der untere Theil des
Feuers weilenweise mit Kohks gespeist.
An allen den bisher beschriebenen und abgebildeten Arten von Oefen bemerkt man unter
den schraͤg laufenden Roststangen a, a noch einen
Rost g. Auf diesem lezteren soll sich die durch erstere
fallende Nachgluth ansammeln und dadurch ein kleines Feuer bilden, welches zur
Erhizung der Luft, die gegen den oberen Theil der schraͤgen Roststanzen a, a emporsteigt, so wie auch zur Erhizung und
theilweisen Entzuͤndung der auf diesen befindlichen Steinkohlen dient. Die
Nachgluth, die sonst großen Theils verloren geht, bekommt also hier eine sehr
nuzvolle Verwendung; denn das durch sie auf dem Roste g
gebildete Feuer laͤßt nur heiße Daͤmpfe und heiße Luft an die frisch
eingetragene Kohle gelangen, wodurch die Bildung von dikem schwarzen Rauche
wesentlich vermindert wird. Zu demselben Zweke wenden wir in Verbindung mit den
schraͤgen Roststangen a, a anstatt des Rostes g zuweilen eine aus feuerfesten Baksteinen oder irgend
einem anderen entsprechenden Materiale bestehende Schraͤgflache h an, wie dieß aus Fig. 16 erhellt. Bei
dieser Einrichtung wird die Schraͤgflaͤche h durch das auf dem Roste a, a brennende Feuer
dermaßen erhizt, daß alle atmosphaͤrische Luft, welche an den oberen Theil
der Roststangen a, a und an das auf diesen liegende
frische Brennmaterial emporsteigt, in hohem Grade erhizt wird. Denn immer wird man
finden, daß bei der Einrichtung der von uns verbesserten Oefen das Streben
hauptsaͤchlich dahin ging, die frisch eingetragene Steinkohle so zu
behandeln, daß sie so wenig diken schwarzen Rauch als moͤglich
ausstoͤßt. Daß dieß geschieht, wenn man stark erhizte Luft durch den oberen
Theil der Roststangen a, a stroͤmen laͤßt,
waͤhrend sich auf deren unterem Theile lebhaft brennendes Brennmaterial
befindet, welches durch den Zufluß von Luft, die den gewoͤhnlichen
Temperaturgrad hat, nicht beeintraͤchtigt wird, erhellt von selbst.
Eine andere zu demselben Zweke fuͤhrende Anordnung ersieht man aus Fig. 15 und
16, wo
auch eine kleine Aenderung in Hinsicht auf die Scheidewand c getroffen ist. Hier laufen naͤmlich die Roststangen an dem oberen
Ende eine kurze Streke weit horizontal oder beinahe horizontal, damit nicht alles
auf den Rost gebrachte Brennmaterial auf ihm hinab zu rutschen trachtet; sondern
damit stets ein Theil davon auf diesem oberen horizontalen Theile
zuruͤkbleibe. Dieses leztere Brennmaterial wird naͤmlich dann auf
diesem horizontalen Theile in lebhafte Gluth kommen, und die durch die Roststangen a, a emporsteigende Luft stark erhizen, so daß sie nur
in diesem Zustande an die frisch eingetragene Kohle gelangen kann.
Fig. 17 zeigt
einen unserer verbesserten Oefen, woran sich die Roststangen a, a in senkrechter oder beinahe senkrechter Stellung befinden. Denselben
Ofen sieht man in Fig. 18 im Querdurchschnitte. i ist ein
kreisrunder Wasserbehaͤlter, der die beiden Seiten der Feuerkammer
miteinander verbindet, und der also die freie Stroͤmung des Wassers
gestattet. Dieser Behaͤlter i steht mit der
Scheidewand c, die hier auf die oben beschriebene Weise
zur Verhuͤtung des Entweichens von dikem unverbranntem Rauchqualme dient,
durch eine Reihe von Roͤhren j, zwischen denen
die erhizten Duͤnste von dem Feuer in den Schornstein gelangen, in
Verbindung. Diese Scheidewand c kann entweder, wie man
in Fig. 19
sieht, direct von dem oberen Theile der Feuerkammer herabsteigen; oder man kann sie
durch eine Reihe von Roͤhren k, k, zwischen denen
alle durch die Roststangen a, a emporsteigende Luft mit
allein Dunst und Rauch durch das unterhalb befindliche stark erhizte Brennmaterial
hinab gelangen kann, damit in Verbindung bringen. Das innen mit feuerfesten
Baksteinen gefuͤtterte Thuͤrchen l dient
zur Entfernung der Asche, welche zwischen den als Roststangen dienenden
Roͤhren j hindurch faͤllt. Die Speisung
des Feuers geschieht von Oben. Bemerken muͤssen wir, daß wir sowohl an diesem
Ofen, als an allen uͤbrigen angegebenen Ofenarten die Roststangen
vorzugsweise von Roͤhren, welche die beiden Seiten der Feuerkammer
miteinander verbinden, tragen lassen, damit auf diese Weise von einer Seite zur
anderen Wassercanaͤle fuͤhren.
Fig. 20 und
21 geben
einen Langen- und Querdurchschnitt und Fig. 22 eine
perspektivische Ansicht eines zum Brennen von Steinkohle und Kohks eingerichteten
Ofens, der sich von dem unter Fig. 1 beschriebenen
hauptsaͤchlich dadurch unterscheidet, daß er zwei Scheidewaͤnde c, c hat, von denen die eine zur Bildung einer Kammer
fuͤr die Steinkohle und die andere zur Bildung einer solchen fuͤr die
Kohls bestimmt ist. Bei dieser Einrichtung wird das Entweichen des Rauches und
Dunstes in Gestalt eines schwarzen diken Rauches noch sicherer verhuͤtet. Da
im Uebrigen dieselben Buchstaben zur Bezeichnung der einzelnen Theile beibehalten
sind, so mag diese kurze Andeutung genuͤgen.
Fig. 23 und
24 sind
Laͤngendurchschnitte zweier Kesseloͤfen fuͤr stritte
Dampfmaschinen, an denen gleichfalls wegen Beibehaltung der fruͤheren
Bezeichnungen eine kurze Beschreibung genuͤgen wird. Aus einem Blike auf Fig. 23 sieht
man, daß uͤber dem schraͤg gestellten Feuerherde a, a eine Wasserdeke angebracht ist, welche den aus der frischen Kohle
aufsteigenden Rauch nach Abwarts zuruͤkdraͤngt, damit er sich mit den
heißen Duͤnsten des in lebhafter Verbrennung begriffenen Brennstoffes
vermenge. Diese Wasserdeke laͤßt sich entweder dadurch erzielen, daß man dem
Boden des Kessels eine gehoͤrige Woͤlbung gibt, oder auch dadurch, daß
matt zu diesem Behufs ein eigenes Anhaͤngsel anbringt, wie dieß in der
Abbildung durch punktirte Linien angedeutet ist. In Fig. 24 ist zur Erzielung
desselben Zwekes eine aus feuerfesten Baksteinen gemauerte Deke angebracht. Man
sieht, daß die Roststangen an beiden Oefen unter einem ziemlich spizen Winkel
gestellt sind, damit das Brennmaterial bestaͤndig und in dem Maaße auf ihnen
hinab gleite, als es unten verbrennt. Bei der Anwendung von Kohlen, die eine sehr
große Neigung zum Zusammenbaken haben, kann und muß man einen noch spizigeren Winkel
waͤhlen; dagegen kann er, wenn man mit trokener Kohle zu thun hat, stumpfer
seyn. Unter 35° darf jedoch der Winkel nicht haben, wenn man des
gehoͤrigen Hinabgleitens des Brennmaterials sicher seyn will.
In Fig. 25
steht man eine Befestigungsweise der Feuerkammer oder des Ofens eines
Locomotivkessels. n ist ein an dem Kessel befestigter,
im Winkel aufgebogener Ring; und m ein
aͤhnlicher, aber an dem Ofen festgemachter Ring, der das Ende des Kessels
aufzunehmen im Stande ist, so daß die beiden Ringe an einander zu liegen kommen, und
wenn sie nach entzwischen gelegter Fuͤtterung mit Schrauben und
Schraubenmuttern verbunden worden, sind, ein wasserdichtes Gefuͤge bilden.
Man sieht diesen Kessel in Fig. 26 auch noch in
einem Querdurchschnitte abgebildet, waͤhrend Fig. 27 eine. Ansicht
desselben von Außen gibt.
Aus Fig. 10
erhellt ein anderer Theil unserer Erfindung, der in der Anwendung mehrerer kleiner,
mit den schraͤgen Roststangen in Verbindung gebrachten Kruͤken
besteht. Mit diesen Kruͤken wird, in dem sie nach und nach in dem Ofen
vorwaͤrts geschoben werden, das ihnen gegenuͤber liegende
Brennmaterial fortgeschoben, damit es nicht an die Roststangen anbaken kann. Da man
schon fruͤher eine aͤhnliche Vorrichtung in Anwendung brachte, so
machen wir in dieser Hinsicht jedoch nur auf die Verbindung dieser Kruͤken
mit den schraͤgen Roststangen. Anspruch.
Schließlich bemerken wir noch, daß unsere Patentanspruͤche keinen der
einzelnen Theile, in so fern sie schon fruͤher in Anwendung kamen, betreffen;
und daß wir uns alle Modificationen der Form und Verbindung vorbehalten, in so fern
sie ohne Abweichung von dem Principe thunlich sind.
Tafeln