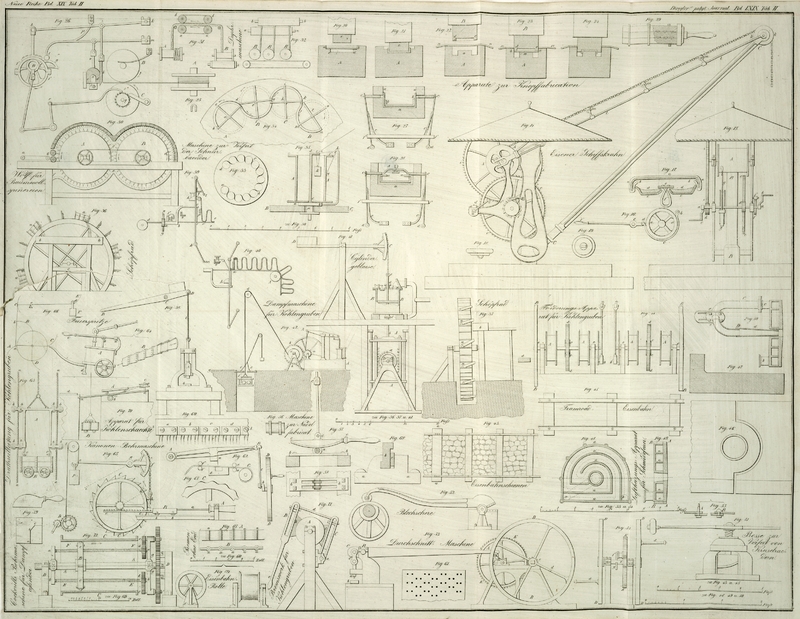| Titel: | Technische Notizen, auf einer Reise durch Belgien und Westphalen gesammelt von Dr. Adolph Poppe. |
| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |
| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XI., S. 18 |
| Download: | XML |
XI.
Technische Notizen, auf einer Reise durch Belgien
und Westphalen gesammelt von Dr. Adolph Poppe.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
(Fortsezung von Bd. LXVIII. H. 5, S.
347.)
Adolph Poppe's Notizen aus dem Gebiete der Mechanik.
Der eiserne Schiffskrahn.
Seit einigen Jahren kommt der gußeiserne Schiffskrahn an
den Stapelplaͤzen des Rheins und Mains immer mehr in Gebrauch und
verdraͤngt allmaͤhlich jene unbehuͤlflichen, Raum einnehmenden
Tretradkrahne. An den Kais von Koͤln sah ich drei eiserne Krahne, in
Duͤsseldorf zwei und in Frankfurt einen in Thaͤtigkeit; sie kommen aus
den Maschinenwerkstaͤtten und Gießereien von Muͤhlheim an der Ruhr und
Starkde, sind sehr solide, nehmen
einen geringen Raum in Anspruch, und werden in der Regel von 4 Mann bedient, wovon 2
Mann die eigentliche Operation des Hebens verrichten, waͤhrend die 2 anderen
das Wenden des Krahnes, das Losmachen der Lasten, das Bremsen u.s.w. besorgen
muͤssen.
Fig. 14
enthaͤlt die Darstellung dieses Krahnes, so wie ich ihn selbst an Ort und
Stelle mit Huͤlfe des Maaßstabes aufgenommen habe, im Profile, Fig. 15, in
der vorderen Ansicht; die Dimensionen sind an dem beigefuͤgten Maaßstabe
abzunehmen. Der ganze Mechanismus besteht aus einer Aufzugstrommel oder Haspelwelle,
zwei Stirnraͤdern, zwei Getrieben, einem Sperrrad, einem Bremswerk und zwei Kurbeln, alles aus Eisen, Die Achse
a, a, von welcher die Bewegung ausgeht,
enthaͤlt zwei Kurbeln a, b und a, c von 14 Zoll Halbmesser und ein Getriebe d von 24 Zaͤhnen, welches in das Stirnrad e, e von 108 Zaͤhnen greift. Die Achse des
lezteren Rades traͤgt ein Sperrrad f, einen
Bremskranz g, g von 2 Fuß Durchmesser, und noch ein
Getriebe h von 24 Zaͤhnen. Das Sperrrad mit
seinem eingreifenden Haken gestattet den Arbeitern waͤhrend des Aufwindens
nach Erforderniß kurze Ruhepausen zu machen, und sichert sie vor aller Gefahr,
welche aus einem momentanen Nachlassen der Kraͤfte hervorgehen
koͤnnte. Der Zwek der Bremsung g, g ist: beim
Herablassen der Lasten die Geschwindigkeit durch erhoͤhte Reibung zu
maͤßigen und der gefaͤhrlichen Beschleunigung vorzubeugen. Fig. 16
enthaͤlt das einfache Bremswerk abgesondert im Durchschnitte dargestellt.
Drei Viertheile der Peripherie des Bremsrades a, a sind
von einem eisernen Bande b, c, d umgeben, welches
einerseits im Punkte b, andererseits an das Ende d des 4 Fuß langen Hebels f, e,
d, dessen Umdrehungsachse in e liegt, befestigt
ist. Es ist dadurch klar, daß, wenn der Handgriff f des
Bremshebels niedergedruͤkt wird, das eiserne Band b, c, d sich an
den Umfang des Bremskranzes a, a anschließen muß, woraus
eine hinreichende Friction hervorgeht, um die Bewegung mit geringem Kraftaufwande in
jedem erforderlichen Grade maͤßigen zu koͤnnen. Das Getriebe h greift in ein zweites Stirnrad i, i von 108 Zaͤhnen, dessen Achse endlich die Kettenwelle A, A. traͤgt. Um zu verhindern, daß die Kette
sich auf sich selbst aufwikle, oder uͤberhaupt sich beruͤhre und
reibe, laͤuft rings um die Aufzugswelle eine Rinne in
schraubenfoͤrmigen Windungen, in welche die Kette sich von selbst legt.
Der ganze Apparat ist durch ein flaches, rundes Dach aus Sturzblech vor dem Regen
geschuͤzt. B, B ist die starke, den ganzen Krahn
tragende, um sich selbst bewegliche Saͤule, deren Zapfenlager unter dem
steinernen Fundamente, worauf der Krahn steht, angebracht sind. C, C ist der gußeiserne, 18 bis 20 Fuß lange Schnabel
oder Traͤger; k, k die eiserne Rolle,
uͤber welche die Kette laͤuft. Außerdem gehen noch vom Dache des
Krahnes nach dem oberen Ende des Schnabels zwei eiserne Stangen l, l,
Fig. 14,
beinahe parallel, von denen nur eine sichtbar ist, indem die andere durch dieselbe
gedekt wird. Diese Stangen geben dem Schnabel C, C mehr
Haltbarkeit, und dienen zugleich dazu, die Kettenleitungsrollen m, m, m zu tragen.
Die Kraftleistung des vorliegenden Krahnes laͤßt sich aus den Dimensionen und
der Verzahnung des Raͤderwerkes leicht berechnen. Die Zaͤhneanzahl der
Getriebe verhaͤlt sich zu derjenigen der Stirnraͤder wie 1 : 6, ferner
der Durchmesser der Trommel A zum Durchmesser des
Stirnrades i, i, wie 1 Fuß 8 Zoll zu 5 Fuß, oder wie 1 :
3, der Halbmesser des Getriebes d zu demjenigen der
Kurbel, wie 1 : 5; daraus folgt, daß fuͤr den Zustand des Gleichgewichtes die
am Umfange der Trommel widerstehende Last 90 Mal so groß seyn darf, als die an den
Kurbeln wirkende Kraft. Da nun die mittlere Kraft eines fortwaͤhrend an einer
Kurbel thaͤtigen Mannes zu 25 Pfd. angenommen wird, so koͤnnten jene
zwei Maͤnner bei mittlerer Tagesarbeit 50–90 Pfd. oder 45 Cntr.
ununterbrochen heben. Weil aber die Arbeiter waͤhrend des Losmachens der
Lasten, des Niederlassens der Kette und der Wendugen des Krahnes Zeit haben
auszuruhen und Kraͤfte zu sammeln, so darf in dem vorliegenden Falle ihr
Vermoͤgen an der Kurbel hoͤher als zu 50 Pfd. zusammen, und das
mittlere Gewicht der gehobenen Last wenigstens zu 50 Cntr. angeschlagen werden. Ein
Mann, welcher auf einem der Ladungsplaͤze Koͤlns bei einem Krahne
arbeitete, gab auf mein Befragen die Auskunft, daß sie im Durchschnitte
taͤglich 2000 Cntr. 15 Fuß hoch heben.
C. Die Knopffabrik von Schwark im Kreise
Solingen.
Dieses von der Hauptindustrie Solingens (welche bekanntlich in der Fabrication aller
Gattungen Eisen- und Stahlwaaren besteht) ziemlich abgesondert dastehende
Etablissement liefert, als Hauptfabricat, mit Zeug und Tuch
uͤberzogene Knoͤpfe, welche auch wohl unter dem Namen Florentinerknoͤpfe bekannt sind, und als
Nebenartikel verschiedene Arten von Hornknoͤpfen, so wie auch
ordinaͤre Federmesser. Wenn man einen fertigen Zeugknopf betrachtet, so
sollte man nicht denken, daß dieses so einfach aussehende Ding eine Reihe
merkwuͤrdiger Operationen hat durchmachen muͤssen, ehe es in seiner
vollendeten Gestalt erschien. Bei naͤherer Untersuchung findet man aber, daß
ein solcher Knopf aus 6 Theilen besteht, von denen jeder einzelne auf einer
besonderen Maschine von theilweise sehr complicirter Natur verfertigt worden ist.
Die lezte Maschine vollendet den Knopf, indem sie die Stuͤke, aus welchen
derselbe besteht, zusammensezt. Fig. 17, Taf. II, zeigt
den mittleren vergroͤßerten Durchschnitt eines solchen Knopfes; Fig. 18 die
Seitenansicht, und Fig. 19 die untere Ansicht, beide in natuͤrlicher Groͤße.
Die erwaͤhnten 6 Bestandtheile sind der Reihe nach folgende: 1) die
Seidenzeug- oder Tuchscheibe a, a, a; 2) die
durch Schraffirung bezeichnete Blechscheibe b, b mit
schalenartig uͤbergebogenem Rande, uͤber welche die Zeugscheibe
gespannt ist; 3) die kleinere Blechscheibe c, c mit
gleichfalls umgebogenem Rande und einem centralen Loche, welche mit Gewalt in die
groͤßere Scheibe b, b hineingepreßt ist; 4) die
in der Mitte mit einem Loche versehene Pappscheibe d, d,
welche die Blechschale c, c ausfuͤllt; 5) das
kleine Blechscheibchen e; 6) das an lezteres befestigte
Oehr f.
Ich will die Fabrication dieser einzelnen Theile und ihre Zusammenfuͤgung in
systematischer Ordnung beschreiben.
I. Die kreisrunde Zeug- oder Tuchscheibe wird auf eine einfache, leichte und
schnelle Weise von einem Knaben verfertigt; dieser breitet naͤmlich den Stoff
uͤber einen Holzkloz, und schneidet mit einem ringfoͤrmigen Messer
durch Schlage, welche er mit dem Hammer auf das leztere fuͤhrt, die runden
Scheiben aus. Er kann 3000 Scheiben in einer Stunde liefern.
II. Die obere Scheibe b, b wird aus duͤnnem
Eisenbleche mittelst eines gewoͤhnlichen Durchschnittes ausgestoßen. Zur
Darstellung des Randes dient sodann eine zweite, Fig. 20 und 21 im
Durchschnitte dargestellte Vorrichtung eine Art Gesenke.
Die Blechscheibe a, b kommt uͤber eine
kreisrunde, in die metallene Unterlage A gearbeitete
Vertiefung c, d zu liegen. Auf diese Vertiefung ist der
staͤhlerne,
cylindrische Stempel e mit abgerundeter Kante gerichtet,
dessen Diameter aber wenigstens um die doppelte Dike des Bleches kleiner ist, wie
der Durchmesser der Hoͤhlung c, d. Wird nun der
Stempel e niedergedruͤkt, so preßt er die Scheibe
a, b in die Vertiefung c,
d hinab, wobei sich notwendiger Weise der Rand so umschlagen muß, wie Fig. 21
zeigt.
So wuͤnschenswert es auch scheint, das Durchschlagen der Scheibe und das
Umbiegen des Randes in eine einzige Operation zu vereinigen, so bemerkte ich doch
nirgends eine Maschine, welche diese Bedingung erfuͤllte. Wie indessen dieses
Problem durch eine einfache Vorrichtung geloͤst werden kann, erhellt aus den
im Durchschnitte gegebenen Fig. 22, 23 und 24. A, A, Fig. 22, ist die
metallene Unterlage mit einer Vertiefung, aus deren Boden ein Dorn oder Cylinder a mit abgestumpfter Kante nicht ganz bis an die
Oberflaͤche hervorragt; B ein scharfkantiger,
genau in die genannte Vertiefung passender Stempel. Der Boden dieses Stempels besizt
eine mit dem Dorn a correspondirende Hoͤhlung d, e, deren Durchmesser jedoch um die doppelte Blechdike
groͤßer ist, wie derjenige des Dornes; n, n
endlich ist die Blechplatte. Nach dieser kurzen Eroͤrterung stelle man sich
vor, der Stempel steige nieder; alsdann wird er, auf die duͤnne Blechplatte
stoßend, die Kreisscheibe b, c, Fig. 23, herausschneiden.
Diese kommt nun auf die obere Flaͤche des Dornes a zu liegen, aber in demselben Moment wird ihr Rand durch den Stempel,
welcher noch nicht seinen tiefsten Stand erreicht hat, schalenartig uͤber den
Dorn herabgeschlagen, wie Fig. 24 zeigt.
III. In das Innere der oberen Blechschale des Knopfes, deren Verfertigung so eben
beschrieben wurde, paßt die kleinere, schwarz gefirnißte Blechscheibe c, c, Fig. 17. Diese hat, wie
jene, einen uͤbergebogenen Rand, nur mit dem Unterschiede, daß dieser mehr
nach Außen geschweift ist, und außerdem noch in der Mitte ein kleines kreisrundes
koch mit schwach aufwaͤrts gebogenem Rande zum Durchfielen des
Knopfoͤhres. Das Ausschneiden der Scheibe und des in ihrer Mitte befindlichen
Loches wird gleichzeitig mittelst einer Durchschnittmaschine bewerkstelligt. Die Anordnung, wodurch sofort die
genannten Raͤnder gebildet werden, hat mit dem in Fig. 20 abgebildeten
Gesenke Aehnlichkeit, nur daß sich zur Darstellung des inneren Randes in der Mitte
der Hoͤhlung c, d eine kleine
kegelfoͤrmige Hervorragung befindet, und der Boden des Stempels e entsprechend vertieft ist.
IV. Die Scheibe c, c, Fig. 17, wird durch die
eine halbe Linke dike Pappscheibe
d, d ausgefuͤllt. Leztere hat in der Mitte ein
genau auf die Oeffnung der Scheibe c, c passendes Loch,
und wird. wie obige
Tuchscheibe, mit einem ringfoͤrmigen Messer ausgeschnitten, jedoch nicht aus
freier Hand, sondern mit Huͤlfe eines Durchschnittes. Das Loch in der Mitte
wird besonders ausgestochen. Auf dem Pappdekel d, d
liegt
V. das kleine, flache Blechscheibchen e, welches mit dem
Oehr f fest vernietet ist; es besizt zu diesem Behuf in
der Mitte ein Loch, und wird auf dieselbe Weise wie die unter Nr. III beschriebene
Blechscheibe c, c gebildet, nur daß die dortigen
Raͤnder fehlen. Durch die Oeffnungen der Blechschale c, c und des Pappdekels d, d ragt
VI. das Oehr, wodurch bekanntlich der Knopf an die Kleidung befestigt wird. Dieses
hufeisenfoͤrmig, wie Fig. 25, gestaltete Oehr
wird aus Eisendraht dargestellt, und zwar auf eine uͤberraschend schnelle
Weise durch eine sinnreiche, ziemlich complicirte Maschine, welche durch Umdrehung
einer Kurbel mit Leichtigkeit von einem Arbeiter in
Bewegung gesezt werden kann. Die Maschine erzeugt bei jeder Kurbeldrehung ein Oehr,
und ist daher im Stande, wenn 75 Umdrehungen auf die Minute gerechnet werden, bei
achtstuͤndiger Arbeit zu 36,000 Knoͤpfen die Oehre zu liefern. Wegen
dieser gewaltigen Productivitaͤt steht sie denn auch immer einen Theil der
Woche still. Von der Leichtigkeit und Sicherheit, womit die verschiedenartigsten,
zum Theil complicirten Bewegungen dieser Maschine einander folgen, so wie von der
Soliditaͤt ihrer Construction uͤberhaupt konnte ich mich durch
naͤheres Betrachten und durch eigenes Handanlegen uͤberzeugen. Der
Besizer der Fabrik, welcher mich selbst umherfuͤhrte, erlaubte mir, die
Maschine so schnell, als es moͤglich waͤre, umzudrehen; ich arbeitete
daher zwei Minuten lang mit aller Macht, und bereicherte die Fabrik in dieser kurzen
Zeit mit 240 Knopfoͤhren.
Die Skizze, Fig.
26, enthaͤlt die Darstellung der Haupttheile der Maschine. Die
Fabrication der Oehre theilt sich, wie man aus folgender Beschreibung ersehen wird,
in drei verschiedene Acte, welche waͤhrend der Dauer einer Kurbelumdrehung
vor sich gehen und daher sehr rasch auf einander folgen muͤssen. A ist die Rolle oder Scheibe, welche den Eisendraht
aufgespult enthaͤlt. Von dieser leitet man den Anfang des Drahtes zwischen
zwei staͤhlerne Walzen B und C, welche ihn maͤßig zwischen sich klemmen und
ruͤkweise vorwaͤrts unter die rinnenartige Woͤlbung a schieben. Die obere Walze B wird durch eine Feder gegen die untere angedruͤkt, damit sie den
Draht fest genug, jedoch ohne Zwang, paken koͤnnen. In dem Augenblike, wo der
Draht unter die Woͤlbung a vorgeschoben ist,
stehen beide Walzen still, das staͤhlerne Messer b steigt nieder und schneidet ein Drahtstuͤk c, d von gemessener Laͤnge ab; im naͤchsten Momente geht
gleichzeitig mit dem
Messer b ein unter dem Stuͤke c, d befindlicher Dorn e in
die Hoͤhe und drangt das leztere in die Hoͤhlung a, so daß es, wie in einer Form, die bezeichnete
hufeisenfoͤrmige Gestalt annimmt. Hat der Dorn seinen hoͤchsten Punkt
erreicht, so schnappt er in seine vorige Stellung e
wieder zuruͤk, waͤhrend gleichzeitig durch einen eigenen Mechanismus
das Oehr vom Dorne abgestreift wird n in die
untergestellte Schieblade faͤllt; im folgenden Momente kommen die Walzen B und C in Bewegung und
fuͤhren den Draht wieder unter die Woͤlbung a, worauf das Messer b den Draht
durchschneidet, und derselbe Prozeß in der so eben dargestellten Reihenfolge sich
wiederholt.
Die Bewegung geht von der mit einem Schwungrads und einer Kurbel versehenen
horizontalen Achse D aus. Mehrere an derselben sizende
Excentrica und Daͤumlinge veranlassen die verschiedenen wechselnden
Bewegungen der Maschinenteile. Die auf- und niederspielende Bewegung des
Messers b wird von dem Excentricum f, f eingeleitet, welches auf den Hebel h, i, k, dessen Umdrehungsachse in k liegt, wirkt. Der Dorn s
wird durch den Daͤumling g zum Emporsteigen
gebracht; dieser hebt naͤmlich den um den Punkt m
drehbaren Hebel l, m, mit welchem die Stange o, woran der Dorn festsizt, verbunden ist. Das
Zuruͤkschnappen des Dornes nach Erreichung seines hoͤchsten Standes
erlangt man durch die Feder p, welche, sobald der
Daͤumling g ausgehoben hat, frei auf den Hebel
l, m zu wirken anfaͤngt. Die Stellung der
excentrischen Scheiben, Daͤumlinge u.s.w. ist so regulirt, daß die Bewegungen
der lezterwaͤhnten Instrumente in den gehoͤrigen Zeitraͤumen
auf einander folgen. Die in einzelnen Absaͤzen erfolgende Drehung des
Walzenpaares B, C wird auf eine einfache Weise dadurch
erreicht, daß eine von der Hauptachse D
abhaͤngige Ziehstange r, s bei jeder
Kurbeldrehung das mit der Walze C fest verbundene
Sperrrad q um einen gewissen Bogen dreht.
VII. Das fertige Oehr wird durch eine Schlagmaschine in die Oeffnung des
Blechscheibchens e, Fig. 17, festgeschlagen.
Der Haupttheil der Maschine, welche von einem Knaben mit Haͤnden und
Fuͤßen bedient wird, ist ein 5 bis 6 Pfd. schwerer, um eine Achse beweglicher
Hammer, welcher mittelst eines unter dem Tischgestell angebrachten Fußtrittes
gehoben wird und sich in einer gewissen Hoͤhe von selbst auf einen Vorsprung
legt. Dieser leztere ist nichts anders als ein schraͤger, aufwaͤrts
gerichteter Zahn, welcher an einer zur Seite angebrachten, um einen Zapfen
beweglichen Stange festsizt. Wenn der in die Hoͤhe gehende Hammer an den Zahn
kommt, so draͤngt er ihn zuruͤk; so bald er aber daruͤber
hinweg ist, schnappt der
Zahn ein, weil die Stange durch eine Feder gegen den Hammerstiel gedruͤkt
wird, und der Hammer bleibt auf demselben liegen. Eine breite, mehrere Male um sich
selbst gewundene Feder druͤkt kraͤftig auf den Hammer, und ist daher,
weil der Hammer gehoben wurde, in sehr gespanntem Zustande. Der Knabe stekt das Oehr
in das Loch der kleinen Blechscheibe, und legt diese dergestalt auf einen kleinen
Ambos, daß das Oehr in eine daselbst angebrachte Vertiefung zu liegen kommt. Darauf
zieht der Bursche mittelst eines zweiten Tretschaͤmels den Vorsprung, welcher
das Niederfallen des Hammers verhinderte, zuruͤk, der Hammer loͤst
sich aus, wird mit großer Gewalt durch die Feder auf den Ambos herabgeschnellt, und
verbindet durch den heftigen Schlag das Oehr mit der kleinen Scheibe aufs
festeste.
VIII. Nun sind alle einzelne Theile, aus denen der Knopf besteht, so weit fertig, daß
sie nur noch in der gehoͤrigen Ordnung zusammengesezt und fest mit einander
zum Ganzen verbunden zu werden brauchen. Hiezu dient wieder ein sehr sinnreicher
Apparat, dessen Wirkung aus den im Durchschnitte dargestellten Skizzen, Fig. 27 und
28, zu
entnehmen ist. Er besteht aus zwei Theilen, naͤmlich einer Vorrichtung,
welche die Raͤnder der Zeugscheibe a, a, a,
Fig. 17,
einsammelt, und um die Blechschale b, b schlaͤgt,
und aus einer einfachen Stempelpresse, welche die uͤbrigen Theile des Knopfes
in die Scheibe b, b hineinpreßt. Fig. 27 zeigt die
Blechschale b, b mit ihrem Ueberzuge a, a, a in die Vertiefung der metallenen Unterlage,
uͤber welcher der hier nicht angezeigte Stempel sich befindet,
hineingedruͤkt. Die Raͤnder der Zeugscheibe, welche rings um die
Blechschale senkrecht in die Hoͤhe stehen, muͤssen von allen Seiten
zugleich zusammengefaßt und nach Innen umgeschlagen werden, wenn sie durch die
uͤbrigen Theile des Knopfes in das Innere der Schale b, b eingeklemmt werden sollen. Dieß erreicht man durch folgenden
scharfsinnigen Mechanismus. Die Zeugscheibe ist in der bezeichneten Lage rings von
einem Systeme sehr duͤnner Stahlsegmente c, c
umgeben, die so angeordnet sind, daß sie eine kreisrunde Oeffnung einschließen, in
welcher die Blechschale mit ihrem Ueberzuge liegt. Diese Oeffnung laͤßt sich,
ohne ihre Rundung zu verlieren, dadurch verengern, daß die erwaͤhnten
Stahlsegmente, deren Kanten uͤber einander liegen, gleichzeitig gegen das
Centrum hin geschoben werden. Das Resultat dieser Operation laͤßt sich leicht
voraussehen. Die nach dem Mittelpunkte hin bewegten Stahlplatten ergreifen
naͤmlich die Kanten der Zeugscheibe, und biegen sie, wie Fig. 28 zeigt, nach Innen
um. Nun wird der andere Theil A des Knopfes, welcher aus
der zweiten Blechschale, dem Pappdekel und dem Oehre besteht, durch die Kraft des Stempels in das
Innere der Schale b, b hineingetrieben, wobei er
begreiflicher Weise die Kanten des Ueberzuges a, a, a
mit einklemmen muß. Der Knopf erscheint nach dieser Operation in der Fig. 17 im Durchschnitt
dargestellten, beinahe vollendeten, Gestalt.
Es eruͤbrigt nun noch anzugeben, auf welche Weise man das gleichzeitige
concentrische Zusammenruͤken jener duͤnnen Stahlplatten c erreicht. Jede der lezteren ist mit einem um den Punkt
d beweglichen Hebel c, d
verbunden, welchen eine Feder e auswaͤrts zu
druͤken strebt. Saͤmmtliche Hebel c, d
werden von einem gemeinschaftlichen verschiebbaren Ring f,
f umfaßt. So lange dieser Ring seine tiefste Stelle einnimmt, halten die
Hebel c, d, dem Druke der Federn nachgebend, die
Stahlplatten von der Zeugscheibe entfernt, wie Fig. 27 zeigt; wenn aber
der Ring aufwaͤrts geschoben wird, so naͤhern sich die Metallsegmente
der Zeugscheibe, fassen ihre Raͤnder und biegen sie in die in Fig. 28 gezeichnete
Lage.
Zwei Maͤdchen versehen die so eben beschriebenen, mit der Zusammensezung des
Knopfes verbundenen Arbeiten. Das eine legt die verschiedenen Theile zusammen, das
andere besorgt das Ueberziehen des Knopfes, und stempelt ihn fest.
Außer diesen kleineren Apparaten zum Ueberziehen und Zusammensezen der
Knoͤpfe, besizt Herr Schwark noch eine
groͤßere, ziemlich complicirte Maschine, welche 9 Knoͤpfe zugleich
fertig macht. Sie kostete 1200 Thaler, und liefert nach des Besizers Angabe in einem
Tage 17,280 Knoͤpfe. Der Umstand, daß diese Maschine selten im Gang ist, und
daß uͤberhaupt außer ihr eine Menge jener einfachen Handapparate im Gebrauch
sind, obgleich sie allein die ganze Fabrik mit uͤberzogenen Knoͤpfen
versehen koͤnnte, spricht nicht zu ihren Gunsten. Sie erfordert sechs
Personen zu ihrer Bedienung, naͤmlich fuͤnf Kinder und einen Mann. Die
Kinder, im Halbkreis um die Maschine postirt, legen die Theile des Knopfes in der
gehoͤrigen Ordnung auf einander und bieten jedesmal 9 Knoͤpfe in einer
mit eben so vielen runden Vertiefungen, versehenen Platte dem Arbeiter dar, welcher
sie sofort unter die von ihm selbst mittelst eines Tretschaͤmels in Bewegung
gesezte Maschine bringt.
IX. Ich bemerkte unter Nr. VIII, daß der Knopf, so wie er in Fig. 17 im Durchschnitt
dargestellt ist, noch nicht vollendet sey. Es ließe sich naͤmlich, wenn man
das Oehr fest paken wuͤrde, die Schale c, c sammt
ihrem Inhalte aus der Schale b, b herausziehen, was
nicht seyn darf. Es muß daher zum Beschluͤsse der Rand der Schale b, b, welcher rechtwinklich vom Boden derselben absteht,
nach Innen gebogen werden. Man bringt den Knopf nochmals in eine Versenkung, das Oehr nach Oben
gekehrt, und laͤßt einen schweren Stempel mit concaver Unterflaͤche
darauf fallen. Wie durch diese Concavitaͤt das Einwaͤrtsbiegen des
erwaͤhnten Randes erfolgen muß, laͤßt sich leicht vorstellen.
Als Nebenartikel liefert dieselbe Fabrik hornene, mit
allerlei Dessins versehene Knoͤpfe, so wie auch sehr wohlfeile Federmesser,
das Duzend zu 10 Silbergroschen. Um die hornenen Knoͤpfe zu praͤgen,
legt man die Hornstuͤke mit den Oehren in staͤhlerne Formen, welche
das gravirte Dessin enthalten; drei Metallplatten fassen zwei lagen Knoͤpfe
zwischen sich und werden durch eiserne Baͤnder zusammengehalten, wie Fig. 29 zeigt.
So wird das Ganze auf einem Herde erwaͤrmt und sodann dem Druke einer
kraͤftigen Schraubenpresse ausgesezt. Nachher werden die Knoͤpfe nur
noch abgedreht und zulezt gefaͤrbt.
Der Fabrikinhaber bemerkte, daß diese Hornknoͤpfe, welche noch vor wenigen
Jahren einen reißenden Absaz fanden, zu seinem Bedauern immer mehr aus der Mode
kommen, und daß er bei seinem Vorrath an Formen durch diesen schnellen Wechsel der
Mode einen nicht unbedeutenden Verlust erleiden muͤsse.
D. Einige technische Notizen aus Elberfeld und
Barmen.
Zwei eigenthuͤmliche Maschinen in einer
Baumwollspinnerei, Schnuͤrbandfabrik, Reitpeitschenfabrik,
Schoͤpfraͤder.
Die Industrie der Staͤdte Elberfeld und Barmen umfaßt als Hauptgewerbzweig die
Seidenmanufacturen, ferner mehrere Baumwollspinnereien und mechanische
Webereien, Kattundrukereien, Teppichfabriken, Bandwebereien,
Schnuͤrband- und Reitpeitschenfabriken, einige
Schwefelsaͤurefabriken u.s.w. Dem Mangel an Empfehlungsbriefen hieher,
ohne welche der Reisende uͤberhaupt auf manches Sehenswerthe verzichten
muß, habe ich es zuzuschreiben, daß ich diese Fabrikstaͤdte, welche eine
Fuͤlle technisch interessanter Gegenstaͤnde in sich schließen,
nach kurzem Aufenthalte, nicht in hohem Grade befriedigt, verließ. Das
Bemerkenswerthe, was sich bei dem Besuche mehrerer Fabriken mir dargeboten hat,
will ich indessen hier mittheilen.
Baumwollenspinnerei.
In einer bedeutenden, durch Dampfkraft betriebenen Baumwollenspinnerei in
Elberfeld, fiel mir ein Wolf oder Teufel mit einer Einrichtung, wie ich sie zum ersten Male sah, auf. Die
Maschine besteht naͤmlich, statt wie gewoͤhnlich aus einer, hier
aus zwei mit eisernen spizigen Zaͤhnen besezten Trommeln
A und B
Fig. 30,
welche nicht etwa gegeneinander, sondern nach einerlei Richtung umlaufen, und so
nahe aneinander gestellt sind, daß die Zahne der einen Trommel zwischen
denjenigen der andern hindurchstreifen. So wird die Baumwolle auf folgende Weise
genoͤthigt, den durch die punktirte Linie angezeigten Weg zu machen. Von
dem Zufuͤhrtuch a, b gelangt sie
naͤmlich zwischen zwei Riffelwalzen, welche sie den Zaͤhnen der
umlaufenden Trommel A darbieten; diese reißen die
Baumwolle bis zu der Stelle c mit sich fort, hier
aber wird sie von den Zaͤhnen der Trommel B
gepakt und nach d hin bis zum Punkte e fortgefuͤhrt. In diesem Punkte aber
entreißen die Zaͤhne der Trommel A die
Baumwolle wieder den Zaͤhnen der Trommel B
und werfen sie sofort wohl zerzaust und aufgelokert zur Oeffnung e hinaus. Da der Weg, welchen die Baumwolle auf
diese Weise zuruͤklegen muß, doppelt so groß ist, als bei der
gewoͤhnlichen Einrichtung, so wird sie natuͤrlich hier in einer Operation eben so zerzaust und bearbeitet, als
wenn sie zweimal hinter einander dem sonst gebraͤuchlichen Wolfe
uͤbergeben worden waͤre.
Eine andere, mir bisher unbekannte, eigenthuͤmliche Maschine, welche ich
in dieser Fabrik arbeiten sah, ist ihrem Principe nach Fig. 31 von der Seite
und Fig.
32 von Vornen dargestellt. Auf diese Maschine kommt das Baumwollenband
von der Duplirmaschine, ehe es auf die Vorspinnmaschine uͤbergeht. Die
gestrekten Baͤnder gelangen von den Spulen A
Fig. 31
zwischen zwei breite endlose Lederbaͤnder, welche um die Walzen a,a, b,b geschlagen sind, und nach der Richtung der
Pfeile sich drehend, das Band fortfuͤhren. Die Bewegung der endlosen
Baͤnder ist indessen zusammengesezt; die Walzen, um welche sie geschlagen
sind, schieben sich naͤmlich mit Huͤlfe eines sinnreichen
Mechanismus, waͤhrend sie um ihre Achsen rotiren, zugleich der
Laͤnge der lezteren nach uͤbereinander hin und her, wie Fig. 32
zeigt. Dadurch erreicht man nichts anderes, als daß die Fasern der Baumwolle,
ohne eine wirkliche Drehung zu erleiden, inniger mit einander verbunden und
parallel gelegt werden. Der Faden erhaͤlt zwar durch die Verschiebung der
Walzen nach der einen Seite eine Drehung, diese wird aber durch die Verschiebung
nach der entgegengesezten Richtung sogleich wieder aufgelost; das Resultat
dieses Prozesses ist eine groͤßere Verdichtung des Baumwollenfadens. Die
Spulen B,B,B, welche auf einem Riemen ohne Ende
liegen, und vermoͤge der Friction sich umdrehen, nehmen die
Baumwollenbaͤnder auf.
Schnuͤrband- und
Reitpeitschen-Fabrik.
Ganz eigentuͤmlicher, man darf wohl sagen, origineller Art, sind die
Maschinen, auf welchen die schmalen, zu allerlei Kleidungsstuͤken
dienlichen, Schnuͤrbaͤnder verfertigt
werden. Bei der Unwichtigkeit dieses Fabrikates, und der enormen
Productivitaͤt der dazu verwendeten Maschinen sollte man kaum glauben,
daß auch in diesem so unscheinbaren Industriezweige doch noch so viele Menschen
Beschaͤftigung und Brod finden koͤnnen. In Barmen, wo die Schnuͤrbandfabrication im Flor ist, kann man
sich von der bedeutenden Consumtion dieses Artikels uͤberzeugen. Das
Schnuͤrband wird nicht gewoben, sondern geflochten. Eine Maschine ist
gewoͤhnlich fuͤr sechs, zehn oder mehrere Gange, von denen jeder
ein Band liefert, eingerichtet, und wird von einem Individuum durch Treten mit
den Fuͤßen in Bewegung gesezt. Man denke sich, je nach der Anzahl der
Gaͤnge, sechs, zehn oder mehrere horizontale runde eiserne Scheiben, von
etwa 1 1/2 Fuß Durchmesser auf einem großen runden Tische vertheilt. Nahe am
Rande jeder Scheibe laufen, wie Fig. 33 zeigt,
beinahe rings herum zwei schlangenfoͤrmige Einschnitte, welche sich an
vielen Punkten durchkreuzen, an beiden Enden aber in einander uͤbergehen.
In diesen Einschnitten stehen zwanzig oder mehr Baumwollengarn enthaltende
Spulen, welche alle ihre Faͤden strahlenfoͤrmig in einem Punkte einige Fuß uͤber dem Centrum der
Scheibe vereinigen. Dieses ist der Punkt, in welchem sich mit zauberhafter
Schnelligkeit das Geflechte bildet. Sobald naͤmlich die Maschine in
Thaͤtigkeit gesezt wird, beginnen die Spulen einen hoͤchst
ergoͤzlichen Tanz; sie laufen in Schlangenlinien auf der Scheibe mit
großer Eilfertigkeit um einander herum, und zwar bewegt sich die Haͤlfte
nach der einen Richtung von a uͤber b und c nach d, die andere Haͤlfte nach der
entgegengesezten Richtung von d uͤber c und b nach a, wobei sie jedesmal an den Punkten a und d umkehren. Dieses
ohne alles Anstoßen, aber mit ohrenzerreißendem Laͤrm erfolgende
Umeinanderlaufen der Spulen hat die Kreuzung der Faden und die Bildung des
Geflechtes zur Folge. Durch Gewichte wird das Schnuͤrband in dem Maaße,
als es waͤchst, emporgezogen. Der Mechanismus, welcher diese
ungewoͤhnlichen, excentrischen und kunstvollen Bewegungen der Spulen
erzeugt, ist durch seine klug ausgedachte Anordnung und nicht minder durch seine
ausgezeichnete Einfachheit so interessant, daß eine kurzgefaßte
Erklaͤrung desselben mit Huͤlfe der Fig. 34 nicht
uͤberfluͤssig seyn duͤrfte.
Fig. 34
stellt einen Theil der erwaͤhnten Spulenscheibe, von unten betrachtet,
dar; der groͤßeren Deutlichkeit wegen ist nur einer der beiden
schlangenfoͤrmigen Einschnitte ausgefuͤhrt, der andere aber bloß durch punktirte
Linien angedeutet. Es fragt sich, auf welche Weise ist es moͤglich, die
Spulen, deren senkrechte Achsen durch den Einschnitt hindurch und unter der
Scheibe noch herausragen, laͤngs der Schlangenlinie b, c, d, f, g, i, k fortzubewegen? Man bemerkt, daß
leztere aus lauter in einander uͤbergehenden Halbkreisen b,c,d, d,f,g g,i,k u.s.w. besteht. Die Mittelpunkte
a,e,h, aller Halbkreise enthalten zugleich die
Achsen eben so vieler gleicharmiger eiserner Kreuze A, B,
C, D, welche sich nach den Richtungen der Pfeile umdrehen. Diese
Kreuze, deren Arme in den Radien der ausgeschnittenen Halbkreise liegen, sind
es, welche den wellenfoͤrmigen Lauf der Spulen auf folgende Weise
bestimmen. Denkt man sich in b die Achse einer Spule
aus dem Einschnitte herausragend, und alle Kreuze nach den durch Pfeile
bezeichneten Richtungen sich drehend, so sieht man ein, daß die Spule durch den
Arm a, b des Kreuzes A
in dem Einschnitt uͤber c bis nach d hin geschoben werden muß; hier angelangt, wird sie
in demselben Momente von dem Arm e, d des zweiten
Kreuzes erfaßt und uͤber f bis g fortgeschoben; in diesem Punkte trifft die Spule
mit dem Arm h, g des dritten Kreuzes zusammen,
welcher sie nun uͤber i bis k bewegt, und sofort dem Arme l, k des vierten Kreuzes uͤbergibt. D stelle eines der beiden Endkreuze vor, welche in Fig. 33 ihre Stelle
bei a und d haben. Da
der Einschnitt hier einen ganzen Kreis bildet, so kann der Arm k,l die Spule von k
unaufgehalten uͤber m,n und o bis k
zuruͤkfuͤhren; hier aber wird sie von dem Arm h,k des Kreuzes C,
welcher indessen gleichzeitig mit dem Arm k,l eine
ganze Tour gemacht hat, erfaßt und in den zweiten, durch die punktirten Linien
angedeuteten. Einschnitt geleitet, welchen die Spule in derselben Ordnung wie
den ersten durchlaͤuft, bis sie an das andere Endkreuz gelangt, welches
sie wieder in den ersten Einschnitt zuruͤkbringt. Die Umdrehung der
Kreuze wird dadurch erzeugt, daß jedes derselben an seiner Achse ein Getriebe
enthaͤlt, von denen der Reihe nach eins ins andere greift; daher muß,
wenn nur eines derselben bewegt wird, die Umdrehung aller uͤbrigen Kreuze
mit erfolgen. Es kommt also darauf an, eines dieser Getriebe in Bewegung zu
sezen. Dieß geschieht durch den Eingriff eines groͤßeren, horizontalen
Stirnrades, dessen Umdrehungen mit den Bewegungen des Tretschaͤmels auf
einfache Art zusammenhangen.
Damit die Faͤden, welche von allen Spulen nach dem Punkte hingehen, wo das
Geflechte sich bildet, stets in einem gewissen Grade gespannt bleiben, und sich
von den Spulen nicht zu schnell abwinden koͤnnen, hat man mit den
lezteren eine ingenioͤse Einrichtung getroffen, welche ich aus der im
Durchschnitt dargestellten Skizze Fig. 35 zu
versinnlichen versuchen werde. Die eiserne, hohle, oben offene Spule
A, A ist auf die Achse c,
d eines Traͤgers a, b, c, d lose
gestekt und ruht auf dessen Boden a, b auf. Die
Verlaͤngerung der Achse c, d ist es, welche
durch den vielfach erwaͤhnten Einschnitt der Spulenscheide B, C hindurchragt und von den Kreuzen fortgeschoben
wird. Der Spulentraͤger a, b, c, d kann sich
nicht drehen, weil seine Achse bei n, wo sie im
Einschnitte gleitet, nicht rund, sondern oval gestaltet ist. Damit nun aber auch
die Spule A, A sich nicht von selbst durch den Zug
des Fadens drehen koͤnne, enthaͤlt sie an ihrem oberen Rande rings
herum kleine, schraͤge Zaͤhne, in welche von der unbeweglichen
Achse c, d des Traͤgers aus ein Sperrkegel
dergestalt einfallt, daß nun die Spule in der Richtung des Fadenzugs sich nicht
umdrehen laͤßt, und mithin der Faden erst nach Ausloͤsung des
Sperrkegels abgewikelt werden kann. Die Sperrvorrichtung selbst haben wir, um
die Zeichnung nicht zu verwirren, in Fig. 35 weggelassen.
Bei dieser Anordnung ist es indessen nothwendig, daß der Faden in dem Maaße, als
das Geflechte zunimmt, von Zeit zu Zeit sich abwikle, folglich die Spule auf
einen Moment frei werde, was nur durch ein abwechselungsweise zu rechter Zeit
erfolgendes Ausloͤsen und Wiedereingreifen jenes Sperrkegels zu erreichen
ist. Zu dem Ende sind an dem Spulentraͤger die Stangen b,h und d,i befestigt,
welche bei h, i und l
kleine Oehre enthalten. Durch diese Oehre laͤuft der Faden vom Umfange
der Spule hinweg in das Innere derselben, den Weg g, h,
i, k, l machend, und von da nach dem Punkte m hin, wo sich alle Faͤden zum Bande vereinigen. Im innern
Raͤume der Spule geht der Faden durch das Oehr eines kleinen auf-
und nieder beweglichen Gewichtchens k, welches ihn
stets angespannt erhaͤlt. Waͤhrend nun der Faden durch die
Operation des Flechtens sich verkuͤrzt, muß das Gewicht k steigen, sobald es aber auf einer gewissen
Hoͤhe angelangt ist, stoͤßt es gegen den erwaͤhnten
Sperrkegel und hebt ihn aus; dadurch wird die Spule auf einen Moment frei, das
Gewicht k kann mittelst des Fadens auf die Umdrehung
der Spule wirken, herabsinken und ein Stuͤk Faden von derselben abwikeln.
Dieß ist das Werk eines Augenblikes, denn der Sperrhaken faͤllt fast in
demselben Momente, als das Gewicht k herabsinkt,
wieder in das Gesperrt, die Spule steht still und das Gewichtchen beginnt von
Neuem zu steigen, bis es wieder an die Sperrvorrichtung stoͤßt, die Spule
wieder frei macht, und dasselbe Spiel wie oben veranlaßt. Solches geht im Innern
der Spule vor, waͤhrend sie selbst einander mit unglaublicher
Geschwindigkeit in Schlangenlinien umkreisen.
Die Verfertigung der Schnuͤrbaͤnder wird in Barmen nicht eigentlich
in Fabriken betrieben, sondern sie ist vereinzelt in vielen Familien zum Theil
als Nebenerwerb zu treffen. So viel ich weiß, ist in der Naͤhe von
Barmen nur eine einzige groͤßere Fabrik fuͤr diesen Artikel in
Betrieb, in welcher durch ein Wasserrad Hunderte von Spulenscheiben in
Thaͤtigkeit gesezt werden.
In der Reitpeitschen-Fabrik des Herrn J. C. Waͤscher fesselte hauptsaͤchlich das
Ueberflechten der Reitpeitschen meine
Aufmerksamkeit. Zu dieser Operation dient ein der
Schnuͤrband-Maschine ganz annaloger mechanischer Apparat. Man
sieht dieselben Einschnitte in der Spulenscheibe, nur daß hier die beiden
Schlangenlinien um die ganze Scheibe laufen und mithin die beiden Wendepunkte
a und d, Fig. 33,
fehlen. In der Mitte der Spulenscheibe befindet sich ein Loch, in welchem die zu
uͤberflechtende Peitsche bis uͤber die Haͤlfte versenkt
ist. Die Spulen durchkreuzen einander, paarweise ihre Bahn verfolgend, indem
sie, ohne umzukehren, die Runde um die ganze Scheibe machen. Jeder
Spulentraͤger enthaͤlt zwei Spulen, anstatt, wie bei der
Schnuͤrband-Maschine, eine einzige; dadurch bilden sich, wie man
auch an jeder Reitpeitsche bemerken kann, im Gesiechte lauter doppelte Faden,
welche eng an einander liegen, ohne sich jedoch gezwirnt zu haben. Mit
Huͤlfe von Gegengewichten steigt die Peitsche in dem Verhaͤltniß,
als sie uͤberflochten wird, in die Hoͤhe. Die Knoͤpfe oder
Wuͤlste, welche man in gewissen Absaͤzen an ihr bemerkt, werden
ganz einfach dadurch gebildet, daß der Arbeiter an der fraglichen Stelle einige
Sekunden lang das Emporsteigen der Peitsche verhindert. waͤhrend dieser
Zeit muß natuͤrlich das Geflechte an diesem Punkte sich anhaͤufen.
Das Ueberflechten einer ganzen Peitsche ist das Werk von kaum 60 Sekunden.
Schoͤpfraͤder.
In der Naͤhe von Barmen sah ich das in Fig. 36 von der Seite
abgebildete Wiesenwaͤsserungsrad. Es ist ein
einfaches Straubrad von 18 Fuß Hoͤhe und 2 Fuß Breite, welches aus der
Wupper schoͤpft und zugleich von derselben gerrieben wird. Sechs
hoͤlzerne Schoͤpfkasten a, a, a sind
fest zwischen den Schaufeln angebracht. Jeder derselben hat seitwaͤrts
eine Oeffnung von etwa vier Zoll im Gevierte, welche unten das Wasser
schoͤpft und oben in einen 10 Fuß langen Trog b,
b ausgießt. Dieser Trog ruht auf demselben Gebaͤlke, welches
zugleich das Achsenlager c des Rades traͤgt.
Kleine, von dem Trog ausgehende Rinnen leiten das Wasser an den Ort der
Bestimmung. Jeder der Schoͤpfkasten mochte nach meiner Schaͤlung
zwei Kubikfuß Rauminhalt haben und bei jedem Umgaͤnge 5/4 Kubikfuß Wasser
in den Trog liefern. Das Rad machte 4 Umdrehungen in der Minute; darnach
berechnet sich die von allen 6 Schoͤpfeimern gelieferte Wassermenge auf 18
Kubikfuß in der Minute auf eine Hoͤhe von 10–12 Fuß gehoben.
Bei dieser Gelegenheit fuͤhre ich zugleich ein anderes Schoͤpfrad
an, welches ich in dem Lennefluß bei Limburg arbeiten
sah. Die einfachere und mehr auf die Dauer berechnete Einrichtung gibt diesem
Schoͤpfwerk, welches Fig. 37 in der
vorderen Ansicht dargestellt ist, den Vorzug von dem obigen. Statt der
hoͤlzernen Schoͤpfkasten sind hier 12 starke,
cylinderfoͤrmige, oben offene Gefaͤße a, a,
a ausgebranntem Thon, 2 Fuß lang und 6 Zoll im Durchmesser, in
Gebrauch, welche je zwischen zwei Schaufeln in diagonaler Richtung befestigt
sind. Damit waͤhrend des Ausgießens so wenig wie moͤglich Wasser
neben dem Troge b, b verloren gehe, stehen die Eimer
etwas uͤber die Seite des Rades hervor, so daß sie, oben anlangend, bis
uͤber den Rand des Wassertroges hereinragen.
Einiges aus Iserlohn und seiner Umgebung.
Piepenstock's Bronzefabrik und Schoͤnenberg's
Karkassenfabrik in Iserlohn. Eigenthuͤmliches Cylindergeblaͤse
in der Gruͤne.
Welche industrioͤse Thaͤtigkeit in der Stadt Iserlohn und ihrer
Umgebung herrscht, und auf welchen beachtenswerthen Standpunkt das dortige
Fabrikenwesen sich gehoben hat, ist bekannt.
Sehenswerth sind unter vielen andern Fabriken in Iserlohn selbst: die
Bronze- und Nadelfabrik von Piepenstock, die
Karkassenfabrik von Schoͤnenberg, eine
Steigbuͤgel- und Spornfabrik und eine Plattirfabrik; in der
Umgegend: Piepenstock's Blechwalzwerk und Drahtzug in
der Oege, desselben Maschinennaͤgelfabrik in der Oese, C. Schmidt's Puddlingsfrischerei mit Stab- und
Drahtwalzwerken in Nachroth, Zinkbrennerei und Messingwerke in der
Gruͤne, Fingerhutmuͤhle und Nadelschleiferei von F. G. van der Becke in Hemer, Papierfabrik von Ebbinghaus in Lethmate u.s.w.
Zu den unternehmendsten und thaͤtigsten Maͤnnern im Bereiche der
Industrie gehoͤrt Hr. von Piepenstock, wie
schon aus der Reihe der so eben angefuͤhrten ihm zugehoͤrigen und
zum Theil in sehr großartigem Maaßstabe angelegten Fabriken sich errathen
laͤßt. Sein Werk auf der Oege, welches im Herbst 1836 noch im Bau
begriffen war, aber seiner Vollendung sich nahte, ist jezt wahrscheinlich weit
und breit die bedeutendste Anlage dieser Art. Ein kolossales
mittelschlaͤchtiges Wasserrad von 35 Fuß Hoͤhe und 14 Fuß Breite,
welches mittelst 15 Fuß Gefaͤlles eine Kraft von 75 bis 80 Pferden
darstellt, eiserne Stirnraͤder von 12 Fuß Durchmesser und 1 Fuß Breite und 400
Centner schwere Schwungraͤder erregten damals schon das Erstaunen der
Besuchenden. Das Walzwerk war noch nicht aufgestellt, im Drahtzug waren dagegen
bereits 16 Scheiben im Gang.
Bronzefabrik.
Die Bronze-Maaren werden in Piepenstock's
Fabrik theils gegossen, groͤßten Theils aber mit Huͤlfe von Fallwerken geschlagen. Fig. 38 zeigt die
Skizze eines solchen einfachen Fallwerks. A ist der
auf, und nieder bewegbare eiserne Fallkloz, an welchem der eigentliche
staͤhlerne Stempel a, worauf das Muster
gravirt ist, sizt. Zwischen zwei Ruͤken laufend, haͤngt er an
einem Seil c, und dieses ist an das Ende D des ungleicharmigen, um die Achse D beweglichen Hebels B, C,
D befestigt, mit dessen Huͤlfe der Stempel auf folgende Weise
gehoben wird. Der Mann, welcher den Apparat in Bewegung sezt, steht auf einer
eigends angebrachten gelaͤnderlosen Galerie d; waͤhrend er sich mit beiden Haͤnden an Striken, die von
der Deke herabhaͤngen, haͤlt, tritt er mit dem einen Fuß das Ende
B des wenigstens 12 Fuß langen Hebels B, C kraͤftig nieder, wobei er nicht nur
seine Muskelkraft, sondern auch das ganze Gewicht seines Koͤrpers wirken
laͤßt; nun zieht er schnell den Fuß zuruͤk, worauf der Stempel
vermoͤge der bedeutenden, auf dieser Seite herrschenden Ueberwucht
niederfaͤllt und das von dem zweitem Arbeiter untergelegte Metall in die
verlangte Form praͤgt. Die schmuzig aussehende Waare erhaͤlt
sofort auf die bekannte Art durch Eintauchen in eine verduͤnnte Mischung
von Schwefelsaͤure und Scheidewasser ihren schoͤnen Glanz; nachher
wird sie noch auf der Drehbank an den passenden Stellen polirt.
Karkassenfabrik.
Die sogenannten Karkassen sind ein in wenigen
nordischen Laͤndern gangbarer Artikel. Sie werden hauptsaͤchlich
in Holland zu dem Kopfpuz der Frauen in großer Menge verwendet, und bestehen aus
einem mit himmelblauer Seide uͤbersponnenen Hauptdraht und einem
duͤnneren, gleichfalls uͤbersponnenen Hauptdraht und einem
duͤnneren, gleichfalls uͤbersponnenen Draht, welcher mir Schleifen
an den ersteren befestigt wird, wie Fig. 40 zeigt. Wenn
auch die Fabrik des Hrn. Schoͤnenberg ein im
Allgemeinen unwichtiges, in den meisten Laͤndern kaum dem Namen nach
bekanntes Fabrikat producirt, so wird sie doch durch ihre hoͤchst
ingenioͤsen Maschinen, an deren Erfindung und Construction der Besizer
viele Jahre lang mit unermuͤdlichem Nachdenken und rastloser
Thaͤtigkeit gearbeitet hat, jedem Freunde der industriellen Mechanik
hohes Interesse gewaͤhren.
Die Fabrik besizt:
1) zwei Maschinen, welche den Draht mit Seide uͤberspinnen, nach der
gewoͤhnlichen Construction der Drahtspinnmuͤhlen;
2) zwei Karkassen-Maschinen, welche mittelst
einer Kurbel in Thaͤtigkeit gesezt, von selbst die Schleifen bilden und
sie zugleich an den Hauptdraht festbinden; ein Geschaͤft, das sonst von
Arbeiter rinnen mit der Hand, unter Benuͤzung einfacher Instrumente,
versehen wird. Mit jeder dieser Maschinen fabricirt ein Individuum 10 Karkassen
auf einmal und leistet, da die Bildung derselben auf diesem mechanischen Wege
doppelt so schnell, wie durch 10 Haͤnde, vor sich geht, eben so viel, als
20 Menschen. Die Maschine ist ziemlich complicirt, birgt aber einen
aͤußerst scharfsinnig angeordneten, in den uͤberraschendsten
Bewegungen sich entwikelnden Organismus. Ich will daher versuchen, nur ihre
mechanischen Hauptmomente, welche ich durch genaue Besichtigung der Maschine mir
ins Gedaͤchtniß praͤgte, mit Huͤlfe der Fig. 39 und 40 zu
erlaͤutern.
Die Maschine enthaͤlt 10 einander vollkommen gleiche Gaͤnge, von
denen jeder eine Karkasse fertigt. An dem bei der Darstellung des Fabricates
unmittelbar thaͤtigen Mechanismus jeden Ganges sind zwei Haupttheile zu
unterscheiden, naͤmlich derjenige, welcher die Schleifen bildet, und der,
welcher sie an den Hauptdraht befestigt. Zu dem lezteren Theil gehoͤrt
die Huͤlse oder Fluͤgelwelle
a, b, Fig. 39, welche einen
Fuͤhrer oder Fluͤgel b, c, und bei a ein kleines Getriebe besizt. Durch diese
Huͤlse laͤuft der bei d aufgespulte
Hauptdraht d, e. Außerdem ist auf der Huͤlse
noch das Roͤllchen f angebracht, welches das
zur Befestigung der Schleifen dienende Seidengarn enthaͤlt; dieses wird
von dem Roͤllchen aus nach dem Ende c des
Fluͤgels hingeleitet und laͤuft durch ein dort angebrachtes Oehr
nach dem Hauptdraht d, e hin. Nach dieser
Eroͤrterung ist klar, daß wenn die Fluͤgelwelle a, b vermoͤge des Eingriffes der
Raͤder a und g, g
in Umdrehung gesezt wird, der in f aufgespulte
Seidenfaden sich schraubenfoͤrmig um den Hauptdraht herumwindet,
vorausgesezt, daß der leztere nach der Richtung des Pfeiles sich langsam
fortbewegt. Man sieht hieraus die Moͤglichkeit, den einen Draht an den
andern zu befestigen, wenn nur die Schleifen auf die geeignete Weise an den
Hauptdraht hingehalten werden. Die Construction der Schleifen verlangt ferner,
wie unten erhellen wird, daß die Umdrehung der Fluͤgelwelle nicht
ununterbrochen, sondern absazweise, intermittirend erfolge.
Ich komme nun zur Beschreibung des die Schleifen darstellenden Mechanismus. Die
Spule, welche den duͤnneren hiezu bestimmten Draht enthaͤlt, ruht
auf dem an der duͤnnen Stange i, k
angebrachten Traͤger h. Die Stange i, k ist an ihren beiden Enden mit den
Parallelstaͤben l, i und m, k durch Charniere verbunden und bewegt sich im
Bogen, aber stets in senkrechter Lage verharrend, auf und nieder; p ist ein abgerundetes Metallstuͤk, um
welches der Draht geschlagen werden muß, um die verlangte Schleife zu bilden.
Dieß geschieht auch unfehlbar dadurch, daß das Parallelsystem I, i, k, m mit der Spule h sich abwaͤrts, bis in die in Fig. 40 angegebene
Lage, bewegt. Damit das Stuͤk p der Schleife,
welche, sobald sie gebildet ist, nach der Richtung des Pfeiles fortruͤkt,
nicht im Wege stehe, so zieht es sich immer zu rechter Zeit von derselben
zuruͤk, ruͤkt aber, da es zur Darstellung der folgenden Schleife
unentbehrlich ist, sogleich wieder vor. Im Bereiche des Fluͤgels b, c ist eine feste Vorrichtung o, die ich Bank nennen
will, angebracht. Im Herabsinken streift der Traͤger h an der Bank o vorbei,
sezt seine Spule, wie Fig. 40 zeigt, auf
derselben ab und bewegt sich ohne Spule bis in seine tiefste Lage weiter. Eine
am Stabe i, k angebrachte bewegbare Schiene q; legt sich waͤhrend dieser Bewegung in die
in Fig.
40 sichtbare Lage um, und bringt dadurch den Draht in die
erforderliche senkrechte Lage; zugleich pakt ein hier nicht angegebenes
Zaͤngelchen die beiden Draͤhte in der Eke bei a, damit im naͤchsten Momente die
Fluͤgelwelle beide Drahte umwikeln und sie so befestigen koͤnne.
Ist dieß geschehen, so steht die Fluͤgelwelle still, die
Parallelvorrichtung erhebt sich, nimmt mit dem Traͤger h die auf der Bank o
ruhende Spule wieder auf und gelangt in ihre erste Stellung, Fig. 39,
zuruͤk. Nun kommt die Fluͤgelwelle auf ein Paar Sekunden wieder in
Gang und umwikelt den Hauptdraht von r bis s; zugleich schiebt sich p wieder vor, worauf das ganze Spiel in der beschriebenen Reihenfolge
sich erneuert. Das Fabricat wikelt sich auf einer unter der Welle A, Fig. 40, angebrachten
Trommel auf. Alle diese heterogenen Bewegungen erfolgen waͤhrend einer
einzigen Kurbelumdrehung.
Cylindergeblaͤse.
Auf einem Raffinir-Hammerwerk in der Gruͤne bei Iserlohn fiel mir ein Cylindergeblaͤse von außergewoͤhnlicher
Construction auf, dessen Abbildung in Fig. 41 gegeben ist.
Das Geblaͤse enthaͤlt nur einen einzigen, aber doppelt wirkenden
Cylinder. Die Kolbenbewegung wird durch einen verzahnten Rahmen A, A vermittelt, innerhalb dessen das zur
Haͤlfte verzahnte, 2 1/2 Fuß im Durchmesser haltende, Getriebe a sich dreht. Dadurch, daß die Zaͤhne des
Getriebes waͤhrend seiner Umdrehung abwechselnd bald auf der einen, bald
auf der andern Seite mit den Zaͤhnen des Rahmens im Eingriff sind,
erfolgt das Auf- und Niedersteigen des leztern. Von dem Rahmen A, A steigt die Kolbenstange b, c empor, tritt durch die Stopfbuͤchse c in den Cylinder B, B und verlaͤßt
ihn durch die Stopfbuͤchse d. Mit ihrem Ende
e haͤngt die Kolbenstange an einer Kette,
welche an den Bogen eines Balanciers C, D befestigt
ist. Der Zwek des Balanciers besteht darin, mit Huͤlfe eines bei D angebrachten Gegengewichtes das Gewicht des
Rahmens A, A sammt Kolbenstange so weit
auszugleichen, daß der von dem betreibenden Wasserrade zu
uͤberwaͤltigende Widerstand gleichfoͤrmig werde.
Das Geblaͤse arbeitete in der That besser, als ich erwartet haͤtte.
Da die Bewegung langsam ist, und der Rahmen A, A mit
dem Gegengewichte balancirt, so ist mit dem wechselnden Eingreifen des Getriebes
a keine bedeutende Erschuͤtterung
verbunden; und wenn auch eine Abnuͤzung, namentlich an den Endzahnen des
Rahmens und Getriebes, vorauszusehen, und eine etwas schiefe Richtung des
Angriffspunktes gegen die Lage der Kolbenstange nicht zu vermeiden ist, so
scheint mir doch die Anwendung des verzahnten Rahmens gerade in dem vorliegenden
Fall, wo keine zu schnelle Bewegung erfordert wird, nicht zu verwerfen.
(Fortsezung
folgt.)
Tafeln