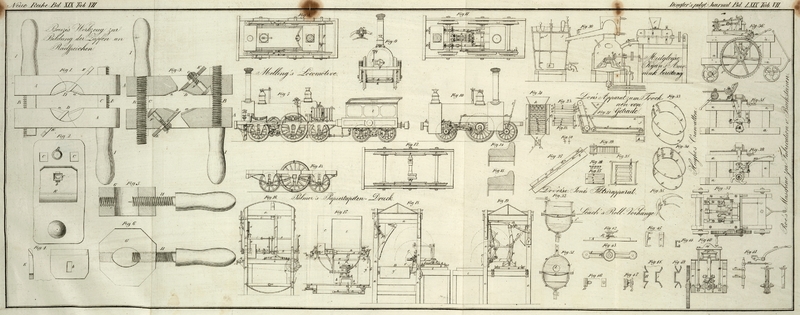| Titel: | Verbesserungen im Zubereiten und Troknen von Samen, Körnern oder Beeren, und in deren Verwendung zu verschiedenen Producten, welche Verbesserungen zum Theil auch zu anderen Zweken anwendbar sind, und worauf sich Thomas Don, Gentleman von James Street, Golden Square, in der Grafschaft Middlesex, am 3. Decbr. 1836 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. LXXIII., S. 350 |
| Download: | XML |
LXXIII.
Verbesserungen im Zubereiten und Troknen von
Samen, Koͤrnern oder Beeren, und in deren Verwendung zu verschiedenen Producten,
welche Verbesserungen zum Theil auch zu anderen Zweken anwendbar sind, und worauf sich
Thomas Don,
Gentleman von James Street, Golden Square, in der Grafschaft Middlesex, am 3. Decbr. 1836 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Julius
1838, S. 15.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Don's Apparat zum Waschen und Troknen.
Meine unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen Erfindungen betreffen: 1) eine
Maschine zum Waschen des Getreides und anderer Fruͤchte, um vermoͤge
des Unterschiedes im specifischen Gewichte die schlechten Koͤrner oder
Unreinigkeiten von den guten Koͤrnern abzuscheiden. 2) einen aus
Roͤhren bestehenden, mit Dampf, heißem Wasser oder heißer Luft geheizten
Trokenapparat, in welchem sich die Koͤrner oder Fruͤchte
vermoͤge ihrer Schwere uͤber und zwischen den Roͤhren bewegen,
und zwar eine beliebige Zeit uͤber. 3) endlich die Anwendung dieser mit
einigen Zusaͤzen ausgestatteten Maschinen zum Malzen und anderen Zweken.
In Fig. 21
sieht man den Durchschnitt eines Behaͤlters, der z.B. auf 10 bis 20 Fuß
Laͤnge, 2 oder 3 Fuß Breite und eben so viel Tiefe haben kann, dessen
Dimensionen aber je nach der Quantitaͤt, die man auf ein Mal dem
Reinigungsprocesse unterwerfen will, verschieden modificirt werden koͤnnen.
In diesem Behaͤlter, der bis zur Linie a, a mit
Wasser gefuͤllt ist, befinden sich zwei Scheidewaͤnde: eine senkrechte
oder nach der Quere gestellte b und eine horizontale
oder schwach in horizontaler Richtung geneigte c. Die zu
reinigenden Samen gibt man in den Trichter d, dessen
Muͤndung so eingerichtet ist, daß die durch sie fallende Quantitaͤt
der Samen beliebig regulirt werden kann. Wenn das Getreide der ganzen Breite des
Wasserbehaͤlters nach in einem duͤnnen Strome in das Wasser her,
abfaͤllt, so werden die schlechten Koͤrner, Spelzen und sonstigen
leichteren Unreinigkeiten auf dem Wasser schwimmen, waͤhrend die guten
schweren Koͤrner uͤber die Scheidewand b
hinabgleiten und auf die horizontale Scheidewand c
fallen. Zum Behufe weiterer Reinigung und um die Koͤrner auch von den ihnen
anhaͤngenden erdigen oder Schlammtheilchen zu befreien, wird dann das
Getreide laͤngs der oberen Flaͤche der horizontalen Scheidewand c fortgeschafft, bis es an deren Ende auf den Boden des
Wasserbehaͤlters herabfaͤllt, und auf diesem bis in die hinter der
Scheidewand c befindliche Vertiefung gelangt, aus der es
mittelst der Schoͤpfvorrichtung h, h an einen
beliebigen Ort emporgeschafft wird. Diese Bewegung wird mittelst einer Vorrichtung
bewerkstelligt, die, wie man sieht, aus zwei endlosen Ketten besteht, an denen in
gewissen, z.B. 1 Fuß betragenden Entfernungen von einander nach Art einer
Strikleiter Querstaͤbe festgemacht sind, die durch die ganze Breite des
Behaͤlters reichen. Die Ketten laufen uͤber die beiden Rollen oder
Cylinder f, f. Man sieht eine derlei Kette in Fig. 29
abgebildet und mit e, e bezeichnet. Wenn einer der
Cylinder f durch irgend eine Kraft in Bewegung gesezt
wird, so bewegen sich auch die Ketten mit den zwischen ihnen befindlichen
Querstaͤben; und die Folge hievon ist, daß die Ketten, indem sie sich
laͤngs der Scheidewand und laͤngs des Bodens des Behaͤlters hin
bewegen, das Getreide mit sich vorwaͤrts ziehen. Die Achse oder Welle des
Treibcylinders oder der Treibrolle, die Alles in Bewegung sezt, laͤuft durch
die Seitenwaͤnde des Behaͤlters und bewegt sich in
Stopfbuͤchsen, die kein Wasser auslassen. Auch die uͤbrigen
Zapfenlager duͤrfen dem Wasser keinen Ausfluß gestatten. Aus der hinter dem
Cylinder f' befindlichen Vertiefung g, in die das Getreide durch eben beschriebene endlose
Kette geschafft wird, wird dasselbe mittelst der Schoͤpfvorrichtung h, h, welche man auch eine Jacob'sleiter zu nennen
pflegt, emporgehoben. Doch kann zu diesem Zweke auch irgend eine andere
aͤhnliche Maschine dienen, wie z.B. ein endloses Tuch, dem eine solche
Schraͤgheit gegeben ist, daß das von der Kettenvorrichtung an dasselbe
abgegebene Getreide auf ihr an den gewuͤnschten Ort geschafft wird, und auf diesem Wege zugleich
auch abtropft. Das mit 1 bezeichnete Ende des Behaͤlters muß zu diesem Zweke
dem dem endlosen Tuche zu gebenden Winkel entsprechen. Alle diese Vorrichtungen sind
so bekannt, daß sie keiner weiteren Beschreibung beduͤrfen. Man kann das
Getreide auf dieselbe Weise, auf die es unter dem Cylinder f¹ hin lief, auch unter dem Cylinder f
weglaufen lassen, damit es hiedurch noch mehr abgerieben werde. Gut ist es, dem
Behaͤlter bestaͤndig Wasser zufließen zu lassen, so daß es bei i, wo sich ein Ausschnitt befindet, der dem Niveau, auf
dem man das Wasser erhalten will, entspricht, fortwaͤhrend
uͤberfließt, und dabei die leichteren Theilchen mit sich fortreißt. Dieses
Abflußwasser sammt den leichteren Theilchen hat in dem an der Seitenwand des
Behaͤlters angebrachten Canale j herabzufließen,
um am Boden desselben durch eine Art von Sieb zu laufen, welches die Spelzen und
sonstigen leichteren Theilchen vom Wasser abscheidet. Das gewaschene Getreide ist
hierauf alsogleich zu troknen.
Mein verbesserter Trokenapparat besteht aus uͤbereinander angebrachten
dreikantigen Roͤhren, welche mit Dampf, heißem Wasser oder heißer Luft
geheizt werden sollen. Fig. 22 zeigt eine solche
Roͤhrenvorrichtung in einer horizontalen Ansicht. a,
a sind vierseitige Roͤhren, welche mit den dreiseitigen
Roͤhren b, b verbunden sind und auch frei mit
ihnen communiciren, so daß der durch die gerade stehende Roͤhre c herbeistroͤmende Dampf durch die kurze
Roͤhre d in die vierseitige Roͤhre a' uͤbertritt, und aus dieser frei in
saͤmmtliche dreiseitige Roͤhren b, b, b
uͤbergeht, um endlich durch die Verbindungsroͤhre e in die Austrittsdampfroͤhre f zu gelangen und durch diese auszutreten. Wie man
sieht, sind zwischen den Roͤhren b, b, b
Raͤume gelassen, damit die Koͤrner etc. zwischen ihnen durch treten
koͤnnen. l, l sind kleine, 1 oder 2 Zoll hohe
Vorspruͤnge, welche das zunaͤchst oberhalb befindliche
Roͤhrenlager tragen, damit zwischen je zweien Roͤhrenlagern
gleichfalls ein entsprechender Raum bleibt. Diese Vorspruͤnge sind, wie Fig. 24 zeigt,
in Zwischenraͤumen ausgetieft, damit die aus dem Getreide verdampfte
Feuchtigkeit aus jedem Roͤhrenlager entweichen kann. Ich gebe diesen
Roͤhren vorzugsweise eine dreiseitige Gestalt, obwohl man ihnen auch eine
beliebige andere Zahl von Kanten und selbst krummlinige Oberflaͤchen geben
kann.
In Fig. 23
sieht man vier dieser Roͤhrenlager in einer seitlichen Ansicht uͤber
einander angebracht. Auch hier sind a, a die
vierseitigen und b, b, b die dreiseitigen
Roͤhren, waͤhrend l, l die die einzelnen
Roͤhrenlager tragenden Vorspruͤnge sind. Man bemerkt hier aber auch
die kleinen Roͤhren g, g, g, welche, wie aus Fig. 30
erhellt, mit einer vierekigen Schulter oder Ausladung ausgestattet sind. Diese Roͤhren leiten
das aus dem Dampfe verdichtete Wasser nach Abwaͤrts, waͤhrend sie die
in den Roͤhren enthaltene Luft aus jedem Lager nach Aufwaͤrts
entweichen lassen. Sie haben an dem einen Ende recht- und an dem anderen
linkhandige Schraubengewinde, und die Lager sind auch demgemaͤß ausgebohrt.
Fixirt werden sie auf solche Weise, daß jene Roͤhren, deren laͤngeres
Ende nach Abwaͤrts gerichtet ist, und beinahe bis auf den tiefsten Theil des
Inneren der vierseitigen Roͤhren a, a hinab
reicht, aus jedem Lager das Wasser abfließen lassen, ohne von Seite des
emporsteigenden Dampfes oder der Luft irgend ein Hinderniß zu erfahren. Dagegen
lassen jene Roͤhren, deren laͤngeres Ende nach Aufwaͤrts
gerichtet ist, den Dampf oder die erhizte Luft frei entweichen, ohne daß das aus dem
Dampfe verdichtete Wasser bei seinem Herabfließen irgend ein Hinderniß in den Weg
legt. Die Roͤhren g, g, g, g haben das
laͤngere Ende nach Aufwaͤrts; die Roͤhren g', g', g', g' dagegen haben dasselbe nach
Abwaͤrts gerichtet.
Fig. 24 zeigt
den ganzen Troken- oder Darrapparat zusammengesezt; man sieht hieran die
sieben oberen Roͤhrenlager in einem Enddurchschnitte; die sieben unteren
dagegen vom Ende her betrachtet; auch bemerkt man die Traͤger oder
Vorspruͤnge l, l mit den umgekehrten Bogen oder
Auswoͤlbungen, durch die aus jedem Lager die Feuchtigkeit entweichen kann,
die beim Darren aus dem Getreide ausgetrieben wird. Die Dampfroͤhre c kann entweder mit einem Dampfkessel oder auch mit dem
Auslaßrohre einer Dampfmaschine in Verbindung gebracht werden. Sie versieht jedes
der Roͤhrenlager mit Dampf, heißem Wasser oder heißer Luft, indem diese durch
die Verbindungsroͤhren d, d in die einzelnen
Lagerroͤhren uͤbergeht. Der durch die Roͤhrenlager
gestroͤmte Dampf oder das sonstige angewendete Heizmittel tritt durch die
Verbindungsroͤhren e in das gemeinschaftliche
Auslaßrohr f und durch dieses in die Luft. Man kann an
diesem lezteren Rohre zum Behufe der Regulirung des Dampfaustrittes einen Hahn
anbringen, besonders wenn zur Heizung der Darre ein eigener Kessel vorhanden ist.
Die Roͤhre h leitet das verdichtete Wasser aus
der Darre ab. An den Seiten der einzelnen Roͤhrenlager bemerkt man die beiden
Seitenplatten i, i, wodurch das Getreide beim
Herabfallen durch die Darre zusammengehalten wird. Aus Fig. 24 wird man ersehen,
daß sich in den abwechselnden Roͤhrenlagern drei gleichseitige, dreikantige
Roͤhren und an jeder Seite eine rechtwinklige dreiseitige Roͤhre
befinden. Diese Einrichtung ist deßhalb getroffen, damit das Getreide bei seinem
Herabfallen von den Seiten gegen die Mitte der Darre hin geleitet werde, um auf
solche Weise einer mehr gleichmaͤßigen Hize zu unterliegen. Am Boden des unteren
Roͤhrenlagers ist ein Schieber m befestigt, der
sich uͤber die zwischen den dreiseitigen Roͤhren gelassenen
Raͤume schiebt. Er dient zur Regulirung des Durchganges des Getreides durch
die Darre; denn je nachdem man ihn mehr oder minder weit oͤffnet, wird das
Getreide mehr oder minder rasch durch dieselbe laufen. Das zu troknende Getreide
wird durch den Trichter k in die Darre eingetragen. Es
faͤllt, nachdem es sich durch diese bewegt hat, in den unteren Trichter L, aus dem es durch einen Schlauch 1 an eine Vorrichtung
gelangt, die es abermals an den Trichter k emporschafft.
Man kann daher das Getreide auf diese Weise mit Leichtigkeit so oft durch die Darre
laufen lassen, als man es zur Erzielung des gehoͤrigen Grades von Trokenheit
fuͤr noͤthig erachtet. Nach vollbrachter Troknung laͤßt man es
durch den Schlauch 2 in Saͤke laufen, indem man den Schlauch 1 dafuͤr
mittelst eines Schiebers verschließt.
Fig. 25 zeigt
von der unteren Seite betrachtet ein Lager gemeinschaftlich gegossener oder
anderweitig mit einander verbundener Roͤhren aus Gußeisen. a, a sind die End- und b,
b die Laͤngenroͤhren. Der Dampf tritt bei einer der
Endroͤhren ein, verbreitet sich in den Laͤngenroͤhren, und
entweicht durch die andere Endroͤhre. Anstatt aber die Koͤrner
zwischen den Laͤngenroͤhren durchfallen zu lassen, sind die
Zwischenraͤume zwischen diesen Roͤhren mit einem sehr duͤnnen
Metallbleche verschlossen, in welchem Bleche kleine Loͤcher angebracht sind,
damit wohl der Staub u. dergl., keineswegs aber die Koͤrner selbst
durchfallen koͤnnen. Fig. 26 zeigt einen
Durchschnitt durch die Mitte eines solchen Roͤhrenlagers, dessen
Roͤhren vierekig, halbrund oder halboval seyn koͤnnen.
Fig. 27 zeigt
zwei Roͤhrenlager der beschriebenen Art, welche bei f mit einander verbunden und schief gestellt sind. Sie werden von dem
Holzwerke b getragen, und bilden auf diese Weise eine
andere Art von Darre. Der Dampf tritt am untersten Theile der Roͤhre e ein, und entweicht durch den oberen Theil der
Roͤhre g. Man kann das obere Ende dieser
Roͤhrenlager hoͤher stellen, und den Lagern also, je nachdem es das zu
troknende Getreide erheischt, einen beliebigen Grad von Neigung geben. c, c sind seitliche Platten, an denen die Schieber d, d angebracht sind. Leztere haben Aehnlichkeit mit den
Sieben, deren man sich zum Sieben des Getreides bedient. Sie reguliren die Dike des
herabfallenden Koͤrnerstromes; und man kann eine groͤßere oder
geringere Anzahl von ihnen anwenden. Am unteren Ende der Darre gelangen die
Koͤrner in eine Schoͤpfvorrichtung, die sie entweder neuerdings in die
Darre, oder auf den Kuͤhlspeicher oder in Saͤke schafft. Fig. 28 zeigt
5 solcher Roͤhrenlager uͤber einander angebracht und zu einer Darre
verbunden. a ist die Dampfroͤhre, b, die Auslaßroͤhre fuͤr den Dampf, und
c ein luftdichtes Gehaͤuse, womit das Ganze
umgeben ist.
Ich beabsichtige nun die beschriebenen Apparate auch zur Fabrication von Malz zu
verwenden, und dadurch diese bedeutend zu beschleunigen. Gesezt, es sey eine der
Darren Fig.
24, 27 oder 28 mit einem dampfdichten Gehaͤuse umschlossen, so bringe ich das
in Malz zu verwandelnde genezte Getreide in dieselbe, welche zu diesem Zweke auf
einer maͤßigen Temperatur erhalten werden muß. Hierauf lasse ich zur
Befoͤrderung und Beschleunigung des Keimens in das Gehaͤuse einen mit
Sauerstoffgas verbundenen Dampfstrahl eintreten. Wenn das Getreide, nachdem es zu
keimen begonnen hat, umgewendet werden soll, damit sich seine Wuͤrzelchen
besser entwikeln, so unterbricht man den Dampfzufluß, und sezt das Getreide in
Bewegung; ist es hinreichend bewegt worden, so laͤßt man es noch einige Zeit
unter Zutritt von so viel Dampf, als noͤthig ist, um es feucht zu erhalten,
ruhen. Nach beendigter Malzung beginnt man dann den Darrproceß.
Der Apparat Fig.
27 laͤßt sich zum Troknen von Stroh, Hopfen, naß geerntetem
Getreide, Wolle, Baumwolle, Roßhaar oder dergleichen benuzen. Man bedient sich hiezu
der bei Fig.
21 beschriebenen Vorrichtung, welche die zu troknenden Stoffe mit irgend
einer beliebigen Geschwindigkeit nach Auf- oder nach Abwaͤrts
bewegt.
Bemerken muß ich nachtraͤglich zu Fig. 21, daß ich die
Scheidewand c, den Boden des Behaͤlters und auch
die innere Wand der Vertiefung zuweilen mit grobem Filze oder mit irgend einem
anderen derlei Stoffe uͤberziehe, damit das Getreide auf seinem Wege
uͤber dieselben besser abgerieben wird. Ebenso kann man unter der
horizontalen Scheidewand c einen losen, nach Unten mit
Filz oder dergleichen uͤberzogenen Rahmen anbringen, der mehr oder minder auf
die Koͤrner druͤkt, waͤhrend dieselben laͤngs des Bodens
des Behaͤlters fortgezogen werden.
Tafeln