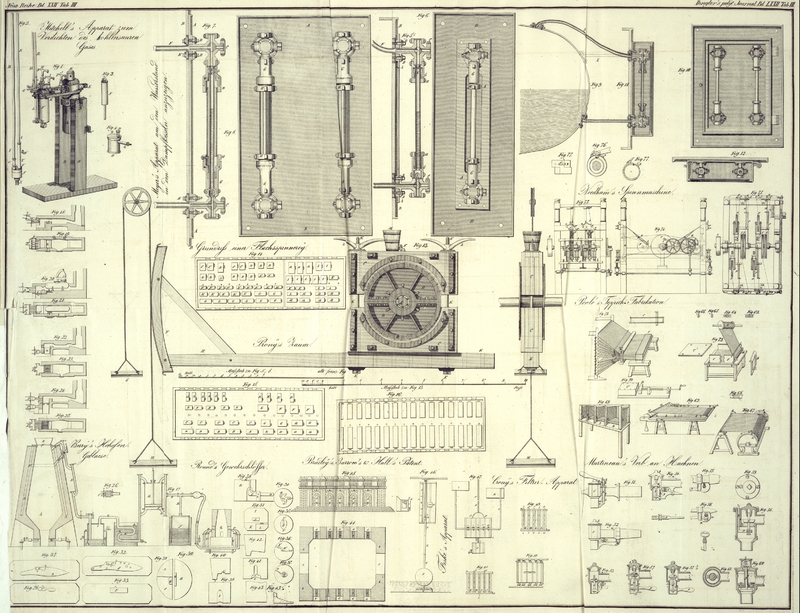| Titel: | Apparat zum Erhizen der Gebläseluft der Hohöfen mittelst der Gichtflamme, worauf sich Miles Berry, Patentagent am Office of Patents, Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, auf die von einem Fremden erhaltene Mittheilung am 31. Mai 1838 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. XXXI., S. 120 |
| Download: | XML |
XXXI.
Apparat zum Erhizen der Geblaͤseluft der
Hohoͤfen mittelst der Gichtflamme, worauf sich Miles Berry, Patentagent am Office of Patents,
Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, auf die von einem Fremden erhaltene
Mittheilung am 31. Mai 1838 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts. Februar 1839, S.
285.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Berry's Apparat zum Erhizen der Geblaͤseluft der
Hohoͤfen.
Gegenwaͤrtige, die Ersparniß an Brennmaterial bezwekende Erfindungen bestehen
in einer eigenen Methode den Rauch, die Gase und die Daͤmpfe, welche sich
beim Verbrennen der Brennstoffe und beim Schmelzen von Erzen entwikeln, zu sammeln
und in einen Ofen zu leiten, um sie in Verbindung mit der gewoͤhnlichen
Geblaͤsluft zur Unterhaltung der Verbrennung in demselben zu benuzen.
Die Art und Weise, nach welcher der Patenttraͤger dieß zu bewerkstelligen
sucht, erhellt aus der beigefuͤgten Zeichnung, in welcher Fig. 17 einen
Durchschnitt einer Reihe der hiezu dienlichen Apparate darstellt. A, A ist ein Ofen, wie er gewoͤhnlich zum
Ausschmelzen von Erzen benuzt wird. An dem oberen Ende desselben bemerkt man den
Trichter B, bei welchem das Erz und die Kohlen
aufgegeben werden, und an dessen unterem Theile sich ein Schieber oder ein Laden C befindet, welcher so genau paßt, daß, wenn er
geschlossen ist, weder Gase noch Daͤmpfe an dem oberen Ofenende entweichen
koͤnnen. Unten an dem Ofen bemerkt man die Pumpen D,
D, welche von den Geblaͤsen her die zur Unterhaltung der Verbrennung
noͤthige Luft in den Ofen leiten. In der Naͤhe des oberen Ofenendes
ist in dem Mauerwerke eine elliptische Oeffnung angebracht, von der die
Roͤhre E auslaͤuft. Diese Roͤhre
leitet den Rauch, die Gase und die Daͤmpfe, welche sich im Ofen entwikeln,
und welche, wenn der Schieber C geschlossen ist, keinen
anderen Ausweg haben, ab. Sie steigt unter einem Winkel von beilaͤufig 45
Graden empor, damit sie sich nicht durch das in den Ofen eingetragene Material
verlegen kann, und damit die von dem Luftstrome emporgetriebene Asche wieder in den
Ofen zuruͤkfalle. Uebrigens ist diese Neigung der Roͤhre auch nicht
streng nothwendig, da die Aschenmenge immer nur gering seyn wird, und da der Ofen
nicht ganz bis zum Rande hinauf mit Material gefuͤllt zu werden pflegt.
Jedenfalls ist aber darauf zu sehen, daß die Muͤndung dieser Roͤhre
stets frei bleibt, und daß ihre Weite eine solche ist, daß sie den Daͤmpfen
freien Abzug gestattet.
Da waͤhrend des Nachtragens von Erz und Brennmaterial der Schieber C von Zeit zu Zeit geoͤffnet werden muß, und da
hiedurch das Ausstroͤmen der Gase und Daͤmpfe durch die Roͤhre
E unterbrochen werden wuͤrde, so ist noch
fuͤr einen Canal gesorgt, durch den die Daͤmpfe in die Roͤhre
E gelangen koͤnnen. Es ist naͤmlich
innen im Ofen wenigstens einen Fuß unter der Oberflaͤche des der Behandlung
unterliegenden Materiales bei F, F eine
ringfoͤrmige Einziehung in dem Mauerwerke angebracht, von der aus eine
Roͤhre G, die oben mittelst eines Schiebers Z abgesperrt werden kann, in die Roͤhre E emporfuͤhrt.
Ich will nun zeigen, wie der Rauch, die Gase und die Daͤmpfe, welche durch die
Roͤhre E abgeleitet worden, an einem anderen Ofen
benuzt werden koͤnnen, um dadurch eine Ersparniß an Brennmaterial zu
erzielen. Die Roͤhre E laͤßt sich in
irgend einer Form herableiten, und soll zum Behufe der Reinigung der in ihr
enthaltenen Gase und Daͤmpfe mit ihrem unteren Ende in einen
Wasserbehaͤlter untertauchen. Man sieht diesen Behaͤlter bei H, H beinahe bis zur Haͤlfte mit Wasser gefuͤllt; in
ihn ist nach Art eines Gasometers umgekehrt ein anderer Behaͤlter I gestuͤrzt, der jedoch mit Bolzen und
Schraubenmuttern festgemacht ist. Die Roͤhre E
ist durch den Scheitel dieses Behaͤlters I
gefuͤhrt, so daß sie mit ihrem unteren Ende in das Wasser untertaucht und die
Gase also mit Zuruͤklassung der Unreinigkeiten, welche sie mit sich
fuͤhrten, durch das Wasser emporsteigen muͤssen, um in den oberen
Theil des Behaͤlters I zu gelangen. Das Wasser
wird mittelst einer Roͤhre und einem Hahne auf gehoͤriger Hoͤhe
erhalten, und kann ebenso auch bei einem Hahne abgelassen werden. In den oberen
Theil des Behaͤlters I ist eine Roͤhre K eingesezt, welche die gewaschenen Gase und
Daͤmpfe weiter leitet, und welche gewunden durch den Wasserbehaͤlter
L, L gefuͤhrt ist, damit der in ihr
enthaltene Wasserdampf verdichtet wird. Dem verdichteten Wasser kann durch einen
Heber oder durch einen Hahn Abfluß gegeben werden. Aus dem
Kuͤhlbehaͤlter L steigt die Roͤhre
K an einer Luftpumpe M
empor, in welche die Gase durch zwei Muͤndungen, welche mit Ventilen, die
sich nach Innen oͤffnen, ausgestattet sind, einstroͤmen. In dieser
Pumpe wird auf irgend eine Weise der Kolben N auf und
nieder bewegt, und hiedurch werden die Gase einerseits in den Roͤhren E und K herbeigesogen,
andererseits aber durch die Roͤhren O, O, O, an
denen sich Ventile befinden, welche sich nach Auswaͤrts oͤffnen,
ausgetrieben. Auf dem Wege von den Roͤhren O, O
an die Duͤsen P, P des Schmelzofens Q stroͤmt das Gas durch die Roͤhre R auch noch in das gleich einem Gasometer gebaute
Gefaͤß S. Dieser Gasometer wirkt wie ein
Luftgefaͤß und regulirt den Druk des Gasstromes. Wenn naͤmlich die
Spannkraft des Gases groͤßer wird, als sie erforderlich ist, so treibt sie
durch den von ihr erzeugten Druk das Wasser in dem Gefaͤße S zuruͤk. Dieser Apparat ist allgemein bekannt,
da man sich seiner an den Huͤttenwerken gewoͤhnlich zur Regulirung der
Geblaͤsluft bedient.
Um die auf solche Weise in den Ofen getriebenen Gase mit gewoͤhnlicher
Geblaͤsluft zu vermengen, ist in jede der Duͤsen P, P auch noch eine gewisse Roͤhre T eingesezt, durch welche ein gewoͤhnliches
Geblaͤse atmosphaͤrische Luft eintreibt. Es treten also Gas und Luft
mit einander vermengt in den Ofen ein, und dadurch wird die Verbrennung bedeutend
befoͤrdert, so daß sich eine wesentliche Ersparniß an Brennmaterial
ergibt.
Zu bemerken ist, daß, obschon die Luftroͤhren T
concentrisch in den Gasroͤhren P angebracht seyn
sollen, es doch besser ist, wenn die Luftroͤhre beilaͤufig um 6 Zoll
hinter der Muͤndung der Gasroͤhre aufhoͤrt, damit sich Luft und
Gas vor ihrem Eintritte in den Ofen gehoͤrig mit einander vermengen. Auch ist
es gut, wenn die Luft mit etwas groͤßerer Gewalt eingetrieben wird als die Gase. Da es in einigen
Faͤllen gut ist, wenn man die Geblaͤsluft durch die oberen
Duͤsen einleitet, so soll man, um die Roͤhren verlaͤngern zu
koͤnnen, einige Stuͤke derselben zum Schieben einrichten.
Will man die beschriebene Methode auf Raffiniroͤfen anwenden, so soll man die
Muͤndungen der Gasroͤhren etwas weiter machen, als jene der
Luftroͤhren, indem durch eine groͤßere Menge Gas die Arbeit dieser
Oefen auf das Beste gefoͤrdert werden kann. Fuͤr Reverberir-
oder Puddliroͤfen ist es der Erfahrung gemaͤß besser, wenn die Gase
und die Luft im Ofen selbst vermengt werden. Der Erfinder raͤth daher, in
diesem Falle die Gase und die Luft durch eigene getrennte Duͤsen einzuleiten.
Man sieht eine solche Einrichtung in Fig. 18 in einem
Durchschnittsaufrisse und in Fig. 19 in einem
horizontalen Durchschnitte, an welchem P die
Gasroͤhre und T die Luftroͤhre vorstellt.
Wenn die beiden luftfoͤrmigen Fluͤssigkeiten auf diese Weise
eingeleitet werden, und sich an der erforderlichen Stelle mit einander verbinden, so
uͤben sie, wenn sie mittelst einer Flamme oder einer geringen Menge
brennender Steinkohlen entzuͤndet werden, einen hoͤchst
wohlthaͤtigen Einfluß auf das der Behandlung unterliegende Metall.
Waͤre noch ein Extrafeuer erforderlich, so koͤnnte man ein solches
zwischen den beiden Stegen bei z aufzuͤnden.
An Oefen, an denen die Verbrennung hauptsaͤchlich durch den Zug eines Kamines
unterhalten wird, kann man Gasstroͤme, welche auf die oben beschriebene Weise
erzielt wurden, auf die aus Fig. 20 und 21 zu
ersehende Art einleiten. Das Gas wird durch die Roͤhre P in den vorderen Theil des Ofens eingeleitet, waͤhrend man die
atmosphaͤrische Luft wie gewoͤhnlich durch die Register des
Aschenloches oder an anderen erforderlichen Stellen eintreten laͤßt. Wenn die
beiden mit einander vermengten luftfoͤrmigen Fluͤssigkeiten durch ein
kleines, auf dem Roste Y brennendes Feuer
entzuͤndet werden, so laͤßt sich auf solche Art eine sehr starke Hize
erzielen. Man kann, um das Gas gleichmaͤßiger in der vorderen Kammer des
Ofens zu vertheilen, eine, zwei oder mehrere Roͤhrenreihen oder eine breite
flache Roͤhre von der Hauptgasroͤhre P
auslaufen lassen. Wenn der Ofen bestaͤndig geheizt werden soll,
waͤhrend der Gaszufluß aus dem Hohofen zeitweise unterbrochen wird, so kann
man zwischen den beiden Stegen bei Z
aushuͤlfsweise ein Feuer aufzuͤnden.
Wenn das Eisen in einem Reverberirofen erhizt werden soll, ohne daß es bis zur
Schweißhize erhizt zu werden braucht, so kann die Erhizung durch Gas und Luft allein
ohne alle Anwendung von Brennmaterial bewerkstelligt werden. Die Einleitung des
Gases und der Luft kann zu diesem Zweke so geschehen, wie es in dem
durchschnittlichen Aufrisse Fig.
22, und in dem horizontalen Durchschnitte Fig. 23 zu ersehen ist.
P ist die Roͤhre, in welcher das Gas von dem
Schmelzofen herbeigeleitet wird, und welche sich in der Ofenmuͤndung mit
einem breiten flachen Mundstuͤke endigt. In der Kammer der
Ofenmuͤndung laͤßt sich eine Reihe platter Roͤhren a, a, a anbringen, welche senkrecht gestellt und unten
gegen das Aschenloch hin, oben hingegen gegen den Ofen zu offen sind. Das Gas
gelangt durch die Roͤhre P in die Kammer, und
steigt zwischen den Luftroͤhren a, a, a in den
Ofen empor, waͤhrend gleichzeitig durch diese Roͤhren a, a, a Luft aus dem Aschenloche emporsteigt, sich mit
dem Gase vermengt, und dann durch eine Flamme entzuͤndet wird. Waͤre
noch eine groͤßere Menge Luft noͤthig, so koͤnnte diese durch
eine hoͤher oben angebrachte Oeffnung eingeleitet werden.
In Oefen, in welchen ein bestaͤndiges Feuer unterhalten werden muß,
laͤßt sich das Gas als Huͤlfemittel und zur Ersparniß an Brennmaterial
benuzen. Eine hiefuͤr passende Einrichtung erhellt aus dem durchschnittlichen
Aufrisse Fig.
24 und aus dem horizontalen Durchschnitte Fig. 25. Das Gas wird
hier in diesem Falle in der Roͤhre P unter den
Rost geleitet und mittelst mehrerer Roͤhren uͤber den oberen Theil der
Aschengrube verbreitet, von wo es dann in Folge des gewoͤhnlichen Zuges, der
durch die Aschengrube nach Aufwaͤrts Statt findet, emporsteigt. Der Gaszufluß
erheischt hier eine Regulirung, weil sonst der Zutritt der zur Verbrennung
erforderlichen Luft ein Hinderniß erfahren koͤnnte. Sollte man es fuͤr
geeigneter halten, das Gas uͤber dem Roste einzuleiten, so koͤnnte man
dasselbe durch die Roͤhre P* anstatt durch die
Roͤhre P eintreten lassen. In diesem Falle
muͤßte die Luft durch Oeffnungen eintreten, welche sich in unmittelbarer
Nachbarschaft der Muͤndung der Roͤhre P
befinden.
Manchmal ist es gut, die Gase vor deren Eintritt in den Ofen in einem eigenen
Gefaͤße mit Luft zu vermengen. Zu diesem Zweke kann man sich des in Fig. 26
ersichtlichen Behaͤlters bedienen. In den Ruͤken dieses
Behaͤlters waͤre naͤmlich die Gasrohre P und unter dieser die Luftroͤhre T
einzufuͤhren. Der Behaͤlter muͤßte zwei oder mehrere
Scheidewaͤnde, durch welche eine große Menge von Loͤchern gebohrt
waͤre, haben; und das Gas wuͤrde sich beim Durchgange durch diese
Loͤcher nothwendig mit der Luft vermengen. Das Gasgemisch koͤnnte
durch ein Rohr in den Ofen geleitet werden; durch dieses Rohr muͤßte aber ein
Sicherheitsgitter gespannt seyn, damit das brennende Gas nicht in den
Behaͤlter zuruͤktreten und daselbst explodiren kann.
Wenn man es zum Behufe des Schmelzprocesses nicht fuͤr noͤthig
haͤlt, daß das Gas mit bedeutender Gewalt eingetrieben und von Asche sowohl als von Dampf
gereinigt werde, so kann man es wohl auch direct aus der Roͤhre E,
Fig. 17, in
den Ofen treten lassen, wo dann der Wasserbehaͤlter H, das Kuͤhlgefaͤß L, L, die
Luftpumpe M, M und der Gasometer S wegbliebe. Zuweilen wird es gut seyn, wenn das Gas vor seinem Eintritte
in den Ofen mittelst irgend eines der bekannten Apparate erwaͤrmt wird.
Der Patenttraͤger bindet sich weder an bestimmte Formen, noch an bestimmte
Anordnungen der Theile, und behaͤlt sich in dieser Hinsicht beliebige
Modificationen vor.
Tafeln