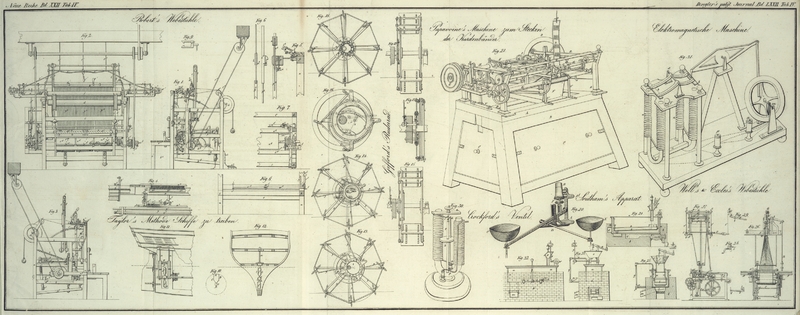| Titel: | Verbesserungen an den mechanischen und Handwebestühlen zum Weben von glatten und gemusterten Fabricaten, worauf sich William Wells, Maschinenbauer, und Samuel Eccles, Mechaniker, beide in Manchester, am 5. Jan. 1838 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. XLIII., S. 190 |
| Download: | XML |
XLIII.
Verbesserungen an den mechanischen und
Handwebestuͤhlen zum Weben von glatten und gemusterten Fabricaten, worauf sich
William Wells,
Maschinenbauer, und Samuel
Eccles, Mechaniker, beide in Manchester, am 5. Jan. 1838 ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1839, S.
355.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Wells's und Eccles's verbesserte Webestuͤhle.
Man sieht in Fig.
26 unseren Webestuhl von der Fronte und den dazu gehoͤrigen
Jacquard in einem Durchschnitte, waͤhrend Fig. 27 eine seitliche
Ansicht davon gibt. A, A ist das eiserne Gestell eines
gewoͤhnlichen mechanischen Webestuhles, wie man ihn dermalen zum Weben
leichter Stoffe verwendet. B ist die Haupttreibwelle und
das Kurbelrad; C die Daͤumlingswelle; D die Lade; E der Jacquard,
welcher von den Balken F, die in dem Mauerwerke fixirt
sind oder auch an dem Webestuhle befestigt seyn koͤnnen, getragen wird; G das sogenannte Griffbrett (grife or knife board) des Jacquard; H das
Kammbrett (comber-board); I die Bleie (lingers or leads); K der Riemen und der Hebel, der den Webestuhl in und
außer Bewegung sezt; L die Aufnahmsbewegung, der
Werkbaum etc. Wir haben alle diese bekannten Theile, die nicht zu unserer Erfindung
gehoͤren, hier nur deßwegen angedeutet, damit die von uns getroffenen
Vorrichtungen um so deutlicher erhellen. Hiezu gehoͤrt nun der an einem Arme
des Rades B befindliche Zapfen a und die von diesem an den Haupthebel N, der
seinen Drehpunkt in b hat, emporsteigende adjustirbare
Verbindungsstange M. Das kuͤrzere Ende dieses
Hebels, welches zwei Arme hat, erfaßt mit diesen, wie Fig. 27 zeigt, an den
Punkten 1 und 2 die Stange c. An denselben Punkten
befinden sich auch die zwei eisernen Gelenkstuͤke d, deren untere Enden die in dem Griffbrette G
fixirten Zapfen e erfassen, so daß dieses Brett also bei
jedem Umlaufe der Kurbel B abwechselnd emporgehoben und
herabgesenkt wird.
Um das Gewicht dieses Brettes sowohl, als auch jenes der Bleie auszugleichen,
bedienen wir uns der Gegengewichte O, welche an den
Hebeln P adjustirbar sind. Diese Hebel haͤngen
lose von den Zapfen e, e herab; und an ihren Enden sind
die Schnuͤre f befestigt, welche, nachdem sie
beinahe einmal um die excentrischen, an den beiden Enden der Welle R fixirten Rollen Q
gelaufen, daran festgemacht sind. An derselben Welle R
befinden sich auch die beiden kleinen Rollen g, und an
diesen sind die beiden Rinnen h befestigt, welche die Stange an den Punkten
1, 2 festhalten. Auf solche Art unterstuͤzen demnach die Gegengewichte O den Hebel N beim
Emporheben des Brettes G und der Bleie I.
Man wird bemerken, daß die Gegengewichte mit um so groͤßerer Kraft wirken, je
mehr sich die Schnuͤre f von dem Mittelpunkte der
Welle der excentrischen Rollen Q entfernen; und daß
sich, wie in Fig.
29 durch die Linie 3 angedeutet ist, die Schnuͤre dicht an dem
Mittelpunkte der Welle befinden, sobald die Kette und die Bleie sich im Ruhestande
befinden. Ein anderer Vortheil dieser Gegengewichte ist, daß sie in demselben
Augenblike, in welchem die Schuͤze ausgeworfen wird, ihre hoͤchste
Kraft ausuͤben, so daß also die zum Betriebe des Webestuhles erforderliche
Kraft auf die zwekmaͤßigste Weise vertheilt wird. Es gibt verschiedene
Methoden das Griffbrett emporzuheben; es duͤrfte aber die hier beschriebene
hinreichen, um einen Begriff von unserer verbesserten Methode das Gewicht des
Griffbrettes und der Bleie auszugleichen zu geben.
Der zweite Theil unserer Erfindung besteht in einer Methode den Webestuhl in
Stillstand zu bringen, sobald der Einschuß bricht oder die Spule leer ist. Es ist
naͤmlich i ein kleines, an der Welle c aufgezogenes Excentricum, welches auf den Hebel k wirkt. An dem langen Ende dieses lezteren ist ein
kleiner Riemen befestigt, der mit dem einen Ende nach Aufwaͤrts und
uͤber die Rolle m gefuͤhrt, mit dem
anderen hingegen nach Abwaͤrts und unter der Rolle n weg gefuͤhrt ist, so daß er gleichsam ein endloses Band bildet.
Dieses Band ist jedoch, wie man in Fig. 26 bei 4 und 5
sieht, durchgeschnitten, und an den Durchschnittsenden sind einige (z.B. 5 oder 6)
starke Schnuͤre angeknuͤpft, so daß immer noch ein endloses Band
gebildet ist. An diesen Schnuͤren befinden sich Oehren oder Maschen o, die nach Art von Lizen wirken. Durch diese Lizen ist
eine kleine, beilaͤufig aus 10 Faͤden bestehende Kette
gefuͤhrt, so daß sich, wenn dieselbe wie in Fig. 27 bei p, q geoͤffnet ist, fuͤnf Faͤden in
dem oberen und fuͤnf in dem unteren Blatte befinden. Diese Kette, welche ich
die Anzeigkette nenne, ist an dem Brustbaume befestigt, durch das Ende des
Rietblattes, hierauf durch die Maschen oder Lizen, und dann uͤber die kleine
Rolle r gefuͤhrt; endlich ist an ihrem Ende, um
sie in gehoͤriger Spannung zu erhalten, das Gewicht s aufgehaͤngt. Zur Seite des Webestuhles bei 6 sind zwei kleine
empfindliche, messingene Hebel t, u angebracht. Das
lange Ende des Hebels t ist durch eine entsprechende
Anzahl kleiner loser Faͤden v an den oberen Theil
der Anzeigkette gebunden, waͤhrend sein kurzes Ende durch einen kleinen Draht
mit dem Hebel u in Verbindung steht. An dem gebogenen
Ende dieses lezteren ist ein staͤhlerner Zapfen w
befestigt; sein anderes
Ende dagegen ist so belastet, daß er dadurch balancirt ist. X ist eine Aufhaltplatte, welche mit einer Stellschraube an dem Bande oder
Hebel K fixirt ist, und welche, wenn der Webestuhl in
Thaͤtigkeit ist, direct der kleinen, an die vordere Seite der Lade
geschraubten Platte Y gegenuͤber zu stehen kommt.
Das Spiel dieses Apparates geht nun auf folgende Weise von Statten. In dem Momente,
wo die Schuͤze in die Buchse, in welcher sich die Anzeigkette befindet,
eingetreten ist, suchen die Faͤden dieser Kette p,
q sich gegenseitig zu kreuzen, woran sie jedoch durch den zwischen ihnen
befindlichen Einschußfaden gehindert werden. Da folglich keine Einwirkung auf die
Hebel t, u Statt findet, so bleiben dieselben
unbeweglich, und der Zapfen w faͤhrt fort bei
jedem Schlage der Lade in die vorne an der Lade befindliche Vertiefung einzudringen.
So wie hingegen der Einschuß fehlt, veraͤndern die Faͤden der
Anzeigkette augenbliklich ihre Stellung; sie kreuzen sich, wo dann die oberen
Faͤden, indem sie das Ende des Hebels 2 mit sich ziehen, bewirken, daß der
Zapfen w herabgedruͤkt wird, wie dieß in Fig. 28 zu
ersehen ist. Er gelangt dann zwischen die vorne an der Lade befindliche Platte Y und die an dem Riemenhebel angebrachte Platte X, wo dann der leztgenannte Hebel durch die Kraft der
Lade aus der Stelle getrieben wird, und mithin der Stuhl zum Stillstehen kommt.
Der dritte Theil unserer Erfindung besteht in einer Methode das Aufnahmsgewicht durch
das Stehenbleiben des Stuhles von dem Welkbaume loszumachen. Dieß geschieht
naͤmlich mittelst einer an dem Ende des Riemenhebels K befestigten Stange Z, welche sich quer durch
den Webestuhl erstrekt, und mit einem an deren Ende befindlichen Loche die Schnur 7
erfaßt. Das eine Ende der Schnur ist zur Seite des Webestuhles festgemacht; das
andere dagegen an dem Daͤumlinge oder Sperrkegel 8. Wenn sich der Riemenhebel
in der durch eine punktirte Linie angedeuteten Stellung befindet, so wird der
Sperrkegel 8 auf dem Sperrade L aufruhen und folglich
thaͤtig seyn; erleidet er hingegen eine Ortsveraͤnderung, so wird der
Sperrkegel von dem Rade abgezogen und das Gewicht mithin außer Wirksamkeit
gesezt.
Diese unsere Erfindungen sind auf alle Webestuͤhle, sie moͤgen durch
Menschenhand oder durch irgend eine Triebkraft in Bewegung gesezt werden, und zur
Fabrication von glatten oder gemusterten Stoffen bestimmt seyn, anwendbar.
Tafeln