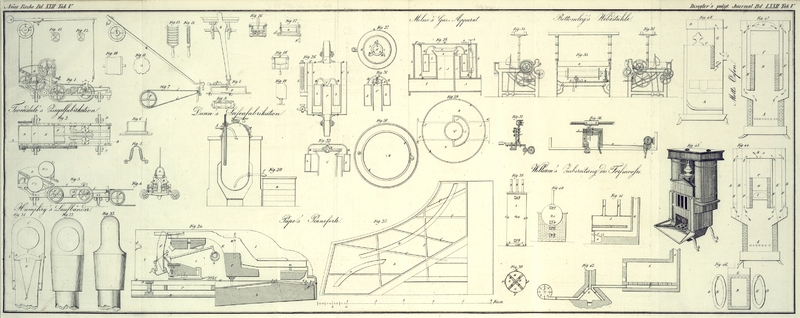| Titel: | Verbesserungen an den mechanischen und Handwebestühlen, worauf sich Edwin Bottomley, Tuchmacher von South Croßland in der Grafschaft York, am 13. Septbr. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. LVI., S. 270 |
| Download: | XML |
LVI.
Verbesserungen an den mechanischen und
Handwebestuͤhlen, worauf sich Edwin Bottomley, Tuchmacher von South Croßland
in der Grafschaft York, am 13. Septbr. 1838 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April 1839,
S. 219.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Bottomley's verbesserte Webestuͤhle.
Meine Verbesserungen an den mechanischen und Handwebestuͤhlen bestehen in
einem gewissen Mechanismus oder Apparate, welcher waͤhrend des Webens eine
mehr regel- und gleichmaͤßige Abgabe der Kette von dem Kettenbaume
bewirkt. Die Zeichnung, deren Beschreibung nun gleich folgen soll, wird diesen
Apparat versinnlichen.
Fig. 33 zeigt
einen Aufriß des Ruͤkens eines Stuhles fuͤr die Wollenweberei, an
welchem meine Verbesserungen angebracht sind.
Fig. 34 und
35 sind
seitliche Ansichten, aus denen die Stellung meines Apparates noch deutlicher
erhellt.
Fig. 36 ist
ein Grundriß meines Apparates.
Fig. 37 eine
seitliche Ansicht desselben in groͤßerem Maaßstabe gezeichnet.
Der Kettenbaum A hat seine gewoͤhnliche Stellung,
und traͤgt die Kette, welche von ihm aus uͤber die Leitwalze B laͤuft. Hinter dieser wird sie verwebt, wo sie
dann als Gewebe uͤber den Brustbaum C an den
Zeugbaum D gelangt. An der Welle E, E ist excentrisch ein Cylinder e, e
angebracht, den man am besten aus Fig. 36 sieht, und der
der Gabel f, f, welche ihn umfaßt, eine Hin- und
Herbewegung mittheilt. Der Arm oder die Verbindungsstange dieser Gabel ist mit einem
Zapfenloche oder einer Spalte ausgestattet, durch welche einer der Arme des
Winkelhebels g, g geht. An dem entgegengesezten Arme
dieses Hebels ist die Verbindungsstange H angebracht,
durch welche die Bewegung an den Hebel I, der sich an
dem Mittelpunkte der stehenden Welle K schwingt,
fortgepflanzt wird. Dieser Hebel I traͤgt einen
kleinen Zapfen, an dem das Getrieb l und auch das
Sperrrad M umlaͤuft. Die beiden lezteren sind
miteinander verbunden, und das kleine Getrieb l greift
in das an der Welle K fixirte Stirnrad N. An leztere Welle ist auch der Wurm O, der das Wurmrad P in
Bewegung sezt, angebracht, und auf diese Weise kommt folglich auch der Kettenbaum
A, an dem sich das Wurmrad P
befindet, in
Thaͤtigkeit. Durch das Umlaufen der Welle E wird
demnach dem Kettenbaume eine Abgabsbewegung mitgetheilt, welche mit der Zahl der
Schlaͤge der Lade in genauem Verhaͤltnisse steht, und welche
waͤhrend der ganzen Dauer des Webeprocesses dieselbe und eine
gleichmaͤßige bleibt. Da es jedoch offenbar ist, daß, so lange der Kettenbaum
gefuͤllt und mithin dessen Durchmesser ein groͤßerer ist, auch eine
groͤßere Menge Kette von ihm abgegeben werden wuͤrde, so muß die
Umlaufsbewegung desselben nothwendig in dem Maaße wachsen, in welchem sein Umfang
abnimmt. Denn nur auf solche Weise ist es moͤglich, daß bei jedem Schlage der
Lade, welches auch der Durchmesser des Kettenbaumes seyn mag, eine gleiche Menge
Garn abgegeben wird.
Die Zunahme der Geschwindigkeit des Kettenbaumes A
bewerkstellige ich nun auf folgende Weise. Eine kleine Walze aus Holz oder einem
anderen entsprechenden Materiale, welche in der Abbildung mit T bezeichnet ist, wird von einem senkrechten verschiebbaren Stuͤke
q, welches sich frei in einer Spalte des Gestelles
des Webestuhles bewegt, getragen. An diesem Schieber ist eine Zahnstange, welche
sich nach Abwaͤrts fortsezt, befestigt. Diese Zahnstange greift in ein
Getrieb r, welches an der Welle R aufgezogen ist. An dem entgegengesezten Ende dieser lezteren befindet
sich ein mit s bezeichnetes Getrieb, und dieses greift
in eine an dem verschiebbaren Wagen U angebrachte
Verzahnung. An derselben Welle R bemerkt man auch eine
kleine Rolle mit einer Schnur, an welcher ein Gewicht aufgehaͤngt ist, damit
auf solche Weise die kleine Walze T bestaͤndig
gegen die untere Seite der Kette angedruͤkt wird. Bei dieser Einrichtung kann
die Walze T in dem Maaße, als der Durchmesser des
Kettenbaumes in Folge des Verbrauches der Kette abnimmt, emporsteigen, woraus dann
eine Transversir-Bewegung des Wagens U in der
Richtung, welche in Fig. 36 durch einen Pfeil angedeutet ist, folgt. Der Wagen kommt hiedurch
dem Mittel- oder Stuͤzpunkte des Winkelhebels g, g naͤher, woraus fuͤr den entgegengesezten Hebelarm ein
groͤßerer Spielraum bei seinen Bewegungen folgt. Es entsteht also hieraus
eine groͤßere Schwingung des Hebels I, so daß
dieser mittelst des Faͤngers eine groͤßere Anzahl von Zaͤhnen
des Rades M erfaßt, und dadurch die Umlaufsbewegung des
Kettenbaumes A beschleunigt. An jenem Arme des
Winkelhebels g, g, der mit der Stange H in Verbindung steht, bemerkt man eine Reihe von
Loͤchern. Je nachdem man nun die Stange H mit
einem dem Mittelpunkte des Hebels naͤher liegenden oder weiter davon
entfernten Loche in Verbindung bringt, wird die Ausdehnung der Hebelsschwingung
groͤßer oder geringer seyn, woraus dann folgt, daß nach jedem Schlage der
Lade je nach der Beschaffenheit des zu webenden Fabricates, eine groͤßere oder
geringere Kettenmenge von dem Kettenbaume abgegeben wird.
Ich habe hier nur eine einzige Anwendungsweise meines Apparates und dessen Benuzung
an einer Art von Webestuhl gezeigt. Es versteht sich jedoch von selbst, daß eine
aͤhnliche Wirkung erlangt werden kann, wenn man die Zahnstange q in entgegengesezter Richtung spielen laͤßt, und
wenn man den Apparat an dem Werkbaume D anbringt. Alle
diese Modificationen haͤngen jedoch von der Beschaffenheit des zu webenden
Fabricates und von dem Ermessen des Webers ab.
Von allen den bekannten Theilen, welche der Deutlichkeit wegen in der Zeichnung mit
angedeutet sind, gehoͤrt keiner mit zu meiner Erfindung; ich erklaͤre
vielmehr als solche bloß den in Fig. 36 und 37
dargestellten Apparat, dessen Eigenthuͤmlichkeit hauptsaͤchlich in der
Art und Weise gelegen ist, auf welche der Grad der Schwingungen des Hebels I, von denen die Abgabe der Kette von dem Kettenbaume
A abhaͤngt, mittelst der Abnahme des
Durchmessers des Kettenbaumes waͤhrend des Webens regulirt wird.
Tafeln