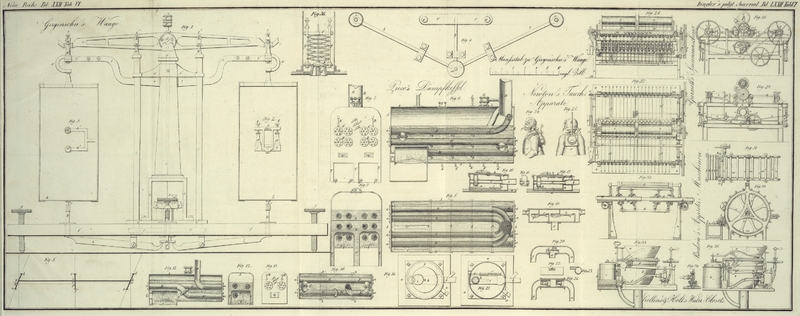| Titel: | Verbesserungen an den Tauchapparaten, worauf sich William Edward Newton, am Patent Office, Chancery Lane Nr. 66, Grafschaft Middlesex, am 19. Junius 1838 auf die von einem Ausländer erhaltenen Mittheilungen ein Patent geben ließ. |
| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. LXXI., S. 366 |
| Download: | XML |
LXXI.
Verbesserungen an den Tauchapparaten, worauf sich
William Edward
Newton, am Patent Office, Chancery Lane Nr. 66, Grafschaft Middlesex, am
19. Junius 1838 auf die von einem
Auslaͤnder erhaltenen Mittheilungen ein Patent geben ließ.
Aus dem London Journal of arts. April 1839, S.
1.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Newton's verbesserte Tauchapparat.
Die unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen Verbesserungen an den
Tauchapparaten bestehen aus zwei Theilen. Der erste und hauptsaͤchlichste
dieser Theile ist ein Gehaͤuse, durch welches die Luft, die dem Taucher,
waͤhrend er sich unter Wasser befindet, zugefuͤhrt wird, zu gehen hat,
und welches ich den Manometer nenne. Aufgabe dieses Gehaͤuses ist, dem
Taucher die Luft regelmaͤßig und gleichmaͤßig zuzufuͤhren, und
nicht stoßweise, wie dieß der Fall ist, wenn man sie direct mit einer Pumpe
eintreibt. Der zweite Theil besteht aus einem Apparate, durch den der Taucher athmen
soll, und der eine kleine Buͤchse mit zwei Ventilen vorstellt. Durch das eine
dieser Ventile, welches sich nach Innen zu oͤffnet, zieht der Taucher die zum
Athemholen noͤthige Luft ein; und daher reicht auch das Einathmen allein
schon hin, um dieses Ventil zu oͤffnen. Das andere, welches sich nach Außen
oͤffnet, wird durch das Ausathmen in Thaͤtigkeit gesezt; da die Kraft,
mit welcher die Luft aus den Lungen ausgestoßen wird, zum Oeffnen des Ventiles
vollkommen ausreicht.
In Fig. 14
sieht man den ganzen Manometer von Oben oder in einer horizontalen Ansicht. Fig. 15 ist
eine aͤhnliche Ansicht, an der jedoch der obere Theil oder der Dekel
weggelassen ist, damit die innere Einrichtung sichtbar wird. Fig. 16 ist ein
Querdurchschnitt durch die Mitte des Apparates, woran man den Manometer zum Theile
ausgedehnt, d.h. beinahe mit Luft gefuͤllt sieht. Fig. 17 ist eine
aͤhnliche Ansicht, wie Fig. 16, nur wurde hier
alle Luft an den Taucher abgegeben, so daß eine neue Quantitaͤt Luft aus der
Zufuͤhrungsroͤhre einstroͤmt. a, a
ist ein Stuͤk Brett, auf dem der Apparat mit Schrauben oder auf sonstige
Weise festgemacht ist. Die Zufuͤhrungsroͤhre b ist, wie die Zeichnung andeutet, an dem einen Ende mit dem Manometer und
an dem anderen mit einem oben im Boote befindlichen Luftbehaͤlter, in welchem
die Luft mittelst einer Pumpe sehr stark comprimirt wird, verbunden. Eine platte
Roͤhre, welche quer durch das Innere des Apparates laͤuft, ist an dem
einen Ende mit der Zufuͤhrungsroͤhre b, an
dem anderen mit der gegenuͤberliegenden Wand des Gehaͤuses in Verbindung gesezt. d ist ein eigens geformtes Ventil, welches die Luft in
das Innere des Gehaͤuses eintreten laͤßt, und welches ich
spaͤter beschreiben werde. Der Dekel e des
Gehaͤuses hat bei f ein Angelgewinde; sein
gegenuͤberliegendes Ende ist geschlossen, und wird mittelst eines aus
Kautschuk, Wachstaffet oder einem anderen geeigneten Materiale verfertigten
elastischen Ueberzuges g luftdicht schließend erhalten.
Dieser Ueberzug g ist an seinen Raͤndern an den
Seiten des Gehaͤuses festgemacht. Wenn die Luft in das Gehaͤuse
eintritt und den elastischen Ueberzug emportreibt, fuͤhrt sie den Dekel e mit sich, indem der Ueberzug zwischen den Dekel und
das Brett h geschraubt ist. Auf lezterem ist ein Gewicht
i befestigt, womit der Dekel nicht nur unbeweglich,
sondern zugleich auch die Luft im Gehaͤuse unter einem gelinden Druke
erhalten wird. Die Feder j befindet sich an dem Ende
einer gebogenen Stange k, deren anderes Ende durch
Schrauben mit dem Dekel e in Verbindung gesezt ist.
Diese Feder ist dazu bestimmt, den Dekel aufzuheben, wenn man dieß fuͤr
noͤthig erachtet. Zur Regulirung ihrer Spannung dient ein Stab l, in den an dem einen Ende eine Schraube geschnitten
ist, und der durch eine Schraube m aus dem
Gehaͤuse hinaus laͤuft.
Aus Fig. 18,
wo die platte Roͤhre c im Durchschnitte
abgebildet ist, sieht man das Ventil d. Dasselbe besteht
aus einer kurzen, an beiden Enden geschlossenen Roͤhre, in welcher zwei
Reihen runder Loͤcher angebracht sind, durch welche die Luft in deren Inneres
eindringen kann. Rund um das Ventil oder die Roͤhre d herum ist ferner, wie man aus Fig. 18 sieht, auf solche
Weise ein ringfoͤrmiger Canal gebildet, daß durch jedes der Loͤcher
der oberen Reihe Luft in das Innere der Roͤhre eintreten kann. Auch wird man
sehen, daß sich nur die obere Loͤcherreihe mit dem ringfoͤrmigen
Raͤume in Verbindung sezen laͤßt.
Das Spiel dieses Apparates ist nun folgendes. Der Taucher athmet durch die
Roͤhre o alle in dem Gehaͤuse enthaltene
Luft an sich; dadurch wird der Dekel e, da der Kraft des
Gewichtes i nichts im Wege steht, niedersinken; und die
Folge hievon wird seyn, daß der Dekel das Ventil d
herabtreibt, und also die obere Loͤcherreihe mit dem an der Roͤhre
befindlichen ringfoͤrmigen Raͤume in Communication sezt. Die in der
Zufuͤhrungsroͤhre herbeigelangende Luft wird dann durch die platte
Roͤhre herbeistroͤmen, durch die obere Loͤcherreihe eindringen,
und durch die untere Reihe in das Gehaͤuse entweichen. Die Luft, die
fruͤher unter einem bedeutenden Druke gehalten worden, wird sich nunmehr in
dem Gehaͤuse ausdehnen und den Dekel in die in Fig. 16 angedeutete
Stellung emportreiben. Die Feder p, welche gegen das
untere Ende des Ventiles d druͤkt, haͤlt
dasselbe mit dem Dekel des Gehaͤuses in Beruͤhrung.
Der zweite Theil der Erfindung besteht aus einem verbesserten Athmungsapparate,
welchen man in Fig.
19, 20 und in Fig. 21 in einem
Durchschnitte sieht. Fig. 22 zeigt das
Mundstuͤk einzeln fuͤr sich. Fig. 23 ist ein
Durchschnitt desselben. Die Roͤhre a, welche
fuͤr die frische Luft bestimmt ist, ist an ihrem anderen Ende mit der in Fig. 14, 15, 16
beschriebenen Roͤhre o verbunden; sie ist mit
einem entsprechenden Ventile, welches sich nach Innen oͤffnet, und welches
durch eine Spiralfeder geschlossen erhalten wird, versehen. Der Theil c, d des Apparates wird an dem Mundstuͤke
angebracht. Das Auslaßventil e oͤffnet sich nach
Auswaͤrts, und wird durch eine Feder f
geschlossen erhalten, ausgenommen beim Ausathmen, wo die hiebei ausgestoßene Luft
hinreicht, die Kraft dieser Feder zu uͤberwaͤltigen, so daß die
schlechte Luft durch die Roͤhre g entweichen
kann. Dieser Apparat kann, wie man aus Fig. 21 sieht, aus
mehreren Stuͤken, welche sich aus einander nehmen und zusammensezen lassen,
bestehen. So koͤnnen z.B. die Ventile aus zwei Stuͤken verfertigt
werden, welche sich in die Enden der gebogenen Roͤhren a, g einschieben lassen. Die Enden dieser Roͤhren lassen sich
mitsammt den in ihnen befindlichen Ventilen in das aus Fig. 22 ersichtliche
Ventil einschieben. Der Apparat kann aber uͤbrigens auch aus einem
Stuͤke bestehen, wie man ihn z.B. in Fig. 19 und 20 sieht.
Fig. 24 gibt
eine seitliche und Fig. 25 eine Ruͤkenansicht eines mit dem hier beschriebenen
Apparate ausgeruͤsteten Tauchers. a ist der
Manometer, welcher durch die Roͤhre b mit Luft
versehen wird. q ist der Athmungsapparat, der durch eine
vom Hintertheile des Kopfes hervorgefuͤhrte Binde mit dem Munde in
Beruͤhrung erhalten wird. g ist die Roͤhre
fuͤr den Austritt der schlechten Luft, welche so gebogen ist, daß, in welcher
Stellung sich der Taucher auch befinden mag, das Ende derselben doch nie zu oberst
kommt, und also nie eine Gefahr des Ertrinkens eintreten kann. Der Manometer ist an
einem Wamse befestigt, an dessen unterem Theile eine Art von Sak aus irgend einem
elastischen wasserdichten Zeuge angebracht ist. Die Roͤhre t ist an eine kleine, von der
Zufuͤhrungsroͤhre b auslaufende
Roͤhre b* geschraubt; sie theilt sich am Ende in
zwei kleine mit Haͤhnen versehene Roͤhren, von denen die eine mit dem
Inneren und die andere mit dem Aeußeren des Sakes r
communicirt. Das Rohr s dient zur Herstellung einer
vollkommenen Communication zwischen beiden Seiten des Sakes, und ist uͤber
die Schultern des Tauchers gefuͤhrt. Wenn man es fuͤr besser
haͤlt, kann man den Kopf des Tauchers auch ganz mit einem Helme umgeben, so daß
auch Nase und Augen gegen das Wasser geschuͤzt sind.
Ich brauche kaum zu bemerken, daß die hier beschriebenen Apparate mannigfache
Modificationen zulassen, ohne daß deßhalb von dem Principe derselben abgegangen
wird.
Tafeln