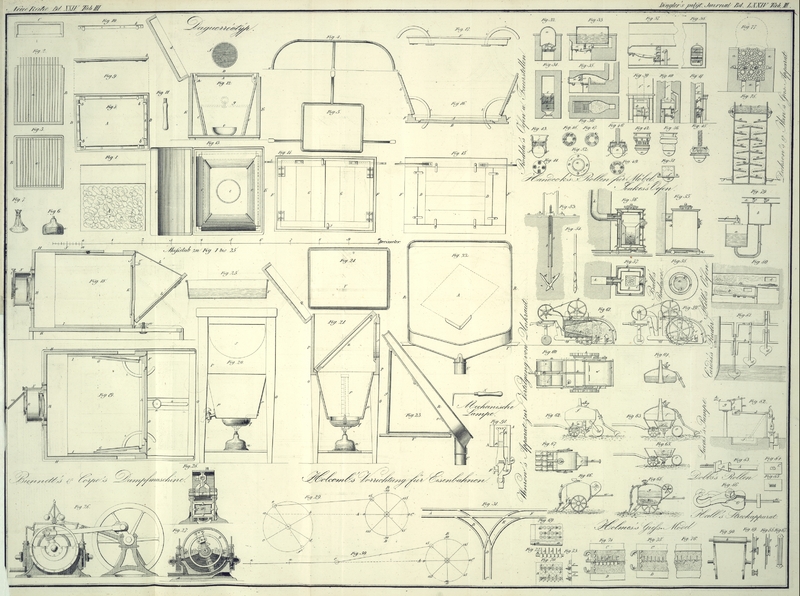| Titel: | Verbesserungen an den Oefen und Heizstellen, wodurch der Rauch verzehrt und an Brennmaterial erspart werden soll, und verbesserte Verwendung derselben zur Dampferzeugung, zum Schmelzen von Metallen und zu anderen Zweken, worauf sich Richard Rodda, Probirer in der Pfarre von St. Austle in der Grafschaft Cornwallis, am 7. Aug. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 74, Jahrgang 1839, Nr. XLIII., S. 181 |
| Download: | XML |
XLIII.
Verbesserungen an den Oefen und Heizstellen,
wodurch der Rauch verzehrt und an Brennmaterial erspart werden soll, und verbesserte
Verwendung derselben zur Dampferzeugung, zum Schmelzen von Metallen und zu anderen
Zweken, worauf sich Richard
Rodda, Probirer in der Pfarre von St. Austle in der Grafschaft
Cornwallis, am 7. Aug. 1838 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts. Sept. 1839, S.
392.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Rodda's verbesserte Oefen und Heizstellen.
Das Princip meiner Erfindung beruht auf gewissen Einrichtungen, welche ich an den
Oefen und Feuerstellen treffe, und deren gemäß der aus dem neu eingetragenen Brennmateriale sich
entwikelnde Rauch durch jenen Theil des Brennmateriales, der bereits am längsten und
lebhaftesten brennt, hindurch und unter der Flamme des später in Brand gerathenen
Brennmateriales weg oder durch dieselbe hindurch geleitet wird, damit die in dem
Rauche enthaltenen brennbaren Theilchen ganz oder zum Theil entzündet oder verbrannt
werden.
In Fig. 32,
33 und
34 sieht
man die Erfindung an einem Dampfkessel der gewöhnlichen Art angebracht; und zwar ist
Fig. 32
ein Querdurchschnitt durch die Feuerstelle mit einer Endansicht des Kessels; Fig. 33 ein
Längendurchschnitt der Feuerstelle und des Kessels, und Fig. 34 ein Grundriß oder
ein horizontaler Durchschnitt der Feuerstelle. a ist die
Feuerstelle mit den Roststangen b: c der gewöhnliche
Feuersteg. d, d sind zwei aus Walliser Steinen (Welsh lump) aufgeführte Wände, welche von dem Feuerstege
gegen die Ofenthür hin laufen, beiläufig 2/5 der Länge der Roststangen haben,
ungefähr 4 Zoll von den Seitenwänden der Feuerstelle entfernt sind, und zwei kleine
seitliche Feuerzüge e, e bilden. Diese Feuerzüge sind an
dem vorderen Ende offen, an dem Hinteren Ende dagegen durch den Steg, welcher an
dieser Stelle bis zu dem Boden des Kessels hinaufreicht, geschlossen. Die Wände d, d stehen an ihren oberen Seiten mit dem Boden des
Kessels vollkommen oder beinahe in Berührung, und werden an beiden Enden von
feuerfesten Baksteinen, welche auf den Roststangen ruhen, getragen, so daß je nach
der Größe der Feuerstelle zwischen der untern Seite der Wände und dem Scheitel der
Roststangen eine schmale Oeffnung oder eine Spalte von ungefähr 2 1/2 Zoll Tiefe
oder darüber bleibt. g ist ein an der Mündung der
seitlichen Feuerzüge e, e befindlicher Bakstein, welcher
das Eindringen von Asche und die Verlegung der Züge durch dieselbe hindert. h ist ein Bogen oder ein umgekehrter Feuersteg, welcher
aus Walliser Stein oder Eisen gebaut seyn kann, sich von einer der Wände d, d zur anderen erstrekt, und zwischen seiner unteren
Seite und dem Scheitel der Roststangen einen freien Raum oder Canal von 6 bis 8 Zoll
Tiefe läßt, während sein Scheitel mit der unteren Kesselwand ganz oder zum Theil in
Berührung steht. In diesem umgekehrten Feuerstege befindet sich eine Reihe von
Löchern m, m, m, die, je nachdem es erforderlich ist,
entweder offen gelassen oder mit feuerfestem Thone verstopft werden können. Ferner
befindet sich in oder über der Ofenthür ein mit einem Regulirventile ausgestattetes
Loch, durch welches, wenn es erforderlich ist, Luft in den Ofen eingelassen werden
kann.
Die Feuerstelle ist durch den Bogen oder den umgekehrten Steg h in zwei Theile oder Kammern n, o abgetheilt.
Die der Ofenthür zunächst gelegene Kammer n nenne ich die Feuerkammer
(fire-box), die dem Stege zunächst gelegene
Kammer o dagegen den Rauchverbrenner (smoke burner). Erstere enthält das neu oder zulezt
eingetragene Brennmaterial; leztere hingegen jenes, welches sich bereits am längsten
im Ofen befindet und in der lebhaftesten Verbrennung begriffen ist. Durch diese
Anordnung wird bewirkt, daß der aus dem frisch eingetragenen Brennmateriale sich
entwikelnde Rauch in die seitlichen Feuerzüge e, e
eintritt, durch die Spalten oder Oeffnungen f in die
Mitte des in dem Rauchverbrenner enthaltenen Brennmateriales gelangt, und unter der
Flamme, welche sich aus dem in der Feuerkammer befindlichen Brennstoffe entwikelt,
und welche unter dem Bogen weg in den Rauchverbrenner schlägt, hinweg oder durch
dieselbe hindurch geht, wodurch die in dem Rauch enthaltenen brennbaren Stoffe zum
größten Theil, wo nicht gänzlich, entzündet und verbrannt werden.
Ich habe hier meine Erfindung als an einem gewöhnlichen waggonförmigen Kessel
angebracht dargestellt; ich brauche kaum zu bemerken, daß sie auch auf Kessel von
jeder anderen Form anwendbar ist. Erinnern muß ich jedoch, daß da, wo die
Feuerstelle eine bedeutende Breite hat, die kleinen seitlichen Feuerzüge e, e, anstatt gerade zu laufen, unter dem Kessel und
zwischen gehörig angeordneten Wänden eine oder mehrere Windungen machen können, so
daß der Rauch und die erhizte Luft unter einer größeren Fläche des Kesselbodens
circuliren, bevor sie in den Rauchverbrenner gelangen. Ferner muß ich bemerken, daß
die Wände d, d und der Bogen h anstatt aus Baksteinen auch aus einem metallenen Gehäuse bestehen
können, welches an dem Kesselboden angebracht und durch gehörige Communicationen
zwischen dem höchsten Theile des Gehäuses und dem in dem Kessel befindlichen Wasser,
oder mittelst einer eigenen Speisungs- und Ableitungsröhre beständig mit
Wasser gefüllt erhalten werden kann.
In dem Längendurchschnitte Fig. 35 und in dem
horizontalen Durchschnitte Fig. 36 sieht man eine
ähnliche Anordnung an einem Schmelzofen getroffen. a ist
die Deke des Ofens; b sind die Roststangen; c der Steg; d, d zwei Wände
aus Walliser Steinen, welche sich in einer Entfernung von ungefähr 4 Zoll von den
Seitenwänden der Feuerstelle durch ungefähr 4/5 der Länge dieser lezteren von dem
Stege aus gegen die Ofenthür erstreken, so daß hindurch die beiden kleinen
seitlichen Feuerzüge e, e gebildet werden. Diese
Feuerzüge sind vorne zum Theil offen, an dem Hinteren Ende dagegen durch den Steg,
der hier bis zur Deke des Ofens hinaufreicht, geschlossen. Die Wände e, e werden an beiden Enden von Baksteinen, welche auf
den Roststangen aufruhen, getragen, und zwar so, daß zwischen der unteren Seite der Wand und dem
Scheitel der Roststangen eine Oeffnung oder Spalte f von
ungefähr 2 1/2 Zoll Tiefe bleibt. Die Scheitel der Wände stehen mit der Deke des
Ofens ganz oder zum Theil in Berührung. Quer über die Mündung der seitlichen
Feuerzüge ist ein Bakstein g, welcher der Verstopfung
derselben durch Asche vorbeugen soll, gelegt. Von einer der Wände d, d zur anderen erstrekt sich ein Bogen oder ein
umgekehrter Steg h, zwischen dessen unterer Seite und
dem Scheitel der Roststangen eine Oeffnung k von 6 oder
8 Zoll Tiefe gelassen ist, und dessen Scheitel ganz oder beinahe bis zur Deke des
Ofens hinaufreicht. m ist eines der kleinen, in dem
Bogen h befindlichen Löcher, welche je nach Umständen
entweder offen gelassen oder mit feuerfestem Thone verstopft werden können. Ferner
befindet sich auch in der Ofenthür oder über derselben ein mit einem Regulirventile
versehenes Loch, durch welches, wenn es Noth thut, Luft in den Ofen eingelassen
werden kann. Den zwischen dem Bogen h und der Ofenthür
befindlichen Raum n nenne ich auch hier wieder die
Feuerkammer; den zwischen dem Bogen und dem Stege c
befindlichen Raum dagegen nenne ich den Rauchverbrenner. Um lezteren leichter von
den Schlaken reinigen zu können, wende ich, anstatt daß ich durch die ganze Länge
der Feuerstelle eine einzige Reihe von Roststangen laufen lasse, zwei solcher Reihen
an: nämlich eine für, die Feuerkammer und eine für den Rauchverbrenner. Leztere seze
ich um 2 bis 3 Zoll tiefer ein als erstere; auch lege ich sie unter rechten Winkeln
mit ersterer oder quer durch die Ofenlänge. Endlich bringe ich außer dem Aschenloche
auch noch eine andere Oeffnung n an, welche sich bis zum
Scheitel der Spalte f oder um 2 bis 3 Zoll über den
Scheitel der Roststangen im Rauchverbrenner erstrekt.
Der Zwek dieser Einrichtung nun ist ganz derselbe wie der in Fig. 32, 33 und 34 angegebene; d.h. der
Rauch, welcher sich aus dem frisch eingetragenen Brennmateriale in n entwikelt, tritt in die seitlichen Feuerzüge e, e, hierauf durch die Spalten f mitten in das lebhaft brennende Feuer in o,
und dann durch die Flamme des Brennmateriales in n,
welche unter dem Bogen h hinweg in den Rauchverbrenner
o schlägt. Die Folge hievon ist, daß der Rauch
größten Theils oder gänzlich zersezt wird, indem seine brennbaren Theile der
Verbrennung unterliegen.Wir müssen bemerken, daß die Bezeichnung der Theile in Fig. 35 und 36 im
Originale selbst mangelhaft ist. A. d. R.
In solchen Fällen, wo sich wegen der verhältnißmäßig geringen Breite der Feuerstelle
nicht wohl seitliche Feuerzüge von der in Fig. 32 und 34
angedeuteten Art anbringen lassen, treffe ich bisweilen die aus Fig. 37 und 38
ersichtliche Einrichtung. Fig. 37 ist ein
Längendurchschnitt und Fig. 38 ein
Querdurchschnitt eines Theiles eines gewöhnlichen Dampfschiffkessels. a ist die Deke der Feuerkammer; b die Roststangen; c das Aschenloch; d der Feuerzug; e die
Scheidewand, welche das Aschenloch von dem Feuerzuge trennt, und auf welcher der
Steg f errichtet ist. In diesem Stege, der bis zur Deke
der Feuerkammer hinaufreicht, ist eine Anzahl von Löchern von geeigneter Form so
angebracht, daß der Steg das Brennmaterial zurükhält, dabei aber dennoch den Flammen
und der erhizten Luft ungehinderten Uebergang in den Feuerzug gestattet. Innerhalb
des Feuerzuges und in geringer Entfernung von der Scheidewand e ist ein zweiter Steg g, welcher die Flammen
und die erhizte Luft gegen die Deke des Feuerzuges dirigirt, errichtet. In der
Ofenthür ist ein mit einem Regulirventile ausgestattetes Loch, durch welches Luft in
den Ofen eingelassen werden kann, angebracht. Das Brennmaterial wird in dem Hinteren
Ende der Feuerkammer gegen den Steg zu beinahe bis zur Deke der Feuerkammer empor
angehäuft; und da der aus dem frischen Brennmateriale aufsteigende Rauch durch den
Zug der Flammen durch die Masse geleitet wird, welche sich an dem Stege in lebhafter
Verbrennung befindet, so werden die in ihm enthaltenen brennbaren Stoffe entzündet
und ganz oder zum größten Theil verbrannt. In dem unteren Theile der Scheibewand e bemerkt man auch eine Thür z, bei der alle die Asche, die allenfalls durch die in dem Stege f befindlichen Löcher gelangt seyn mochte,
herausgeschafft werden kann, und welche nöthigen Falles auch Zutritt zu dem
Feuerzuge gestattet. Der durchlöcherte Steg kann aus Metall bestehen; ich ziehe
jedoch vor, ihn aus Walliser Steinen oder feuerfesten Baksteinen aufzuführen.
Fig. 39 ist
ein Frontaufriß; Fig. 40 ein Längendurchschnitt; und Fig. 41 ein
Querdurchschnitt eines meiner Erfindung gemäß gebauten Stubenofens oder Kamines. a, a sind die Bodenstangen des Rostes; b die vorderen Stangen; c, c
die beiden Enden oder Seiten des Rostes, in deren einer sich eine Oeffnung befindet,
welche mit dem in den Schornstein f führenden Feuerzug
e communicirt. Die seitliche Oeffnung befindet sich
ungefähr in der halben Tiefe des Rostes, und ihr unterer Theil liegt mit den
Bodenstangen des Rostes ungefähr auf gleicher Höhe. Vor dieser Oeffnung ist ein Rost
oder eine durchlöcherte Platte 6, die aus feuerfestem Thone oder irgend einer
anderen geeigneten Substanz bestehen kann, angebracht. Ihre Aufgabe ist, das
Hineinfallen von Brennmaterial in den Feuerzug e zu
verhindern; und wenn ja einige kleine Theilchen desselben durch die Löcher der
Platte entschlüpfen sollten, so können sie bei dem kleinen Schiebethürchen g entfernt werden. An dem dem Feuerzuge e zunächst gelegenen Ende des Rostes befindet sich der
Kaminrüken oder die Herdwand h, welche ungefähr den
dritten Theil des Scheitels des Rostes bedekt, während der übrige Theil von der
beweglichen Platte K bedekt ist. Die schiebbare oder
auch eingehängte Thüre m verschließt den unter dem Dekel
k liegenden Theil der Fronte des Kamines; der übrige
Theil ist durch die Thüre n geschlossen. Unter jener
Stelle, an der sich der seitliche Feuerzug in den Schornstein öffnet, befindet sich
in dem Schornsteine selbst ein Dämpfer oder Register.
An diesem Kamine nun wird das Brennmaterial bei dem Dekel k eingetragen, und der in der lebhaftesten Gluth befindliche Theil
desselben an jenem Ende des Rostes angehäuft, welches mit dem seitlichen Feuerzuge
communicirt. Wenn der Dekel k geschlossen, das Register
o abgesperrt, und die Thüren m, n ganz oder zum Theile geschlossen sind, so wird der aus dem frischen
Brennmateriale aufsteigende Rauch auf seinem Uebergange in den Feuerzug s gezwungen, durch die an der durchlöcherten Platte
angehäufte Masse lebhaft brennenden Brennstoffes zu dringen, wodurch die in ihm
enthaltenen brennbaren Theile gänzlich oder großen Theiles verzehrt und verbrannt
werden. Stößt das Brennmaterial keinen Rauch mehr aus, so kann man die Thüren m, n öffnen, den Dekel k
abnehmen, und das Register o öffnen, wo dann der Kamin
zu einer offenen Heizstelle wird, und die heiße Luft in dem Schornsteine
emporsteigt. Ich habe zwar oben gesagt, daß der Feuerzug e mit dem einen Ende des Kamines communiciren soll; er kann aber eben so
gut auch mit dem Rüken, oder mit beiden Enden, oder mit dem Rüken und dem Ende
communiciren, wo dann dem gemäß durchlöcherte Platten oder Roste angebracht werden
müssen.
Als meine Erfindung erkläre ich: 1) die Verbindung des umgekehrten Steges h und der seitlichen Feuerzüge e,
e, auf die unter Fig. 32, 33, 34, 35 und 36 beschriebene Weise,
wodurch der aus dem frisch eingetragenen Brennmateriale aufsteigende Rauch gezwungen
wird, durch eine Masse lebhaft brennenden Brennmateriales und unter einer
Flammenschichte weg zu treten. 2) den in Fig. 37 und 38
ersichtlichen durchlöcherten Steg f, er mag für sich
allein oder in Verbindung mit dem zweiten Stege g benüzt
seyn. 3) für Stubenkamine die Feuerzüge e, sie mögen an
den Seiten oder am Rüken des Rostes mit dem unteren Theile des Rostes der
Feuerkammer communiciren, wenn dieselben mit Thüren oder Schiebern, welche den Rost
von Vorne und von Oben umschließen, in Verbindung gebracht sind. Was übrigens die
Form der Theile betrifft, so binde ich mich keineswegs an die in den Abbildungen
angedeuteten.
Tafeln