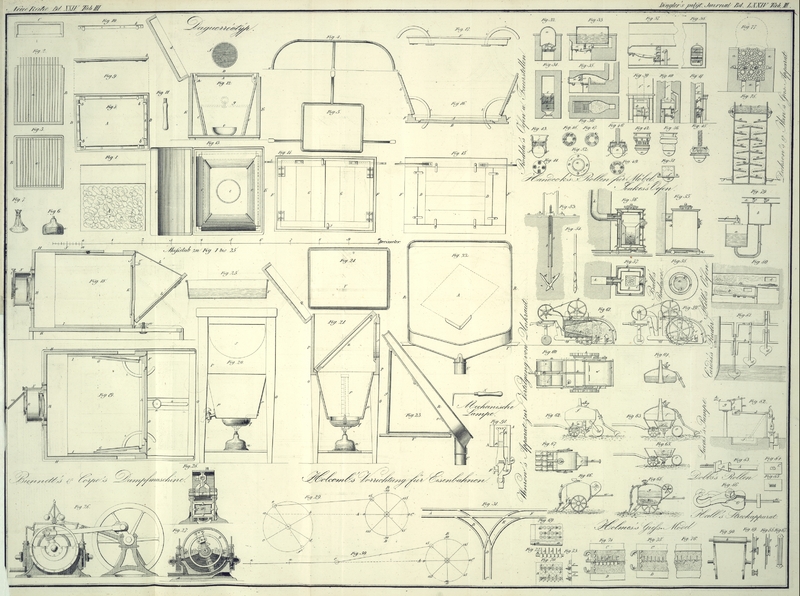| Titel: | Verbesserungen in der Gasbereitung aus Steinkohlen und anderen Substanzen, worauf sich Jonathan Dickson und James Ikin, beide in Holland Street in der Grafschaft Surrey, am 6. Februar 1838 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 74, Jahrgang 1839, Nr. XLV., S. 189 |
| Download: | XML |
XLV.
Verbesserungen in der Gasbereitung aus
Steinkohlen und anderen Substanzen, worauf sich Jonathan Dickson und James Ikin, beide in Holland Street in der Grafschaft Surrey, am 6. Februar
1838 ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem London Journal of arts. August 1839, S.
307.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Dickson's und Ikin's Verbesserungen in der
Gasbereitung.
Die Patentträger theilen ihre Erfindung in drei Abschnitte ein, von denen der erste
einen neuen Destillationsproceß der Steinkohlen; der zweite eine verbesserte Methode
das Gas zu reinigen, und der dritte eine neue Methode das Gas aus dem
Reinigungsapparate an den Gasometer zu leiten betrifft.
Was den ersten Theil der Erfindung betrifft, so besteht derselbe darin, daß die
Retorten auf eine solche Weise eingesezt werden, daß sie von allen Seiten mit
brennendem Brennstoffe umgeben sind. Der Unterschied zwischen der neuen und den
älteren bisher gebräuchlichen Methoden liegt darin, daß den lezteren gemäß die
Retorten einem sehr hohen Hizgrade ausgesezt sind, indem die Flammen gegen sie
anschlagen, und daß sie hiedurch in verhältnißmäßig kurzer Zeit der Zerstörung oder
Verbrennung unterliegen; während sie bei dem neueren Verfahren einen verhältnißmäßig
geringen Grad von Hize auszuhalten haben, indem sie ringsum von dem im Brande
befindlichen Brennstoffe umgeben sind.
Fig. 77 zeigt
den Apparat der Patentträger in einem Durchschnitte. a,
a ist das Mauerwerk; b, b, b die Retorten; c, c die Aschenlöcher; d, d
Röhren, durch welche Luft an das Brennmaterial strömen kann; e, e Röhren, durch welche man sich von dem Zustande des Brennmateriales
oder seiner Hize überzeugen kann, und in denen sich Löcher, welche Luft in das
Innere einleiten, befinden können. Oben über dem Apparate kann man, wie durch
punktirte Linien angedeutet ist, zu den weiter unten anzugebenden Zweken einen
Dampfkessel anbringen.
Fig. 78 ist
ein Durchschnitt des Reinigungs- und Kühlapparates. Derselbe besteht aus
einer fest gebauten eisernen Kammer, welche durch eine in die Mitte eingesezte und
an den beiden Enden des Apparates festgemachte Scheidewand in zwei Fächer abgetheilt
ist. Sowohl an dieser Scheidewand als auch an den Seitenwänden des
Reinigungsapparates sind Gesimse, durch welche Löcher gebohrt sind, angebracht. Oben
über dem Apparate befinden sich zwei Behälter b, c, von
denen ersterer bloßes
Wasser, lezterer dagegen Kalkwasser enthält. Beide Behälter communiciren durch die
Hähne d und o mit den
Reinigungskammern. Es erhellt demnach, daß, wenn der Hahn d geöffnet wird, Wasser aus dem Behälter b auf
das an der Seitenwand des Apparates befindliche Gesims a
fließen muß. Da dieses Gesims durchlöchert ist, so wird ein Theil des Wassers in
Form eines Regens durch dasselbe strömen, während ein anderer Theil über den Rand
des Gesimses fließt und auf das an der Scheidewand befestigte Gesims a herabfällt, um sodann von hier aus auf das
nächstuntere Gesims herabzufallen. Das Wasser wird somit fein vertheilt, bis es
endlich in den am Grunde des Apparates befindlichen Behälter gelangt, und von hier
aus wieder in den Behälter b emporgepumpt wird. Das
Kalkwasser fließt durch den Hahn s aus dem Behälter c aus, und fällt auf gleiche Weise von einem Gesims zum
anderen herab. Das zu reinigende Gas tritt durch die Röhre l ein und steigt im Zigzag in der durch punktirte Linien angedeuteten
Richtung durch den Apparat empor, um sodann, nachdem es über den Scheitel der
Scheidewand geströmt ist, an der anderen Seite in der Richtung des Pfeiles
herabzuströmen und endlich bei der Röhre g
auszutreten.
Fig. 79 zeigt
den dritten Theil der Erfindung, nämlich die Art und Weise, auf welche das Gas aus
dem Reinigungsapparate an den Gasometer geleitet werden soll. a, b sind zwei Kammern von gleichen Dimensionen, welche aus Eisen gebaut
sind und durch die Röhre c mit einander communiciren.
Die untere Kammer a wird beinahe mit Wasser gefüllt; die
Kammer b wird durch die Röhre d und das Ventil e mit Gas gefüllt; und wenn
dieß geschehen, so wird Dampf, der in dem über den Retorten angebrachten Kessel
erzeugt wird, durch die Röhre f eingeleitet. Der Dampf
treibt, indem seine Expansivkraft auf die Oberfläche des Wassers wirkt, lezteres in
die Kammer b empor, wodurch das Gas durch das Ventil g getrieben wird. In dem Maaße als der Dampf seine Kraft
verliert und verdichtet wird, kehrt das Wasser wieder in seine frühere Stellung in
der Kammer a zurük.
Tafeln