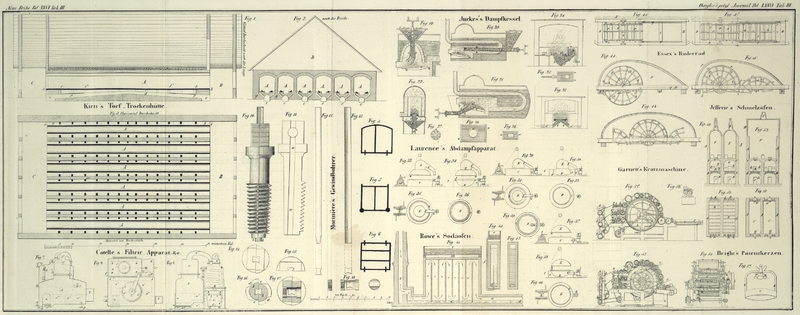| Titel: | Verbesserungen im Ausschmelzen von Kupfer und anderen Erzen, worauf sich William Jefferies, Raffineur in Holme-Street, Mile End, Grafschaft Middlesex, am 22. Mai 1839 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. XLVII., S. 193 |
| Download: | XML |
XLVII.
Verbesserungen im Ausschmelzen von Kupfer und
anderen Erzen, worauf sich William
Jefferies, Raffineur in Holme-Street, Mile End, Grafschaft
Middlesex, am 22. Mai 1839 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1840, S.
427.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Jefferie's Verbesserungen im Ausschmelzen von Kupfer.
Ich beabsichtige durch meine Erfindungen das Metall aus den Kupfer- und
anderen Erzen mit einem geringeren Aufwande an Kosten und von besserer Qualität zu
gewinnen, als es bisher nach den gewöhnlich gebräuchlichen Methoden möglich war. Sie
beruhen auf einem verbesserten Calcinir- oder Röstungsprocesse, auf einer
eigenen Zubereitung der Erze zum Behufe ihrer Schmelzung, und auf einer neuen
Einrichtung der Calcinir- oder Röstungsöfen. Ich will zuerst meinen neuen
Ofen beschreiben, und sodann das Verfahren, welches ich beim Ausschmelzen der Erze
befolge.
Fig. 49 zeigt
einen senkrechten Durchschnitt eines meiner Erfindung gemäß gebauten Ofens. Man
sieht hier zwei Röstkammern in einem Baue vereinigt; man kann aber ebenso gut auch
die Oefen nur aus einer einzigen, oder aus drei, vier und mehreren Kammern bestehen
lassen. Fig.
50 ist ein horizontaler, nach der Linie a, b
geführter Durchschnitt.
Fig. 51
ist ein ebensolcher, aber nach der Linie c, d geführter
Durchschnitt, aus dem man den Boden der oberen Kammer ersieht. Man kann diesen Oefen
irgend eine für zwekmäßig erachtete Form geben, d.h. man kann sie vierseitig, rund,
achtseitig oder anders geformt machen, obwohl ich die in der Zeichnung angedeutete
Form für die zwekmäßigste halte. Sie bestehen aus den Wänden A, A, welche auf die gewöhnliche Weise aus Bak- oder Bausteinen
aufgeführt werden, und sind durch die horizontalen Scheidewände oder Böden B, B, C, C in Kammern abgetheilt. Die Scheidewand B bildet das Dach des Aschenloches D und den Boden der Röstkammer E; die Scheidewand C bildet das Dach der
Kammer E und den Boden der oberen Kammer F. Der Rauch und die beim Rösten aus dem Erze
aufsteigenden Dämpfe entweichen durch die Oeffnungen G,
G. Die Dämpfe werden in den Kammern F
verdichtet, und die sich niederschlagende Schwefelsäure, so wie auch sonstige sich
absezende schwerere Theile der Dämpfe lassen sich in entsprechenden Gefäßen
aufsammeln, so daß also bei dieser Einrichtung das Entweichen dieser der Gesundheit
schädlichen Dünste verhütet wird. Das Dach der oberen Kammern F besteht, wie man in Fig. 49 sieht, aus einer
aus Bak- oder Bausteinen gebauten Wölbung, in welcher sich die Mündung der
Nauchfänge oder Schläuche, durch welche die unverdichtet gebliebenen Theile der
Dünste entweichen, befinden. Die Aschengruben D sind mit
Thüren J, J versehen, welche je nach dem Zuge, der
während des Röstprocesses im Ofen erforderlich ist, geöffnet oder geschlossen werden
können, und die auch zur Beseitigung der Asche und der aus den Oefen durchgefallenen
Erze dienen. Wie man sieht, sind die horizontalen Scheidewände B mit kleinen Löchern ausgestattet, damit zum Behufe der
Unterhaltung der Verbrennung des mit dem Erze vermengten Brennmaterials Luft aus den
Aschengruben D, D in die Kammern oder Oefen E, F eindringen kann. Ferner befinden sich an den
Kammern E Thüren K, K, bei
denen das frische Erz mit dem Brennmateriale eingetragen und auch das geröstete Erz
wieder herausgeschafft wird, wenn der Röstproceß zu Ende gediehen ist. Weiters sind
an diesen Kammern die kleinen Löcher L, L angebracht,
bei denen man den Gang der Operation beobachten kann, und die mit beliebig
verschließbaren Thürchen ausgestattet seyn müssen. Die aus den Oefen in die Kammern
F führenden Oeffnungen müssen mit Schiebern oder
Registern versehen seyn, damit sich der Austritt der Dämpfe aus dem Ofen beliebig
reguliren läßt.
Fig. 52 zeigt
einen senkrechten Durchschnitt durch zwei an einander gebaute Oefen, die jedoch nur
eine einzige gemeinschaftliche Verdichtungskammer F haben,
was für manche Fälle zwekmäßiger seyn kann. Das Dach C,
welches hier einen etwas anderen Bau hat, kann aus Eisen oder Baksteinen bestehen,
oder auch auf irgend andere geeignete Weise gebaut seyn.
Ich binde mich durchaus an keine bestimmte Form der Oeffnungen, welche zum Behufe des
Durchganges der Luft in den Böden der Röstkammern angebracht werden sollen; denn
diese Oeffnungen lassen sich sowohl dadurch erzeugen, daß man zwischen den zum Baue
der Deke bestimmten Baksteinen kleine Räume leer läßt, als auch dadurch, daß man
durch die Baksteine vor dem Brennen Löcher bohrt.
Ich gehe nunmehr zur Beschreibung des Processes über, den ich in diesen Apparaten
befolge. Ich nehme das rohe Erz in größeren oder kleineren Stüken, wie es an das
Schmelzwerk gebracht wird, und vermenge es zum Behufe der Röstung mit einer größeren
oder geringeren Menge Brennmaterial, wozu man Steinkohlen, Kohks oder Anthracit
wählen kann. Das Mischungsverhältniß wechselt von 100 bis zu 300 Pfd. Brennmaterial
auf eine Tonne Erz; je schwefelhaltiger das Erz, um so weniger Brennmaterial
erfordert es. Das Gemenge bringe ich in die Röstkammer E, in die vorher so viel Holz als zur Entzündung der Masse erforderlich ist,
geschafft worden seyn muß. Wenn das Ganze in Brand gestekt worden, überlasse ich es
einer langsamen Verbrennung, welche je nach der Qualität des Erzes 4, 5 oder 6 Tage
andauern muß. Nach beendigter Röstung nehme ich das Erz aus der Kammer, und vermenge
es, nachdem ich es vorher 3 bis 4 Tage lang oder darüber mit Wasser befeuchtet
liegen gelassen, mit einer gehörigen Menge Kalkes, roher Soda oder auch eines
anderen geeignet befundenen Alkali's. Dieses Gemenge lasse ich in befeuchtetem
Zustande je nach Umständen 3 Tage oder länger liegen. Von gewönlichem ungelöschtem
Kalke sind ungefähr 200 Pfd. auf den Centner Erz erforderlich; von der Soda braucht
man aber nur einen halben Centner auf die Tonne Erz. Nachdem diese Vorbereitungen
getroffen sind, kann das Erz in einem gewöhnlichen Schmelzofen ausgeschmolzen
werden. Man wird bei diesem Verfahren durch das Schmelzen ein viel reineres Metall
bekommen, als nach irgend einer anderen Methode.
Tafeln