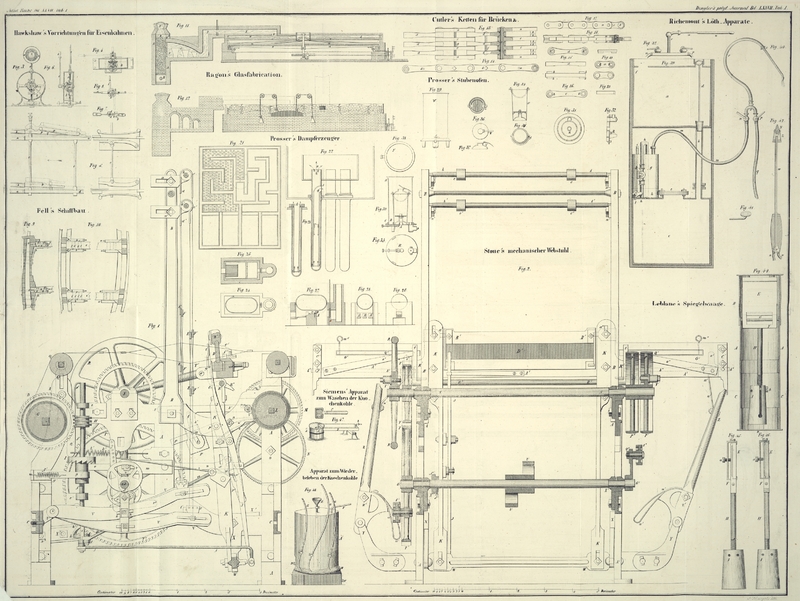| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication von Glas und anderen zu architektonischen Zweken verwendbaren verglasten Gegenständen, worauf sich Adolph Heinrich Ernst Ragon, Professor zu Middlesex, am 5. November 1838 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. X., S. 44 |
| Download: | XML |
X.
Verbesserungen in der Fabrication von Glas und
anderen zu architektonischen Zweken verwendbaren verglasten Gegenstaͤnden, worauf
sich Adolph Heinrich Ernst
Ragon, Professor zu Middlesex, am 5.
November 1838 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai 1840,
S. 237.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Ragon's Verbesserungen in der Fabrication von Glas.
Meine Erfindung betrifft: 1) ein Verfahren, nach welchem der Sand oder die sonstigen
zur Glasfabrication dienenden kieseligen Substanzen gereinigt werden sollen, bevor
man sie zum Glassaze verwendet, um auf diese Weise, wenn auch die übrigen zur
Glasfabrication gehörigen Stoffe gehörig gereinigt worden, der Erzielung eines
vollkommen reinen und farblosen Glases sicher zu seyn, und keines Mittels zu
bedürfen, welches die sonst zum Vorscheine kommenden Farben wieder aufhebt.
Sie betrifft 2) eine Methode, nach der man direct aus dem Schmelztiegel Glasplatten
gießen oder auf sonstige Weise formen kann, welche glätter und ebener ausfallen, als
nach den dermalen gebräuchlichen Methoden.
3) eine Modification des bei der Glasfabrication gebräuchlichen Ofens, wodurch die in
den Häfen befindliche Masse während der Schmelzung besser gegen zufällige
Verunreinigungen geschüzt, und zugleich auch die Hize besser regulirt wird.
4) eine Verbesserung des Kühlprocesses, der gemäß die Wärme des Schmelzofens zum
Kühlen des Glases verwendet werden soll.
5) endlich die Verwendung der Schlake der Schmelzöfen oder der Glasgalle zu
verschiedenen architektonischen Zweken.
Was den ersten Theil, nämlich die Reinigung der kieselerdehaltigen Substanz betrifft,
so beruht dieser darauf, daß ich diese Substanz auflöse, um dann das in ihr
enthaltene Eisen oder die sonstigen Unreinigkeiten so wegschaffen zu können, daß zum
Behufe der Vermengung mit dem Alkali und den übrigen Bestandtheilen des Glassazes
beinahe reine Kieselerde zurükbleibt. Die Kieselerde kann auf verschiedene Weise
aufgelöst werden; am passendsten scheint mir jedoch folgendes Verfahren. Man
vermenge Schwefelsäure, Flußspath und Kieselerde zu beinahe gleichen Theilen, und
erwärme dieses Gemisch in einer Retorte, die am besten aus Blei besteht, bis auf
einen Grad, welcher dem Blei keinen Schaden bringt. Es entwikelt sich hiebei
kieselflußsaures Gas, welches, wenn man es in Wasser leitet, reine Kieselerde
absezt, die dann durch Filtration, oder auf irgend eine andere Weise gewonnen werden
kann. Die rükständige Flüssigkeit, welche Kieselfluorwasserstoffsäure ist, gibt,
wenn man sie auf 41 Theile mit ungefähr 60 Theilen Kochsalzauflösung versezt und zur
Trokenheit eindampft, kieselflußsaures Natron, welches als Material zur
Glasbereitung dienen kann. Man kann übrigens auch einen Theil Quarzsand oder eine
andere kieselige Substanz mit drei Theilen Alkali oder gewöhnlicher Soda in einem
Tiegel bei einer mäßigen Rothglühhize calciniren, die geschmolzene Masse in Wasser
auflösen, und die klare, durch Filtration oder Abgießen von den aufgelöst
gebliebenen Unreinigkeiten abgeschiedene Flüssigkeit bis zur Trokenheit eindampfen,
um auf diese Weise kieselsaures Natron zu erlangen. Oder man kann, um reine
Kieselerde zu erhalten, diese mit Kalk oder Kalkwasser aus der Auflösung
niederschlagen. Beide Methoden mit einander in Verbindung gebracht, gaben ein
wohlfeiles Material.
Dem zweiten Theile meiner Erfindung gemäß gieße ich die flüssige Glasmasse, so wie es
gewöhnlich zu geschehen pflegt, auf eine polirte Metallplatte; anstatt jedoch das
ausgegossene Glas mit einer Walze auszubreiten, bringe ich eine Metallplatte darauf,
mit welcher die Glasmasse zu einer Platte von gewünschter Dike und Größe ausgepreßt
wird. Die Dike und die Dimensionen werden durch Streifen, welche man auf der unteren
Platte anbringt, und durch welche einem zu weiten Herabsinken der oberen Platte
vorgebeugt wird, hervorgebracht. Die Glasplatten fallen, wenn man die obere
Metallplatte bis zum Abkühlen derselben auf ihnen beläßt, viel ebener und glätter
aus, als sie durch das Walzen erzielt werden können; sie verursachen daher auch beim
Schleifen viel weniger Arbeit. Wäre die flüssige Glasmasse zu groß, als daß sie
durch das Gewicht oder den Druk der oberen Platte gehörig bezwungen werden könnte,
so müßte sich leztere in Falzen, welche in den Seitentheilen der unteren Platte angebracht sind, bewegen,
und unmittelbar hinter der dermalen gebräuchlichen Walze her folgen, damit sie das
Glas bis zu dessen Erstarrung comprimire und somit verhindere, daß sich die
Glasplatte werfe, was nur zu oft geschieht, wenn sie zu rasch der Einwirkung der
atmosphärischen Luft ausgesezt wird. Alle die hiezu erforderlichen mechanischen
Vorrichtungen sind zu bekannt, als daß ich auf eine weitere Beschreibung derselben
einzugehen für nöthig fände.
Die von mir an den Schmelzöfen angebrachte Verbesserung beruht darauf, daß ich die
Häfen so stelle, daß sie dem schwefelhaltigen Staube und anderen in dem
Brennmateriale enthaltenen Unreinigkeiten weniger ausgesezt sind, und daß die Hize
besser regulirt werden kann. Die Zeichnung wird deutlich machen, auf welche Weise
ich dieß bewerkstellige.
Fig. 11 ist
nämlich ein Längendurchschnitt, und Fig. 12 ein Aufriß meines
verbesserten Ofens, an welch lezterer Figur ein Theil des Schornsteines weggelassen
ist.
A ist der Ofen, welcher luftdicht seyn muß. B das geschlossene Aschenloch, in welches Gebläseluft
von solchem Druke eingetrieben wird, daß dadurch der erforderliche Hizgrad erreicht
wird. C ist die Kammer, in welche die Häfen oder Tiegel
eingesezt werden. D bezeichnet die Höhe, bis zu welcher
das Brennmaterial hinaufreicht. E ist ein geschlossener
Speisungstrichter; F ein Feuerzug, durch den die heiße
Luft in das Gewölbe des Kühlofens geleitet wird.
Die Verbesserungen, welche ich an dem Kühlofen anbrachte, ergeben sich gleichfalls
aus den Zeichnungen. a ist eine sich drehende Tafel aus
polirten feuerfesten Baksteinen, aus Stourbridge-Thon, oder aus irgend einem
anderen geeigneten, auf einer gußeisernen Unterlage befestigten Materiale. Diese
Tafel ruht auf Rädern, welche in einer im Kreise geführten Bahn oder Vertiefung
laufen; sie dreht sich dabei um eine Achse oder Welle b.
Ueber dieser Tafel nun ist das aus feuerfesten Baksteinen gebaute Gewölbe c unbeweglich angebracht. Dem von dem Ofen herlaufenden
Feuerzuge F entspricht ein zur Aufnahme der heißen Luft
bestimmter Canal d. Die Röhre e dagegen läßt die abgekühlte Luft entweichen. Der nach Abwärts gebogene
Rand der beweglichen Tafel, auf welche das Glas gelegt wird, tritt in eine
ausgetiefte mit Sand gefüllte Rinne, so daß sich die Tafel in dieser bewegen kann,
ohne die heiße Luft entweichen zu lassen. Wenn das Glas z.B. 15 Tage im Kühlofen zu
verbleiben hat, so muß die Tafel alle 24 Stunden um den fünfzehnten Theil ihres
Umfanges umgedreht werden, damit das Glas, welches zuerst in den heißesten Theil des
Kühlofens unmittelbar unter die Oeffnung oder den Feuerzug d gebracht wird, nach 15 Tagen an der kühlsten Stelle herausgenommen werden
kann. Dieser fünfzehnte oder irgend ein anderer der Zahl der Abkühltage
entsprechender Theil wird sodann unter den Feuerzug d
vorwärts bewegt, um daselbst zur Aufnahme von frischem Glase hinreichend erhizt zu
werden. Es läßt sich durch diese Einrichtung eine große Ersparniß an Brennmaterial
erzielen; denn es wird alle aus dem Schmelzofen entweichende Wärme zum Kühlen oder
Anlassen des Glases verwendet. Das Gewölbe des Kühlofens muß so dünn als möglich
gebaut und mit Sand bedekt seyn, damit man, je nachdem man die Sandschichte diker
oder dünner macht, an jedem Theile des Feuerzuges oder der Kühlstellen die
Wärmeausstrahlung je nach Erforderniß verhindern oder hervorbringen kann.
Was endlich die Verwendung der glasigen Schlaken der zum Schmelzen von Erzen
bestimmten Oefen zu architektonischen Zweken anbelangt, so beruht meine Erfindung
darauf, daß ich die flüssige Schlake aus den Oefen in Mödel von verschiedener Form
und Größe laufen lasse. Man kann entweder auf dem Boden oder auf dem Dekel dieser
Model, oder auf beiden zugleich verschiedene Dessins oder Figuren, die man in den
gegossenen Schlaken zum Vorscheine kommen lassen will, anbringen. Die Schlakenmasse
der Schmelzöfen, die bisher mit Kostenaufwand weggeschafft werden mußte, und
höchstens als Straßenbaumaterial verwendet wurde, erhält auf diese Weise eine sehr
mannichfache Nuzanwendung.
Tafeln