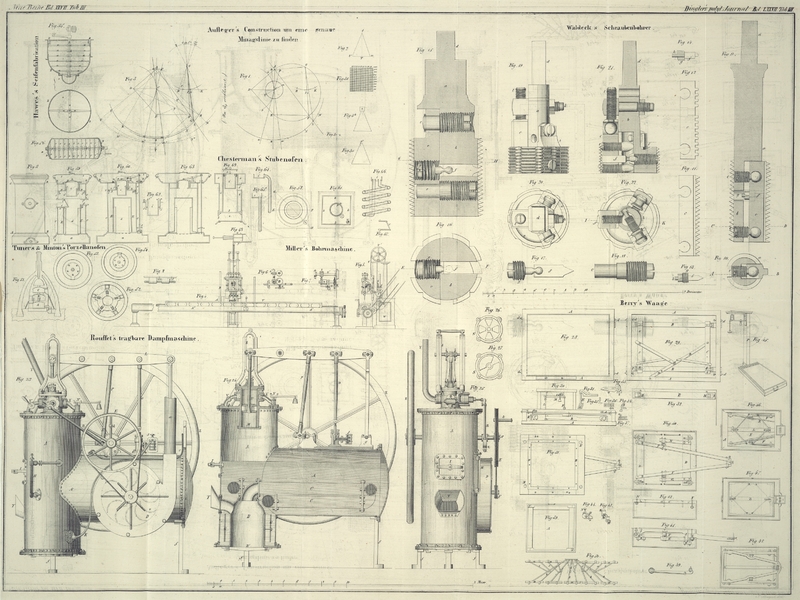| Titel: | Verbesserungen an den Stubenöfen, worauf sich William Chesterman, Civilingenieur in Barford in der Grafschaft Oxford, am 12. Nov. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. LVII., S. 231 |
| Download: | XML |
LVII.
Verbesserungen an den Stubenoͤfen, worauf
sich William Chesterman,
Civilingenieur in Barford in der Grafschaft Oxford, am 12. Nov. 1839 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Jul. 1840,
S. 4.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Chesterman's Verbesserungen an den Stubenoͤfen.
Die von mir an den Stubenöfen angebrachten Verbesserungen ergeben sich aus folgender
Beschreibung der beigefügten Zeichnung.
Es ist nämlich Fig.
57 ein Aufriß eines meiner Erfindung gemäß gebauten cylindrischen Ofens
mit vierekigem Boden und Scheitel.
Fig. 58 ein
horizontaler Durchschnitt desselben Ofens nach der in Fig. 57 angedeuteten
Linie A, B.
Fig. 59 ein
senkrechter Durchschnitt nach der in Fig. 58 angedeuteten
Linie E, F.
Fig. 60 ein
senkrechter Durchschnitt nach der in Fig. 58 ersichtlichen
Linie G, H.
Fig. 61 ein
horizontaler Durchschnitt nach der in Fig. 57 ersichtlichen
Linie C, D.
An allen diesen Figuren ist a die Basis oder Aschengrube
des Ofens, welche bei b mit einem Thürchen versehen ist.
Auf diese Basis a ist in gewöhnlicher Weise mit einem
Sandgefüge das cylindrische Gehäuse c aufgesezt. d ist die Feuerkammer, die innen mit feuerfesten
Baksteinen oder auch auf andere Weise ausgefüttert ist, und in der sich ein Rost
befindet, dessen Stangen entweder nach herkömmlicher Art, oder auch, je nachdem man
es für zwekmäßiger erachtet, beweglich eingesezt sind. Hart an dem oberen Theile der
Feuerkammer d, und zwar an den gegenüber liegenden
Seiten derselben sind beim Gusse oder auf sonstige Weise luftdicht die beiden Hülsen
L, M angebracht, wovon die eine zur Aufnahme der
Mündung e, die andere dagegen zur Aufnahme des
Feuerzuges f bestimmt ist. Die Feuerkammer d ist nicht nur an ihrem oberen Ende, sondern auch an
ihren Seitenwänden, mit Ausnahme der Stellen, an denen die erwähnten Hülsen in sie
einmünden, gehörig verschlossen; ihr unteres Ende dagegen ist auf dem Scheitel der
Basis a aufgesezt, wobei dieses Gefüge durch Sand oder
Cement luftdicht schließend gemacht ist. e, e ist die
Mündung, bei der das Brennmaterial in die Feuerkammer d
gebracht wird, und deren äußere Thüre auf gewöhnliche Weise verschlossen ist. Diese
Mündung paßt genau in die Seitenwand des Cylinders c und
in eine der angegebenermaßen an der Feuerkammer d
angebrachten Hülsen. In Fig. 67 sieht man diesen
Theil einzeln für sich abgebildet. f, f ist der
Feuerzug, welcher an der entgegengesezten Seite genau in den Cylinder o und in die Hülfe M
eingepaßt ist. An der inneren Wand des Cylinders c
bemerkt man einen vorspringenden Kranz g, in den eine
Platte h einfällt, welche leztere ungefähr 1/10 Zoll
hoch mit Sand bedekt wird, i ist ein cylindrisches
Wassergefäß, welches durch die Platte h sezt, und mit
einem Kranze j in die auf dieser Platte befindliche
Sandschichte eingesezt wird. k ist ein zweites Gefäß von
vierekiger Gestalt, welches mit dem Gefäße i aus einem
Stüke gegossen oder wenigstens wasserdicht an dasselbe gepaßt ist, und welches auf
dem oberen Rande des Cylinders c aufruht. Der Dekel l dieses Gefäßes k ist
mittelst eines Wassergefüges eingepaßt, und dieses Gefüge wird durch Verdichtung des
aus dem Gefäße k aufsteigenden Dampfes mit Wasser
versehen. In diesem Dekel l befindet sich ein Ventilator
m, durch den man, wenn es nöthig ist, Dampf in das
Zimmer entweichen lassen kann. Von dem Boden des Gefäßes k ragt unmittelbar über dem Gefäße i und
diesem entsprechend ein Ring n empor, in welchem sich,
wie Fig. 60
zeigt, bei o ein kleines Loch von ungefähr 1/8 Zoll im
Durchmesser befindet, damit zum Ersaze des durch die Verdampfung verloren gehenden
Wassers aus dem Gefäße k in das Gefäß i Wasser übergehen kann. p
ist eine umgekehrte Schale, die sich in dem Gefäße i
nach Art eines Gasometers oder Gashälters bewegt. Der Hebel q bewegt sich frei um seinen Drehpunkt, der sich an dem in dem Gefäße k befestigten Träger r
befindet. Das eine Ende dieses Hebels q ist an dem
Mittelpunkte des convexen Scheitels der Schale p
befestigt, das andere Ende dagegen ist an dem Draht s
festgemacht, der an eine horizontale Scheibe t läuft.
Diese leztere befindet
sich auf der Oeffnung u, durch welche die zur
Unterhallung des Feuers nöthige Luft in den Theil a
Zutritt erhält. Der Draht s läuft frei durch ein in dem
Ende des Hebels q befindliches Loch, ist aber durch eine
an seinem Ende angebrachte und auf der oberen Seite des Hebels q aufliegende Mutter verhindert, sich aus lezterem
auszuziehen. Von dem Boden des Gefäßes k ragt bis zu
gleicher Höhe mit dem Kranze n eine Röhre empor, welche
dem Drahte s einen freien Durchgang durch den Boden von
k gestattet, und zwar ohne daß Wasser aus dem Gefäße
k ausfließen kann, wie dieß der Fall wäre, wenn der
Draht bloß durch ein einfaches Loch liefe. In der aus der Zeichnung ersichtlichen
Stellung des Apparates ist die umgekehrte Schale p,
indem diese schwerer ist als der Draht und die an ihm befestigte Scheibe, in dem
Gefäße i niedergesunken, und die Scheibe t bis zu ihrer größten Höhe von der Mündung u aufgehoben. Wenn das Gefäß K und das Gefäß l beinahe bis zur Höhe des
Kranzes n mit Wasser gefüllt worden, wie in der
Zeichnung durch punktirte Linien angedeutet ist, und wenn in d ein Feuer aufgezündet worden, so wird das Wasser in i erhizt werden, und der aus ihm emporsteigende Dampf in
die Schale treten, wo dann diese sich nach Aufwärts bewegen wird, während der an dem
anderen Ende des Hebels q befindliche Draht s sich nach Abwärts bewegt, und dadurch den Zug durch
u verhindert. Wenn das Wasser eine Temperatur von
80° R. erlangt hat, so wird die Mündung u
gänzlich geschlossen seyn und der Apparat die in Fig. 60 durch punktirte
Linien angedeutete Stellung erlangt haben. In dem Scheitel der Schale P muß sich ein kleines Loch befinden, damit die in ihr
enthaltene Luft entweichen, sie selbst aber niedersinken und sich mit dem in dem
Gefäße i befindlichen Wasser füllen kann. So wie die
Temperatur des Ofens und des Wassers wegen verminderter Speisung des Feuers mit Luft
sinkt, wird die Schale p herabsinken, und durch ihre
Rükwirkung auf den Hebel q die Scheibe t empor heben, bis der Luftzufluß so groß geworden, daß
der Ofen gleichmäßig auf der gewünschten Temperatur erhalten wird.
Fig. 62 zeigt
eine andere Einrichtung des Wassergefäßes 1. Dasselbe hat nämlich hier einen zweiten
Ring n², und die Schale p taucht in das zwischen den beiden Ringen n
und n² enthaltene Wasser, welches durch das Loch
o von dem Gefäße R her
zufließt. Bei dieser Einrichtung ist in dem Wassergefäße i eine geringere Wassermenge erforderlich, was in gewissen Fällen
wünschenswerth seyn kann.
Fig. 63 zeigt
eine andere Form des Apparates, an der die Feuerkammer d
überall, ausgenommen am Grunde und da, wo die Mündungen sich befinden und die Feuerzugröhre eingesezt
ist, mit Wasser umgeben ist. Alle unter die Wasserlinie fallenden Gefüge müssen
daher hier wasserdicht seyn. Um das Wasser dem Feuer näher zu bringen und hiedurch
dem Spiele von p eine größere Empfindlichkeit zu geben,
kann man in das Wassergefäß i eine aus Fig. 64 zu ersehende
gebogene Röhre einsezen, deren senkrechter Theil zwischen der Feuerkammer und dem
äußeren Cylinder herabsteigt. Einer anderen Modifikation dieses Theiles gemäß kann
man in den Boden von i, wie Fig. 65 zeigt, eine
gerade Röhre einsezen, und das Gefäß i so weit aus dem
Mittelpunkte bringen, daß die erwähnte Röhre in den zwischen der Feuerkammer und dem
Cylinder befindlichen leeren Raum fällt.
Eine andere Einrichtung, die, wie mir scheint, dem fraglichen Zweke noch vollkommener
entspricht, erhellt aus Fig. 66. Dieselbe besteht
nämlich aus einer um die Feuerkammer gewundenen Röhre, deren beide Enden in das
Gefäß i einmünden. Diese Röhre kann auch von dem Ofen
aus in einem Zimmer herum geführt werden, bevor sie in den Behälter i zurükkehrt. Das in ihr circulirende Wasser wird die
Heizkraft des Ofens bedeutend erhöhen.
Fig. 67 zeigt
die Mündung e aus der Feuerkammer genommen einzeln für
sich und in einem Durchschnitte. Man sieht daran nach Oeffnung des vorderen
Thürchens eine cylindrische Röhre, deren inneres Ende schräg abfällt, und mit einer
Platte v, die sich an ihrem oberen Ende in Angeln bewegt
und sich vermöge ihrer eigenen Schwere schließt, versperrt ist.
Damit das Brennmaterial eingetragen werden kann und diese Röhre dennoch geschlossen
bleibt, soll man sich zu diesem Behufe der aus Fig. 68 ersichtlichen
Schaufel bedienen. Mit dieser wird das Brennmaterial nämlich in die Mündung
eingeschoben, bis der Vorsprung i an die vordere Seite
derselben anschließt, wo man dann mittelst des durch den Griff laufenden Stabes das
Brennmaterial von der Schaufel herab in die Feuerkammer d treibt. Die Platte oder das Ventil v gibt
hiebei nach, schließt sich aber jedesmal wieder, so oft der Stab zurükgezogen
wird.
Fig. 69 zeigt
einen Durchschnitt eines modificirten zum Kochen eingerichteten Ofens von meiner
Erfindung. Hier ist 1 die Aschengrube, deren Thürchen sich bei 2 befindet; 3 der
Rost; 4 ein Kessel oder Wasserbehälter, dessen innerer cylindrischer Raum mit Thon
ausgefüttert ist und die Feuerkammer bildet. Wenn man es zu gewissen Zweken für
geeignet findet, kann man diesem Kessel an seinem oberen Theile größere Dimensionen
geben, als an dem unteren Theile, der den Ofen bildet. Oben auf diesem Kessel und an
dessen Seiten können die
verschiedenen zum Kochen bestimmten Gefäße angebracht werden; 5 ist der Feuerzug; 6
das Wassergefäß, welches an seinem oberen Rande einen Vorsprung oder Kranz hat und
mit diesem in das Sandgefüge 8 einpaßt. Lezteres ist an der inneren Wand der
cylindrischen Oeffnung des Kessels und zwar in der Nähe ihres oberen Endes
angebracht. Der Dekel 9 paßt genau auf dieses Wassergefäß; er kann jedoch
abgenommen, und wenn man des Wassergefäßes nicht bedarf, durch einen Dekel 10 ersezt
werden, welcher jedoch gleichfalls in das Sandgefüge 8 eingesezt werden muß. Das
Brennmaterial wird bei der oben erwähnten cylindrischen Oeffnung eingetragen, wobei
jedoch entweder das Wassergefäß 6 oder der Dekel 10 abgenommen werden muß.
Ich binde mich durchaus an keine bestimmte Methode, die Bewegung der Schale zum
Behufe der Absperrung oder Eröffnung des Canales, in welchem die Luft dem Feuer
zuströmt, weiter fortzupflanzen. Eben so wenig binde ich mich an irgend eine
bestimmte Stellung des Wasserbehälters in Bezug auf das Feuer, vorausgesezt, daß die
Wärme auf gehörig wirksame Weise auf ihn einwirken kann. Endlich binde ich mich auch
an keine bestimmte Art von Ofen, in so lange als sie zur Aufnahme meines Apparates
geeignet ist. Mein Apparat erheischt durchaus keine bestimmte Form; doch dürfte sich
für den Behälter i und die Schale p die Cylinderform am besten eignen. Bemerken muß ich, daß die Schale p eben so gut der Einwirkung des Dampfes unterliegen
würde, wenn sie sich in einem glatten Gefäße ohne Leiste oder Kranz x bewegen würde; doch halte ich einen solchen Kranz für
zwekmäßig, um der Bewegung der Schale mehr Stätigkeit zu geben. Weder das Gefäß k, noch der Kranz n sind
eigentlich zum Spiel des Apparates wesentlich erforderlich; doch halte ich beide für
sehr nüzlich, indem sie einen Condensator oder einen Behälter für den aus i aufsteigenden Dampf, und zugleich auch einen Behälter
bilden, von dem aus dieses Gefäß mit Wasser gespeist werden kann.
Tafeln