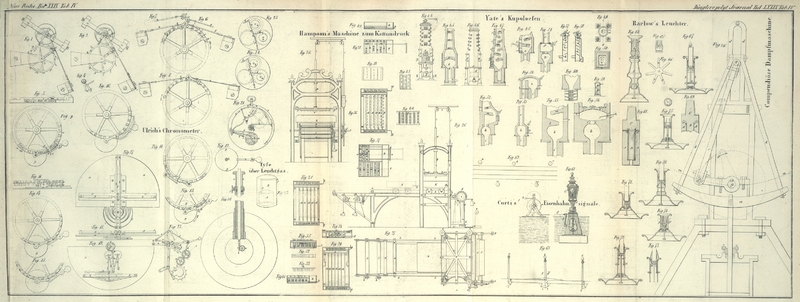| Titel: | Verbesserungen im Bau der Kupol- oder Windöfen zum Schmelzen der Metalle, auch anwendbar auf Hohöfen, die Kamine der Locomotiven etc., worauf sich James Yates, Eisengießer in Effingham Works, Rotherham in der Grafschaft York, am 1. Nov. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 79, Jahrgang 1841, Nr. LV., S. 264 |
| Download: | XML |
LV.
Verbesserungen im Bau der Kupol- oder
Windoͤfen zum Schmelzen der Metalle, auch anwendbar auf Hohoͤfen, die
Kamine der Locomotiven etc., worauf sich James Yates, Eisengießer in Effingham Works,
Rotherham in der Grafschaft York, am 1. Nov.
1839 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts. Nov. 1840, S.
146.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Yate's verbesserter Bau der Kupol- oder Windoͤfen zum
Schmelzen der Metalle.
Meine auf Kupolöfen anwendbaren Verbesserungen an Oefen bestehen:
Erstens in dem Bau des zur Aufnahme von Brennmaterial bestimmten Theils des Innern.
Die Einrichtung ist nämlich so getroffen, daß durch diese Construction das
Entweichen der Wärme, der nicht consumirten Luft, der Gasarten, Stäubfunken u.s.w.,
welche in gewöhnlichen Kupolöfen wegen ihrer offenen Gicht und Einsazöffnung frei
verstiegen können, verhindert wird. Diese Absicht erreiche ich auf folgendem Wege.
Ich bringe nämlich über dem Gestell und der Rast zum Behuf des Aufhaltens einen
Bogen oder eine Kuppel oder den Theil eines Bogens oder einer Kuppel in geringer
Entfernung von der Stelle an, wo das Brennmaterial und das Metall eingesezt wird.
Ich verschließe das Einsazloch durch eine Thüre oder auf sonstige Weise, und lasse
in dem Bogen oder auf einer oder mehreren seiner Seiten nur eine kleine Oeffnung,
groß genug, um diejenigen Gasarten, welche im Ofen nicht consumirt werden können,
entweichen zu lassen.
Meine Verbesserung besteht zweitens in der Anordnung einer Reihe von Bögen oder
Gesimsen, um das Entweichen der Gase mit noch größerem Erfolge zu verhindern; und
drittens in der Einführung eines Registers oder Dämpfers auf dem obersten Punkte
oder an einer andern Stelle des Kamins, um das Entweichen der Gasarten zu
reguliren.
Die Vortheile, welche ich dem gewöhnlichen Kupolofen mit offenem Kamin und offenem
Einsazloch gegenüber erreiche, beziehen sich auf die Zurükhaltung und Benüzung eines
großen Theils Wärme, welche im gewöhnlichen Kupolofen verfliegen würde. Durch die
Verwendung dieser Wärme unter Abhaltung der kalten atmosphärischen Luft, wird der
Schmelzproceß sehr beschleunigt, während er zugleich weit weniger Brennmaterial
erfordert. Da das Schmelzen weit rascher vor sich geht, und an einer weit höheren
Stelle, oder in einer größeren Entfernung von den Gebläsedüsen stattfindet, so wird viel Zeit erspart.
Außerdem ist der Abgang an Metall durch Oxydation um ein Beträchtliches geringer,
als im alten Kupolofen, wo das Schmelzen näher an der Gebläsemündung stattfindet,
und der Wirkung des Gebläses länger ausgesezt ist.
Zweitens findet auch eine beträchtliche Brennmaterial-Ersparniß während der
Intervallen des Schmelzens statt, wenn der Schmelzraum oder das Gestell des Ofens,
um die Hize zu unterhalten, mit Brennstoff gefüllt werden soll. In diesen Pausen
wurde im früheren Ofen eine Menge Wärmestoff dadurch consumirt, daß man ihn den
Einwirkungen der Atmosphäre aussezte, wogegen in dem verbesserten Ofen alles wohl
verschlossen ist, einen kleinen Theil des Zugloches ausgenommen. Durch ein solches
Verfahren wird die Hize zurükgehalten und nur wenig oder gar kein Brennmaterial
consumirt.
Drittens die Stäubfunken, welche aus dem gewöhnlichen Kupolofen zum großen Schaden
der ganzen Umgebung und zum Nachtheil des Betriebs sich erheben, werden in Folge
dieser Verbesserungen gänzlich consumirt oder durch die Gesimse aufgefangen.
Meine auf Blaseöfen zum Schmelzen der Erze anwendbare Verbesserung besteht erstens
darin, daß man den Bogen, die Kuppel oder den Bogentheil, den Kuppeltheil, über dem
Gestell und der Rast, und zwar nahe an demselben anbringt, um die Hize so viel wie
möglich beisammen zu halten.
Zweitens darin, daß man ein oder mehrere Gesimse am obersten Punkte oder über dem
genannten Bogen anbringt und das Erz darauf schüttet, um es unter Zusaz eines ganz
geringen Quantums an Brennmaterial, oder auch ohne denselben, den Wirkungen der
Hize, welche sonst unbenüzt verstiegen würde, auszusezen.
Dadurch, daß das Erz eine hinreichende Zeit lang der Hize ausgesezt worden ist,
gelangt es in einen Zustand der Vorbereitung fürs Schmelzen, welches nun weit
wirksamer vor sich geht, und wird in diesem Zustand von dem Heizer oder auf eine
sonst geeignete Weise entfernt. Alles Brennmaterial, oder der größere Theil
desselben wird direct in den Schmelzraum gebracht, ohne vorher den Einwirkungen der
Hize längere Zeit ausgesezt gewesen zu seyn.
Drittens in der Einführung eines oder mehrerer Register an der höchsten oder an einer
sonst geeigneten Stelle, um das Entweichen der Gasarten u.s.w. zu reguliren.
Die Vortheile, welche ich dem gewöhnlichen Hohofen gegenüber erreiche, der einen
hohen Schacht mit offener Gicht und ohne Unterbrechungen im Innern besizt, sind:
Erstens die Ersparniß einer großen Menge Brennmaterial, wenn der Ofen einmal in Betrieb ist,
indem er nur nahe an der erwähnten Wölbung gespeist zu werden braucht.
Zweitens die Ersparniß des ganzen oder beinahe des ganzen Brennmaterials, welches in
dem gewöhnlichen Ofen auf seinem Wege von der Gicht nach dem Schmelzraum verzehrt
wird.
Drittens die geringen Kosten und die kurze Zeit, welche erforderlich sind, um den
Ofen zum Behuf der Reparaturen u.s.w. auszublasen und wieder in Betrieb zu
sezen.
Viertens die geringe zur Erzeugung der Gebläseluft, welche nur eine niedrige Pression
zu besizen braucht, erforderliche Kraft, indem der Windstrom nicht durch so schwere
Massen sich Bahn zu brechen hat.
Meine auf Oefen und Kamine von Locomotiven und Schiffsdampfmaschinen u.s.w.
anwendbare Verbesserung besteht in der Anordnung von aufhaltenden Abtheilungen oder
Gesimsen im Innern solcher Kamine, Oefen oder Rauchfänge. Stäubfunken oder sonstige
Substanzen werden in Folge dieser Einrichtung consumirt, oder auf den Gesimsen oder
in eigens dazu vorgerichteten Behältnissen aufgefangen; und wenn man den Dampf in
den Rauchfang strömen läßt, so wird das aus den verdichteten Dämpfen erhaltene
Wasser verhindert, oben aus dem Rauchfang zu entweichen, und durch Canäle nach den
Gesimsen in die hiezu vorgerichteten Behältnisse geleitet. Um einen bessern Zug
herzustellen und zu verhindern, daß Windstöße von Oben in den Rauchfang dringen,
wende ich meine balancirende Schornsteinkappe an. Läßt man den Dampf durch eine
besondere Röhre und nicht durch den Rauchfang entströmen, so richtet man die
Auffanggesimse auf gleiche Weise, wie in dem Rauchfang ein, so nämlich, daß sie das
Entweichen des Wassers aus der oberen Mündung desselben verhindern.
Die Vortheile der obigen Verbesserung leuchten aus dieser Beschreibung ein.
Meine an Stubenöfen anzubringende Verbesserung besteht gleichfalls in der Anordnung
von Scheidewänden oder Gesimsen, welche ich in diesem Falle hohl mache, mit einer
Oeffnung, so daß ein Luftstrom durchziehen kann. Durch dieses Verfahren biete ich
der umgebenden Luft eine große erhizte Oberfläche dar, und die Folge hievon ist, daß
die Luft die Wärme, welche sonst in den Schornstein entweichen würde, mit sich
nimmt.
Meine Verbesserung an Oefen erstrekt sich auch auf die Verfertigungsmethode der
Ziegel, um ihnen die Fähigkeit zu ertheilen, den Einwirkungen einer intensiven Hize zu widerstehen.
Diesen Zwek erreiche ich auf folgende Weise.
Ich nehme den zu Feuerziegeln gebräuchlichen Thon und verarbeite ihn auf die
gewöhnliche Weise. Darauf bilde ich ihn zu dünnen Platten, Cylindern oder andern
Formen, so daß, wenn diese im Brennofen aufgeschichtet werden, die Hize einen
hinreichend freien Spielraum rings um dieselben findet. Diese Platten oder sonst
geformten Stüke dünnen Thons brenne ich in einem sehr hohen Grade und zermalme sie
darauf in Stüke von der Größe einer Erbse oder kleinen Bohne. Diese Stüke schütte
ich in starke Formen von der erforderlichen Gestalt und gieße eine dünne Mischung
aus einer kleinen Portion des besten Feuerthons mit Reiswasser angerührt hinein.
Lezteres bereite ich, indem ich den Reis eine geraume Zeit lang einweiche und ihn
gut koche. Wenn nun die gebrannten Thonstüke mit dem dünnen Brei in den Formen sich
befinden, so presse ich die Masse mit Hülfe einer kräftigen Presse hinein, und
brenne sie darauf bei einer sehr hohen Temperatur im Ofen.
Nachdem ich meine Erfindung hiemit beschrieben habe, gehe ich zur Erläuterung der
Zeichnungen über.
Fig. 44
stellt das Aeußere oder die Fronte des Kupolofens zum Schmelzen von Metallen dar,
von derjenigen Seite nämlich, wo er gespeist wird. f, f
sind gußeiserne Säulen, deren, wie der Grundriß zeigt, vier vorhanden sind; d, d ist der schmied- oder gußeiserne Mantel;
ich ziehe einen schmiedeisernen vor; e eine gußeiserne
auf den Säulen ruhende Platte, mit einem erhabenen Simswerk, welches eine Fuge
bildet, um den obern Theil der Ekplatten g, g zu tragen.
Leztere sind durch sieben Bolzen befestigt, a ist die
gußeiserne Thür, welche das Einsazloch verschließt. Diese Thür hängt entweder in
Angeln, um sie seitwärts zu öffnen, oder sie schwebt an Hebelquadranten, so daß sie
leicht senkrecht erhoben werden kann; von Innen ist sie mit Feuerziegeln bekleidet.
b ist eine zweite Einsazthür, welche benuzt wird,
während der Kupolofen im Gang ist. c, c, c sind kleine
dergestalt angebrachte Thürchen, daß eine Krüke oder Harke durch dieselben gestekt
werden kann, um den Staub an den Gesimsen wegzuschaffen. h ist das Register mit einer, zwei oder mehreren Klappen (ich ziehe vier
vor), an Hebeln balancirend. Diese Hebel stellen geneigte Ebenen dar, nöthigen den
Wind von jeder Seite abzugleiten, und verhindern ihn dadurch, abwärts zu blasen oder
auf das Innere des Kamins zu wirken. Die in der Figur sichtbaren runden Platten mit
Bolzen halten das Mauerwerk zusammen.
Fig. 45
stellt das Innere oder den Durchschnitt von Fig. 44 dar. n ist die Ausstichöffnung; i
das Gestell; k die Rast, in welche das Metall mit dem Brennmaterial
eingeschüttet wird; l der erste Auffangbogen; m, m, m andere ähnliche Bögen oder Gesimse; i*, i* die Formen, durch welche der Gebläsewind in den
Schmelzraum gelangt.
Fig. 46 zeigt
eine andere äußere oder Seitenansicht des Ofens; gleiche Buchstaben beziehen sich
auf die entsprechenden Theile in Fig. 44 und 45; d der Mantel; m das
Einsazloch; f, f die Säulen;
e die Platte, worauf das Mauerwerk ruht; g, g
die Ekplatten.
Fig. 47
stellt einen andern Durchschnitt nach der Linie c, d,
Fig. 49, dar,
wobei die gleichen Buchstaben sich auf dieselben Theile, wie in Fig. 44, 45 und 46 beziehen. i der Schmelzraum oder das Gestell; k die Rast oder der Ofen; I der erste
Auffangbogen; m, m, m, m, m, m andere Auffangbögen oder
Gesimse; a die Thür, welche das erste oder größere
Einsazloch verschließt; b die Thür, welche das zweite
oder kleinere Einsazloch verschließt; c, c, c Thüren zum
Verschließen der Oeffnungen, durch welche die Gesimse gereinigt werden.
Fig. 48 zeigt
das Innere mit einer von Fig. 47 abweichenden
Anordnung. Der Auffangbogen ist nämlich umgekehrt, und das kleinere Einsazloch so
gelegen, daß das Material neben dasselbe geschüttet werden kann, um die entweichende
Wärme aufzunehmen. Auf diese Weise gelangt das Material besser vorbereitet in den
Ofen. Fig. 49
ist ein horizontaler Durchschnitt, quer durch x, x,
Fig. 44; f, f, f, f sind die Säulen; d,
d der Mantel; i das Gestell; n die Ausstichöffnung.
Fig. 50 ist
ein anderer horizontaler Durchschnitt durch y, y,
Fig. 44; i das Gestell; k die Rast;
a die Thür; e, e die auf
den Säulen ruhende Platte, worauf das Mauerwerk steht.
Fig. 51
stellt eine andere Einrichtung des Innern dar; i das
Gestell; k die Rast ohne Einsazthür; l, l der Auffangbogen mit einer kleinen Oeffnung in der
Mitte, durch welche das Material eingeschüttet wird, nachdem es in dem obern
Ofenraum p der Hize ausgesezt worden war.
Fig. 52 eine
weitere Anordnung mit oberhalb dem Schachte befindlichen Ofenräumen.
Fig. 53 zeigt
einen einzigen Auffangbogen, eine Kuppel, oder den Theil eines Bogens mit einer
kleinen Oeffnung in der Mitte und einem engen Kamin r;
lezterer bedarf keiner Auffangbögen oder Gesimse. Diese Construction ist zwar
billiger als die übrigen; aber auch geringer als dieselben.
Fig. 54 zeigt
den Ofen mit einem Auffangbogen und horizontalem, durch
punktirte Linien angedeutetem oder abwärtsgehendem Rauchfang t; jeder dieser Rauchfänge kann in einiger Entfernung nach irgend einem
Schachte hingeleitet werden.
Fig. 55
stellt das Innere eines Ofens mit großen Dimensionen dar, welcher sich insbesondere
zum Schmelzen der Erze eignet. Das Gesimse über dem Aufhaltbogen l ist der Ort, auf welchen das Brennmaterial geschüttet
wird, und das obere Gesimse m – oder so viele
derselben erforderlich seyn mögen – ist zur Aufnahme des Erzes bestimmt,
welches den Wirkungen der ausströmenden Hize ausgesezt werden soll; z ist eine Oeffnung, durch welche der Heizer
manipuliren kann. Dieser Ofen besizt ein Register zur Regulirung des Zugs.
Fig. 56 zeigt
eine andere Ansicht des Innern eines Ofens zum Schmelzen der Erze. Hier befindet
sich unmittelbar über dem ersten Auffangbogen l, l ein
geräumiger Ofen, um das Erz, bevor es in den Hauptschacht k gelangt, zu erhizen und vorzubereiten; v, v
sind Oeffnungen in dem oberen Gewölbe, durch welche das Material von den Gesimsen
her gelangt; diese Oeffnungen, deren Anzahl, je nachdem man es für zwekmäßig findet,
vermehrt werden kann, sind mit Dekeln versehen, um das Entweichen der Hize zu
verhindern. Ueber dem Centrum oder Gestell befindet sich eine Oeffnung w, durch welche das Brennmaterial, oder der größte Theil
desselben direct in den Hauptschacht k geschüttet wird;
u, u sind Oeffnungen für die Schüreisen; diese
Schüreisen gleiten, wie bei u* sichtbar ist, durch
Kugeln, welche in Hülsen sich bewegen; r, r sind Kamine
mit Registern, um das Entweichen der Gasarten zu reguliren. Die Anzahl dieser Kamine
kann erhöht werden.
Fig. 60 zeigt
den unteren Theil eines Ofens zum Schmelzen des Metalls, oder Erzes, oder zu anderen
Zweken, mit einer Reihe von senkrechten, am Boden oder nahe am Boden gegen das
Innere zu schräg abwärts gehenden Oeffnungen. Anstatt eines durch Maschinenkraft
gepreßten Luftstromes dringt die Luft durch diese Oeffnungen vermöge des äußeren
atmosphärischen Druks. Die zuzulassende Menge kann mit Hülfe eines Schiebers
regulirt werden. Die hier beschriebenen, eben so auch die für andere Oefen
dienlichen Oeffnungen dieser Art, verfertige ich in starken Ziegelformen auf die
oben erläuterte Weise.
Ich beschränke mich übrigens nicht auf die im Vorliegenden dargestellten Ofenformen
insbesondere, sondern beziehe mich auf das unten angegebene Princip.
Fig. 57 ist
der Durchschnitt eines Rauchfanges mit balancirender Schornsteinkappe für
Locomotive, Schiffsdampfmaschinen, oder irgend einen andern Rauchfang, in welchem
meine Auffanggesimse b, b, b, b,... angebracht werden,
um den Funkenstaub oder sonstige Substanzen, desgleichen condensirte Dämpfe
aufzuhalten oder aufzufangen, und ihr Entweichen aus dem Rauchfang zu verhindern.
Die Kappe f ruht oben auf einem abgerundeten Hals h und wird durch die Kugel g
in der Balance erhalten.
Der geringste Windstoß preßt die dem Winde entgegenstehende Seite dicht an den
Rauchfang, so daß auf der andern Seite eine Oeffnung entsteht, und der Wind
gehindert ist, in den Rauchfang von Oben einzudringen.
Fig. 58 ist
der Durchschnitt eines Rauchfangs, welcher die Auffanggesimse so angeordnet zeigt,
daß Staub oder Wasser herabgleiten und in dem Behälter d
abgesezt werden kann.
Fig. 59 zeigt
den Durchschnitt eines Stubenofens mit meinen hohlen Auffanggesimsen; e ist die Feuerstelle; b, b, b,
b sind die Auffanggesimse; c das
Abzugsrohr.
Ich erkläre als meine auf Kupolöfen zum Schmelzen der Metalle anwendbare Erfindung,
erstens den Auffangbogen oder das Auffanggewölbe, oder den Theil eines
Auffangbogens, eines Auffanggewölbes. (Dieses kann für sich allein in Anwendung
kommen, ohne irgend eine andere von meinen Verbesserungen.) Zweitens den Verschluß
des Einsazloches durch eine Thür oder auf andere Weise. (Auch dieser Theil kann
allein, ohne irgend eine andere von meinen Verbesserungen angewendet werden.)
Drittens das Einsezen über dem Bogen oder Gewölbe. Viertens die Reihe zurükwerfender
oder auffangender Bögen oder Gesimse. Fünftens das regulirende Register in irgend
einer Form oder Stellung, mit einer, zwei oder mehreren Klappen.
Als meine Erfindung in Anwendung auf Kupolöfen zum Schmelzen der Erze erkläre ich:
erstens den Auffangbogen unmittelbar über oder in geringer Entfernung von der Rast.
Zweitens das Gesimse oder die Gesimse über den genannten Auffangbogen; deßgleichen
die Reihe von Auffangbögen oder Gesimsen.
Als meine auf die Rauchfänge der Locomotiven, Schiffsdampfmaschinen u.s.w. anwendbare
Erfindung erkläre ich die Auffanggesimse mit oder ohne aufstehende Ränder, um das
von verdichteten Dämpfen herrührende Wasser aufzufangen und fortzuleiten und um das
Entweichen der Stäubfunken zu verhindern; ferner die balancirende
Schornsteinkappe.
Ich erkläre als meine auf Stubenöfen anwendbare Erfindung das oder die hohlen
Auffanggesimse.
Ferner die Reihen verticaler nahe am Boden der Schmelzöfen befindlichen Schlize oder
Oeffnungen, welche abwärts gegen das Gestell zulaufen; endlich die Anwendung der auf
die oben beschriebene Weise verfertigten Ziegel, auf die Construction der Oefen.
Tafeln