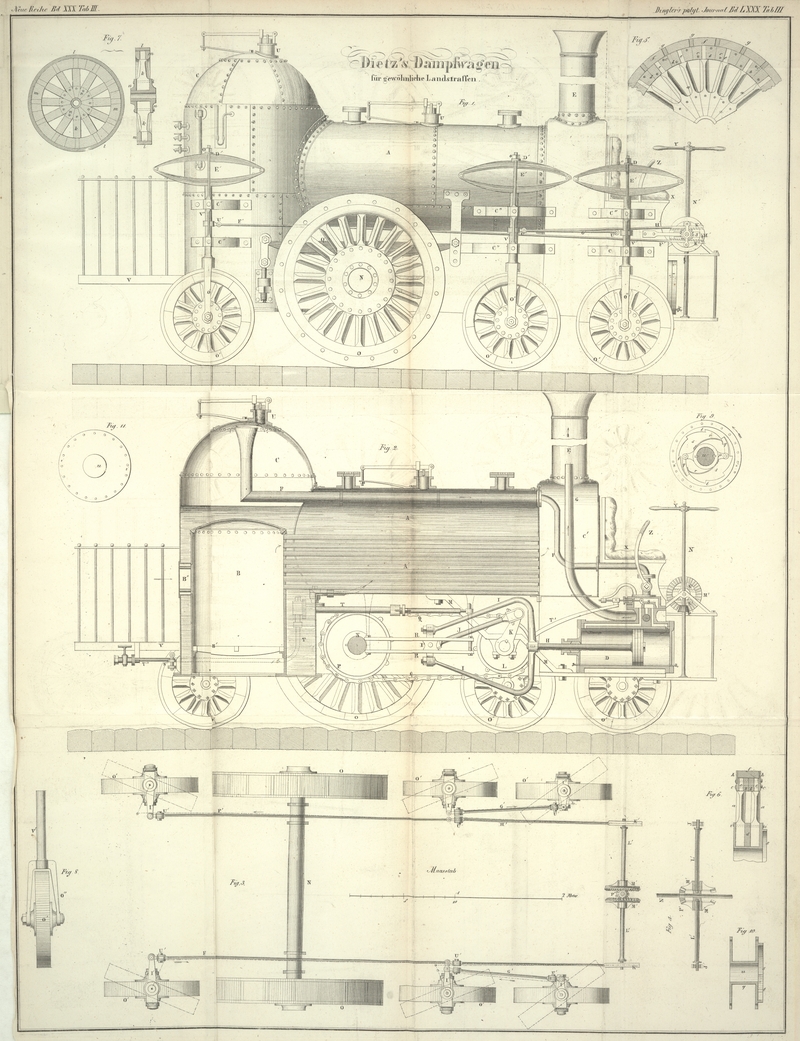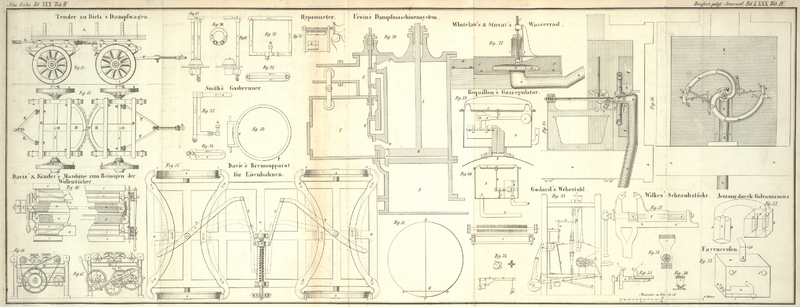| Titel: | Beschreibung des Dampfwagens für gewöhnliche Straßen, welcher von Hrn. Ch. Dietz, Mechaniker in Paris, rue de Marboeuf No. 11, erfunden wurde. |
| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. XVI., S. 81 |
| Download: | XML |
XVI.
Beschreibung des Dampfwagens fuͤr
gewoͤhnliche Straßen, welcher von Hrn. Ch. Dietz, Mechaniker in
Paris, rue de Marboeuf No. 11,
erfunden wurde.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement. Jan. 1841, S. 5.
Mit Abbildungen auf Tab.
III und IV.
Beschreibung des von Dietz erfundenen Dampfwagens fuͤr
gewoͤhnliche Straßen.
Der Dampfwagen für gewöhnliche Straßen von Hrn. Ch. Dietz,
über welchen Hr. Olivier einen günstigen Bericht (im
polytechn. Journal Bd. LXXIX. S. 401)
erstattete, besteht in der Hauptsache aus zwei Dampfcylindern, welche mit einem
Röhrendampfkessel nach Art derjenigen, wie sie bei Locomotiven auf Eisenbahnen
angewendet werden (jedoch mit kreisrundem Feuerraum) verbunden sind. Die bewegende
Kraft wirkt nicht direct auf die Achse der Räder, sondern sie trägt die Bewegung
erst mit Hülfe einer Kette ohne Ende auf zwei große Räder über, welche auf dem
Erdboden aufstehen; sechs andere kleinere Räder, die durch einen eigenthümlichen
Mechanismus untereinander verbunden sind, durch welchen man sie in allen Richtungen
drehen kann, tragen den Dampfwagen, der mit allen einzelnen Theilen auf Taf. III und
IV, Fig.
1–13, dargestellt ist.
Fig. 1, Taf.
III, ist eine Seitenansicht des Straßen-Dampfwagens, welche zeigt, wie die
Treib- und die Leitungsräder angebracht sind.
Fig. 2 ist ein
verticaler Längendurchschnitt, in welchem man die verschiedenen Stüke sieht, die zur
Uebertragung der Bewegung dienen.
Fig. 3 das
System der Räder von Oben gesehen, mit ihren Verbindungsstangen.
Fig. 4 ein
Theil des vor dem Wagen angebrachten Mechanismus, womit man den Rädern die nöthige
Richtung gibt.
Fig. 5 und
6 Ansicht
und Durchschnitt eines Theiles von einem Treibrade.
Fig. 7 und
8
Durchschnitt, Flächen- und Seitenansicht von einem der Leiträder.
Fig. 9, 10 und 11 Ansicht und
Durchschnitt von dem Sperrrade und seinem Mechanismus, nebst dem Stüke, an welchem
die zwei Sperrkegel angebracht sind.
Fig. 12
Seitenansicht des Tenders oder Transportwagens für Wasser und Kohlen.
Fig. 13 das
gegliederte Gestell, welches den Tender trägt, von Oben angesehen.
Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Stüke in den Fig. 1, 2, 3 und 4.
A der cylindrische Dampfkessel, durch dessen ganze Länge
die Röhren A¹ gehen, durch welche die Wärme
zieht.
B der cylindrische Feuerraum. B¹ der Rost. B'' die Heizöffnung.
C eine auf dem Dampfkessel befindliche Kuppel. C¹ der Raum, welcher die zwei Cylinder
einschließt, und in welchem sich der Rauch vereinigt, wenn er aus der Röhre A kömmt. Die Pfeile zeigen seine Richtung an.
D die zwei Dampfcylinder.
E der Kamin von Blech, welcher über den Dampfkessel
hervorragt, hier aber wegen Mangel an Raum nicht in seiner ganzen Höhe gezeichnet
werden konnte.
F das Eintrittsrohr des Dampfes; es ist gekrümmt und an
seinem oberen Ende erweitert. Das andere Ende ist nach Unten gekrümmt und steht mit
der Dampfbüchse des Cylinders in Verbindung. Die Pfeile zeigen die Richtung des
Dampfes an.
G ein Rohr, welches Dampf von dem Cylinder D in den Kamin ausströmen läßt, um dadurch den Zug des
Feuers zu vermehren.
H die Kolbenstange.
I eine gekrümmte Eisenstange aus einem einzigen Stüke;
sie ist an der Kolbenstange befestigt, und ihre beiden Enden sind an das
Führungsstük I' geschraubt, welches zwischen den
Leitschienen R, R gleitet.
J eine Lenkstange, welche mit dem Führungsstük I' verbunden ist, und mit Hülfe der Kurbel M die hin- und hergehende Bewegung des Kolbens in
eine kreisförmige verwandelt.
L eine mit Zähnen versehene Scheibe, welche auf der
Kurbelachse bleibend befestigt ist. Die Achse mit den Kurbeln K wird durch zwei eiserne Lager M
getragen.
N Achse der Treibräder O,
O.
O', O', O¹ die Leiträder, sechs an der Zahl.
P eine auf der Achse N
befestigte, an ihrem Umfang gezahnte Scheibe; sie ist um ein Fünftel größer als die
Scheibe L.
Q eine Kette ohne Ende, welche die Scheiben L und P umfaßt, und deren
Glieder in die Zähne derselben eingreifen; sie dient, die Wirkung der Triebkraft auf
die Achse N und folglich auf die zwei Räder O, O überzutragen. Man spannt sie mit Hülfe einer
Stellschraube.
S ein Schiebventil, durch welches der Dampf über und
unter den Kolben geleitet werden kann; es erhält seine hin- und hergehende
Bewegung durch die Stange T', welche mit einem
Excentricum, das auf der Achse der Kurbeln K, K sizt,
verbunden ist.
T die messingene Speisepumpe mit Kugelventilen. Ihre
Kolbenstange ist mit der Stange I verbunden, durch
welche sie bewegt wird.
T'' das mit einem Hahne versehene Speiserohr; es geht
bis zu dem Wasserreservoir, welches auf dem Tender befindlich ist. Diese Pumpen sind
doppelt, und man kann noch eine dritte an dem Plaze V
vor der Heizthüre anbringen, um den Dampfkessel auch zu speisen, während der Wagen
still steht, wenn man es für nöthig erachtet.
U, U die Sicherheitsventile, welche auf dem Obertheile
des Dampfkessels angebracht sind. Auch befinden sich an dem Kessel zwei Scheiben von
leichtflüssigem Metalle, drei Probirhähne, ein Wasserstandszeiger und ein
Manometer.
X der Siz des Conducteurs.
Y ein Kreuz, wodurch der Conducteur auf den Mechanismus
einwirkt, welcher dem Wagen die gewünschte Richtung mittheilt.
Z ein Hebel mit einem Handgriff, der mit dem Hahne,
durch welchen der Dampf in den Cylinder D eintritt,
verbunden ist; er befindet sich an der Seite des Conducteurs, der ihn dreht, wenn er
die Bewegung einstellen will.
S' Befestigungspunkt für den Tender.
Beschreibung der Räder und des Mechanismus zum Lenken des
Wagens. (Fig. 1, 3 und 4 auf Taf. III.)
Die Treibräder O, O haben eine doppelte Reihe Speichen.
(Fig. 5
und 6.) a, a die Speichen von Holz, wovon immer zwei einander
gegenüber stehen. b, b die doppelten Felgen, welche in
zwei Lagen übereinander liegen und durch Schrauben c, c
vereinigt sind. d ein Zwischenstük, durch welches die
Speichen von einander getrennt werden. e, e die Zapfen
der Speichen. f, f Holzstüke, welche auf dem Umfang der
Felgen b aufgenagelt sind; sie sind nebeneinander
gestellt und zwischen zwei eisernen Reifen h, h
eingeschlossen, welche auf jeder Seite des Rades aufgeschraubt sind und ungefähr 4
Centimeter über die Felgen vorstehen. Die 20 eisernen Stüke g, g von gleichen Größen sind quer über die Felgen gesezt und zwischen die
Reifen h, h eingenietet. Die leeren Räume, welche
zwischen diesen Eisenstüken entstehen, werden durch die schon erwähnten über Hirn
gestellten Holzstüke f, f (von Eichen- oder
Ulmenholz) ausgefüllt und fest genagelt; wenn sie abgenüzt sind, können sie leicht
wieder ersezt werden.
Diese Holzfütterung am Umfange der Treibräder hat den Zwek, die Stöße des Wagens auf
holperichten Wegen zum Theil aufzuheben.
Die Leiträder O', O', Fig. 7 und 8, welche
zwischen drehbaren Bügeln O'', O'' nach Art der Bettrollen aufgezogen sind, sind auf dieselbe Art wie die
Treibräder construirt, haben jedoch nur einfache Speichen K und Felgen, welche wie gewöhnlich mit einem eisernen Ring l umgeben sind. Die Speichen sind in eine Nabe eingefügt
und treten mit einem Zapfen in die Felge m. Zwei
Scheiben n, n, wovon die eine mit der Nabe aus einem
Stüke gegossen ist, halten die Speichen fest zwischen sich. Die Achsen V' der Bügel O'' drehen sich
mit geringer Reibung in den Halsringen C'', C'', welche an die Seitenwände des Kessels aufgeschraubt
sind. Die Federn D', D' sind
sehr kräftig, aber durch ihre besondere Einrichtung federn sie sich in
beträchtlichen Gränzen; sie sind über den kleinen Rädern angebracht und werden durch
zwei Stangen E', E'
gehalten; sie können durch zwei Schraubenmuttern o, o,
welche auf die Enden der Stangen E', E' aufgeschraubt werden, nach Belieben gespannt werden;
diese Federn stüzen sich beständig auf das Ende der Achsen der Bügel O'', und dadurch folglich auf die Achsen der kleinen
Räder O'.
F', ', Fig. 3, Zugstangen, welche
sich längs des Dampfwagens erstreken und wodurch man auf die zwei hinteren Räder
einwirkt; sie sind durch ein Gelenke mit den Hebelarmen I', I', die an den Bügeln O'' befestigt sind, verbunden; mit denselben kann man
die Räder in eine Stellung bringen, welche zu der beschreibenden Curve tangential
ist, wie es die punktirten Linien anzeigen.
G' andere Stangen, welche dazu dienen, die vier vorderen
Räder untereinander zu verbinden.
H' Stangen, welche an den zwei hinteren Rädern der
vorderen Abtheilung befestigt sind, und sich in eine Zahnstange K' endigen. Die Stange F'
endigt ebenfalls in eine Zahnstange, in welche ein Getriebe J' eingreift, wie man in Fig. 1 sieht. Dieses
Getriebe schiebt, wenn es gedreht wird, die Stangen F'
und H' abwechselnd vor- und rükwärts.
L', L', Fig. 3 und 4, sind zwei querüber
stehende Achsen, auf deren äußeren Enden die Getriebe J'
und auf deren anderen, nach Innen stehenden Enden die konischen Räder M', M' sizen, welche durch
ein Getriebe P' geführt werden; lezteres ist auf der
verticalen Lenkstange N' aufgezogen, welche durch das
daran befindliche Kreuz Y von dem Conducteur gedreht
werden kann.
Die Stangen F', G', H' sind mit den Leiträdern durch Hebelarme I', I', I' mittelst der doppelten Gelenke U', U' verbunden.
Wenn man die Einrichtung dieses Mechanismus wohl begriffen hat, wird es nicht mehr
schwer seyn, die Wirkung zu verstehen, durch welche dem Dampfwagen die gewünschte
Richtung der Bewegung mitgetheilt wird. Nehmen wir an, daß der Conducteur die
Steuerstange N' links drehe, so werden durch die
Verbindung der Getriebe mit den Winkelrädern und den Zahnstangen die vier vorderen
Räder ebenfalls genöthigt werden, sich links zu drehen, während die zwei hinteren
Räder sich rechts drehen. (Fig. 3.) Die
entgegengesezte Bewegung erhält man, wenn man die Steuerstange rechts dreht.
Man wird bemerken, daß die Arme der Hebel I', I' an den vorderen Rädern kürzer, als die der anderen
Räder sind. Durch diese Einrichtung convergiren die zwei vorderen Räder mehr als die
übrigen (wegen ihrer Entfernung von dem Mittelpunkte der Drehung, welcher sich in
der großen Treibachse befindet), damit die Achsenlinien aller Räder, wie eben so
viele Radien nach dem Mittelpunkte des Kreises gerichtet sind, der von dem Wagen
beschrieben wird.
Die beiden Treibräder sizen frei auf der Achse; sie sind mit ihr nur durch ein
Sperrrad (Fig.
9, 10 und 11), welches fest an dem Rade angeschraubt ist, verbunden, um ihnen die
bewegende Kraft der Maschine mitzutheilen.
Dieser Mechanismus besteht in Folgendem: das Stük mit den Armen p, p, Fig. 9, ist bleibend auf
der Achse u durch zwei Schließen befestigt; mit diesen
Armen sind zwei Sperrkegel q, q durch Scharniere
verbunden; diese Sperrkegel stüzen sich beständig im Innern des Rades gegen die
Zähne t, t, durch die Federn r,
r angedrükt. Das Sperrrad s, s ist fest an die
Speichen des Rades (Fig. 5) geschraubt. Die Dekplatte (Fig. 11) ist außerhalb
des Rades aufgeschraubt. Die Schrauben i, i dienen, das
Sperrrad zu befestigen, und die Speichen a, a
zusammenzuhalten.
Diese Einrichtung, die Räder lose auf die Achse zu sezen, ist zum Lenken des Wagens
unumgänglich nothwendig. Nehmen wir an, daß man den Wagen von seiner Richtung rechts
ablenken wolle, so wird das rechte Rad allein, durch seine Berührung mit dem Boden,
den Wagen vorwärts bewegen, denn das Rad auf der linken Seite wird genöthigt seyn,
eine größere Geschwindigkeit anzunehmen, weil es einen größeren Kreis beschreibt.
Wenn die Achse u, Fig. 9, durch ihre
Kreisbewegung in der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung das Stük mit den Armen
p, p mit sich fortführt, so ist klar, daß auch das
Sperrrad genöthigt ist, dieser Richtung zu folgen, weil die Sperrkegel q, q sich gegen die Zähne t,
t stüzen. Hat im Gegentheil das Rad eine schnellere Bewegung als die Achse,
was bei demjenigen Rade
stattfindet, welches den größeren Kreis beschreibt, wenn der Wagen seine Richtung
ändert, so werden die Sperrkegel keinen Widerstand mehr finden, sie werden durch die
Neigung der Zähne des Sperrrades nach Innen gedrängt und biegen dadurch die Federn
r, r zurük, so daß folglich keine Verbindung
zwischen der Achse und dem Rade mehr stattfindet. Jedes Treibrad ist übrigens noch
mit einer großen Feder Q' versehen, deren Mitte sich auf
die Achse stüzt und deren Enden an dem Dampfkessel befestigt sind. Eine
Stellschraube R¹ dient zum Spannen dieser
Federn.
Der Tender oder Transportwagen für Wasser und Kohks ist in
Fig. 12
und 13 auf
Tab. IV in einer Seitenansicht und von Oben dargestellt.
A ist das Wasserreservoir von Blech, in dessen Mitte ein
freier Raum zur Aufnahme von Kohks sich befindet.
B, B sind Tragrahmen von Holz, welche durch die Bolzen
D, D unter dem Boden des Wagens gehalten werden.
C, C zwei Ketten, deren Enden mit den Sectoren C', C' verbunden sind. Diese
Ketten kreuzen sich in der Art, daß die zwei Wagenabtheilungen dadurch unter
einander verbunden werden. Durch diese Einrichtung wird, wenn sich die vordere
Abtheilung rechts dreht, die hintere sich links drehen, und so umgekehrt.
E, E sind Federn, an den Rahmen und den Achsen
befestigt. Die hintere Wagenabtheilung ist der vorderen ähnlich.
F eine doppelte Zugstange von Eisen, welche nahe an den
Rädern I mit der Wagenachse durch ein Gelenk verbunden
ist. Dieses Stük endigt sich in eine Dülle H; ein
doppeltes Scharnier dient, den Tender mit dem Dampfwagen zu verbinden.
K Zugstangen von derselben Construction wie die vorigen;
sie dienen, den Tender mit dem nächstfolgenden Wagen zu verbinden. Diese Wagen sind
bestimmt, Personen oder Waaren aufzunehmen, und sind ebenfalls durch Gelenke
verbunden; sie sind mit 4, 6 oder 8 Rädern versehen, je nach der Last, die sie zu
tragen haben. Wenn es ein Wagen mit 6 Rädern ist, so können die zwei mittleren nicht
verstellt werden; das Verstellen der vorderen und hinteren Räder geschieht wie in
Fig. 13.
Hat der Wagen 8 Räder, so sind alle acht zu verstellen; in diesem Falle convergiren
die zwei vorderen und die zwei hinteren Räder mehr, als die vier mittleren. Der
Mechanismus, um die Bewegung zu erzeugen, ist derselbe wie der vorhergehende, nur
sind die Längen der Sectoren, an welchen die Ketten befestigt sind, einander nicht
gleich. Bei den Wagen mit 8 Rädern drehen sich die 4 vorderen rechts, während die 4
hinteren sich links drehen, und so umgekehrt.