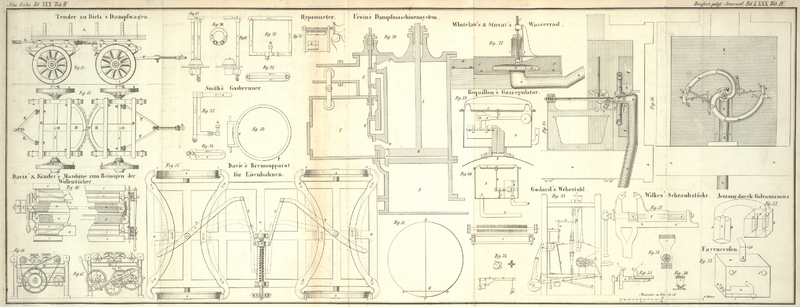| Titel: | Ueber die Einrichtung der Fayenceöfen. Von Dr. G. Reuß in Stuttgart. |
| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. XXVI., S. 109 |
| Download: | XML |
XXVI.
Ueber die Einrichtung der Fayenceoͤfen.
Von Dr. G. Reuß in
Stuttgart.
Mit einer Abbildung auf Tab. IV.
Reuß, uͤber die Einrichtung der
Fayenceoͤfen.
So sehr auch die Oefen von Porzellan oder Fayence in manchen Gegenden noch im
Mißcredit stehen, was ohne Zweifel der bei denselben häufig wahrzunehmenden
mangelhaften und nuzlosen inneren Einrichtung zuzuschreiben ist, so zwekmäßig und
vortheilhaft sind dieselben bei Anwendung eines guten Heizsystems.
Gewöhnlich und nicht mit Unrecht beklagt man sich darüber, daß sie viel Zeit
erfordern, ehe sie die Wärme gehörig ausstrahlen und dem Zimmer mittheilen –
ein Fehler, der bei vielen solchen Oefen stattfindet, wie man sie zum Theil noch
häufig in manchen Gegenden von Bayern trifft. Sie sind gewöhnlich groß und ihr
Feuerraum meistens sehr weit und hoch, so daß, wenn dieser nicht beinahe ganz mit
Brennmaterial angefüllt wird, man allerdings oft lange im kalten Local verweilen
muß. Das Feuer hat unter solchen Umständen zwei Schwierigkeiten zu überwinden: fürs
erste eine mehr oder weniger bedeutende Luftschichte, welche ihm als schlechter
Wärmeleiter entgegentritt, fürs zweite die gewöhnlich diken Porzellan- oder
Fayenceplatten, welche der Wärme nur langsamen Durchgang gestatten, wenn jene nicht
sehr kräftig einwirkt. Man verbraucht am Ende viel Brennmaterial und bezwekt doch
nicht viel Wärme dadurch.
Aehnliche Fayenceöfen findet man hin und wieder in der französischen Schweiz, so wie
in Frankreich, aber im Allgemeinen sind sie zwekmäßiger eingerichtet. Selbst der
Pariser, welcher mit Leib und Seele an seinem zwekwidrigen und Brennstoff verzehrenden Kaminfeuer hängt,
leistet, sobald es sich mehr um das Oekonomische handelt, auf dasselbe Verzicht. So
sieht man z.B. in Paris auf Comptoirs dergleichen sehr
zwekmäßig eingerichtete und zugleich elegante Fayenceöfen. Um sich der Fayenceöfen
mit Vortheil zu bedienen, handelt es sich nicht bloß darum, anhaltende
Wärmeentwikelung zu bewirken, was diese vor den eisernen, die sich schnell wieder
abkühlen, zum Voraus haben, sondern auch darum, schnell
Wärme erzeugen zu können. Sind diese beiden Bedingungen vereint, so ist ein solcher
Fayenceofen durch eine mehr gleichförmige Wärme, die er ausstrahlt, so wie durch die
dadurch zugleich bezwekte Ersparniß an Brennmaterial den eisernen, wo diese nicht
durch einzelne, besonders häusliche Rüksichten bedingt werden, weit vorzuziehen.
In Fig. 32
theilen wir das Wesentlichste von der Einrichtung eines Fayenceofens mit, die uns
als eine der zwekmäßigsten erscheint und die in der Praxis ausgeführt nichts zu
wünschen übrig ließ. a ist ein länglicher, ziemlich
schmaler Kasten von Eisen, b die Ofenthüre, c die Mündung, um den Rauch abzuführen, der aber nicht
unmittelbar von c gerade in die Höhe steigt, sondern
mehrere Krümmungen im Innern des Ofens beschreibt, so daß der Theil des sturzenen
Rohrs d, durch welches der Rauch entweicht, selten so
heiß wird, daß er der Wärme wegen nicht mehr berührt werden könnte. Der Rauch
entweicht also beinahe kalt. e und e' sind Luftlöcher, welche mit f und f' durch sturzene Röhren in Verbindung
stehen, die, nachdem sie eine drei- oder vierfache Wendung im Innern des
Fayenceofens und unmittelbar um den äußern Theil des eisernen Kastens a beschrieben haben, in f
und f' ausmünden. Sämmtliche zwischen den Röhren
befindliche Räume werden mit Mauerabfall oder gröblichen Steinen ausgefüllt und die
Oberfläche des Ofens mit einer Platte von Stein bedekt. Beginnt nun die Heizung, so
werden durch a zunächst die sturzenen Luftcanäle e und e' erhizt, wodurch
eine Strömung entsteht, indem die kalte und schwere Luft zu e und e' einströmt und durch f und f' als erwärmt
ausströmt. Beide Canäle f, f' und c sind aber zugleich auch in Berührung mit den im Ofen enthaltenen
Steinen, die somit ebenfalls nach und nach erwärmt werden und ihre Wärme ebenfalls
nach Außen mittheilen. Der Zug, welcher, wenn das Feuer lebhaft brennt, vielleicht
zu stark ist, wird mittelst des Schlüssels g
gemäßigt.
Dabei bemerken wir noch, daß es, was die Art zu heizen anbelangt, bei diesem System
nicht vortheilhaft ist, ein schwaches und dafür anhaltendes Feuer zu führen, weil
man verhältnißmäßig mehr Brennmaterial bedarf, als wenn gleich ein bestimmtes
Quantum Holz angezündet
und, wenn dieses lebhaft brennt, noch etwas Torf, der sich hier mit Vortheil benuzen
läßt, angewendet wird. Obgleich die Feuerung im Local selbst stattfindet, so sind
wir doch bei dieser Einrichtung und bei gehöriger Behandlung nie durch den
unangenehmen Geruch, den der Torf häufig verbreitet, belästigt worden. Ist das Feuer
abgebrannt, so wird der Schlüssel halb geschlossen, und bald darauf kann er und die
Oeffnung bei b ganz geschlossen werden. f und f' theilen dem Local
augenblikliche Wärme mit; die inneren Theile des Ofens
aber, welche durch das Rohr c und dann auch durch a nach und nach erwärmt werden und ihre Wärme später
mittheilen, wirken so nachhaltend, daß, wenn das geräumige Local des Tages nur
einmal, z.B. Morgens 7 Uhr, geheizt und um 9 Uhr der Schlüssel geschlossen war, es
Abends 10 Uhr noch 12° R. Wärme hatte, während die äußere Temperatur
4–6° Kälte betrug, und bloß, wenn die äußere Temperatur auf
12–15° Kälte gesunken war, wurde an demselben Tage, nämlich Abends 5
Uhr, zum zweitenmal gefeuert, um das Local bis 10 1/2 Uhr Abends warm zu
erhalten.
Die Außenseite des Ofens ist aus Fayenceplatten zusammengesezt; man kann auch eine
runde Form wählen. Solche Oefen können oft mit Vortheil in die Mitte eines Locals
gesezt werden, und dienen dann den Sommer über, nachdem man das Rohr d entfernt und m, m mit
einer eichenen Tafel bedekt hat, als bequeme Tische. (Riecke's Wochenblatt, 1841 Nr. 11.)
Tafeln