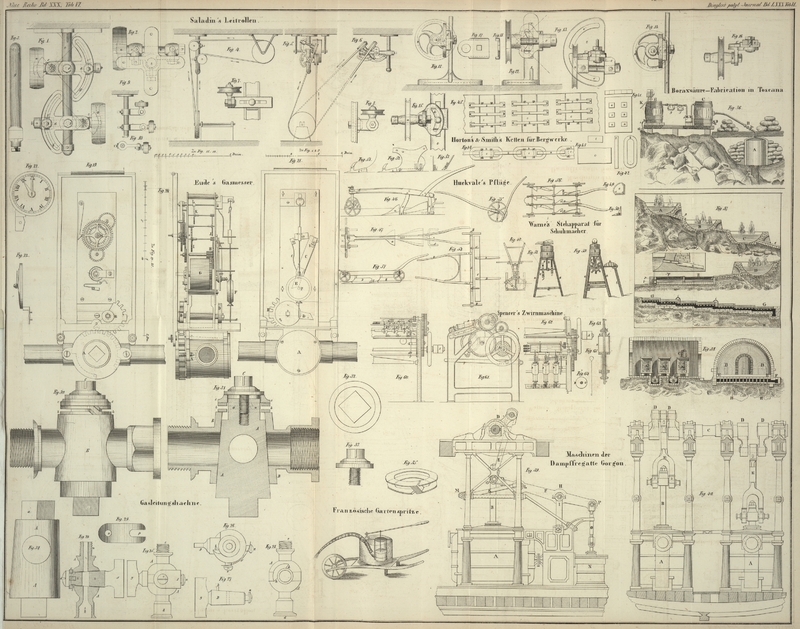| Titel: | Ueber die verbesserte Einrichtung der Gasleitungshähne in der Gasfabrik zu Frankfurt a. M. Mitgetheilt von Dr. Adolph Poppe jun. |
| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |
| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. LXVII., S. 256 |
| Download: | XML |
LXVII.
Ueber die verbesserte Einrichtung der
Gasleitungshaͤhne in der Gasfabrik zu Frankfurt a. M. Mitgetheilt von Dr.
Adolph Poppe
jun.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Poppe, uͤber eine verbesserte Einrichtung der
Gasleitungshaͤhne.
Vor einigen Jahren wurde von der technischen Direction der hiesigen Gasfabrik mit den
Hähnen der Brenner und der größeren Gasleitungsröhren eine Veränderung vorgenommen,
welche als praktisch und dem Zwek vollkommen entsprechend sich bewährt hat. Diese
Verbesserung verdankt die Anstalt Hrn. J. G. B. Bayer,
Gelbgießer dahier, welcher bereits durch mehrere eben so scharfsinnige als
gemeinnüzige mechanische Constructionen die dankbare Anerkennung seiner Mitbürger
sich erworben hat. Hr. Bayer wurde durch die häufigen von
Seite der Abonnenten laut gewordenen Klagen, wegen Lokerwerdens der Hähne und daraus
hervorgehender Gasentweichung zur Angabe der einfachen Verbesserungen, welche den
Gegenstand vorliegender Mittheilung bilden, veranlaßt, und die einsichtsvolle
technische Direction nahm keinen Anstand, diese als wesentlich erkannte Verbesserung
allgemein einzuführen.
Fig. 24 zeigt
einen zum Brenner gehörigen Gashahn früherer Construction in 1/2 der natürlichen
Größe. A, A ist die Nuß, in welcher der Hahn spielt; a der obere Theil der Nuß, an welchen der Brenner
aufgeschraubt wird, b die sogenannte Lilie mit der
bekannten Durchbohrung. Das Ende der kegelförmigen Lilie ist quadratisch gestaltet
und ragt aus der Nuß hervor; auf dieses quadratische Ende wird die mit einer gleich
großen quadratischen Oeffnung versehene Reibscheibe c, c
geschoben. Durch Anziehen der Schraube d wird der
erforderliche Schluß der Lilie bewirkt, in deren Ende deßhalb die entsprechende
Mutter eingeschnitten seyn muß. Der dichte Schluß des Hahns hängt demnach von dem
mehr oder minder starken Anziehen der Schraube d ab;
darin aber liegt eben die Schwierigkeit, ein leichtes Spiel und zugleich einen
dichten und dauernden Schluß zu erzielen, und zugleich der Grund zu den oben
erwähnten Klagen.
Es ist bei dieser Einrichtung schwer, den richtigen Grad der Spannung zu treffen,
unter welchem eine sanfte Bewegung und ein dichter Schluß bewirkt wird; entweder zieht man die
Schraube zu stark an, dann läßt sich der Hahn schwer drehen und die Theile nüzen
sich leichter und schneller ab, oder zu schwach, und dann kann das Gas durch die
lokeren Fugen entweichen. Wenn endlich auch der richtige Grad der Anspannung
getroffen ist, so wird doch der Hahn durch den häufigen Gebrauch loker, und eine
Gasentweichung ist die unvermeidliche Folge davon.
Bei der neuen Hahneinrichtung dagegen wird der Hahn, ohne von Zeit zu Zeit Nachhülfe
zu erfordern, durch Federkraft fortwährend in elastischem Schlusse erhalten. Unter
sanfter, nachgiebiger Spannung, aber beständig genau schließend, dreht sich die
Lilie in ihrer Nuß. Fig. 25 ist die Seitenansicht, Fig. 26 die obere Ansicht
eines verbesserten Brennerhahns. Fig. 27 ist die
Separatansicht der kegelförmigen Hahnlilie, Fig. 28 die
Separatansicht der Nuß vom Griff der Lilie aus gesehen. Fig. 29 zeigt die Feder
von der Vorrichtung getrennt. In allen diesen Ansichten, welche den Hahn mit seinen
einzelnen Theilen in halber Größe darstellen, sind die entsprechenden Theile mit
gleichen Buchstaben bezeichnet. A, A, Fig. 25 und 28 ist die
Nuß, d der untere, auf die Röhrenleitung zu schraubende
Ansaz, e der obere Ansaz, auf welchen der Brenner
geschraubt wird. Die Hahnlilie B, Fig. 27, besizt einen
Stift b, welcher bei erfolgender Umdrehung gegen die an
der Nuß befindlichen schrägen Flächen h, h, Fig. 28
anschlägt, und dadurch der Drehung des Hahns bei völlig geöffneter und völlig
geschlossener Stellung ein Ziel sezt. In Fig. 28 ist der
Einschnitt nach dem Hahne, welcher mir als Muster diente, so gezeichnet, daß die
Widerlagsflächen schräg stehen. Diese sollten eigentlich, damit sich der
Aufhaltsstift satt anlegen könne, nach der Achse der Lilie unter Zugabe der halben
Dike des Stiftes geschnitten seyn, und der Ausschnitt müßte die Form eines
Quadranten haben. Der am äußeren Ende der Lilie befindliche Knopf a ragt aus der Nuß hervor, und wird von dem
gabelförmigen Ende der Uhrfeder f umfaßt. Diese Feder,
welche die Nuß in der Ausdehnung eines Quadranten umgibt, erhält durch die Schraube
c ihre Spannung, und mit dieser das Bestreben, die
Lilie beständig einwärts zu ziehen, wodurch der verlangte sichere und nachgiebige
Schluß erreicht wird. In der Ansicht Fig. 29 ist p das gabelförmige, auf den Knopf a, Fig.
25, 26 und 27 wirkende Federende, und o das Loch für die
Schraube c.
Bei größeren Hähnen, auf welche die so eben beschriebene Anordnung nicht gut
anwendbar ist, hat Hr. Bayer denselben Zwek durch die
Fig. 30
bis 35
dargestellte Einrichtung mit vollkommenem Erfolg erreicht. Anstatt der Uhrfeder
wirkt hier eine ungleich stärkere spiralförmige Messingfeder von zwei Windungen auf die
Lilie des Hahns. Fig. 30 stellt die Seitenansicht und Fig. 31 den Durchschnitt
des Hahns durch die Mitte der Lilie dar. Fig. 32, 33, 34 und 35 sind separate
Ansichten der Details. Fig. 31 gibt einen
deutlichen Begriff von der Einrichtung dieses Hahns. Die kegelförmige Lilie A, A, wovon Fig. 34 die Seitenansicht
ist, ragt mit ihrem quadratisch gestalteten Ende a, a
zur Hülse B, worin sie spielt, heraus. Auf dieses
quadratische Ende wird zuerst die Fig. 35 in der
perspectivischen Ansicht dargestellte Feder b, b, dann
die Scheibe c, c, welche mit einer auf das Ende der
Lilie passenden quadratischen Oeffnung versehen ist, geschoben. Auf die Scheibe c, c kommt die Schraube C
mit ihrem breiten Rande zu liegen, durch deren Einschrauben in das vierekige Ende
der Lilie der verlangte Schluß der leztern bewirkt wird. In Folge des Einschraubens
der Schraube C bis zu einer gewissen Tiefe wird nämlich
der sich federnde Ring b, b zusammengedrükt, und wirkt
daher in seinem Bestreben, sich wieder auszudehnen, gegen die untere Fläche der
Scheibe c, c zurük, welche sofort den Druk dem Rande der
Schraube C mittheilt. Da aber die Schraube C mit der Hahnlilie in fester Verbindung steht, so wird
diese unter constanter Spannung einwärts gezogen, und mit ihrer Hülfe in genauem
Schluß erhalten. Der Grad der Spannung läßt sich durch mehr oder minder starkes
Anziehen der Schraube reguliren. Die Abnuzung der Hahnlilie an ihrem Umfange wird
durch die dauernde Thätigkeit der Federkraft, welche die Lilie fortwährend einwärts
zu ziehen strebt, unschädlich gemacht. Fig. 32 zeigt die Scheibe
c, c in der oberen Ansicht und Fig. 33 ist eine separate
Ansicht der Schraube C.
Daß diese Hahneinrichtung auch auf Wasserleitungen mit Vortheil anwendbar ist, wurde
durch die Erfahrung bestätigt. Schon seit mehreren Jahren ist sie bei hiesiger
Wasserleitung mit dem günstigsten Erfolge in Gebrauch.
Frankfurt a. M., den 15. April 1841.
Tafeln