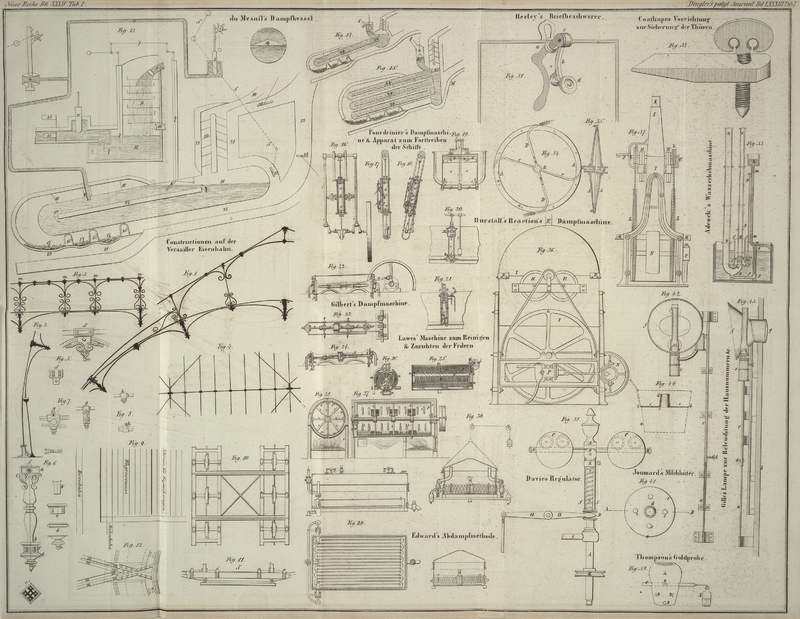| Titel: | Verbesserungen im Reinigen und Zurichten der Federn und an den hiezu dienlichen Apparaten, worauf sich Thomas Lawes, Federhändler zu Canal Bridge, in der Grafschaft Surrey, am 10. Novbr. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. XII., S. 45 |
| Download: | XML |
XII.
Verbesserungen im Reinigen und Zurichten der
Federn und an den hiezu dienlichen Apparaten, worauf sich Thomas Lawes, Federhaͤndler zu Canal Bridge,
in der Grafschaft Surrey, am 10. Novbr. 1840
ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts Okt. 1841, S.
183.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Lawes' Apparat zum Reinigen und Zurichten der Federn.
Meine Verbesserungen in der Reinigung und Zurichtung der Federn bestehen 1) in der
Anwendung einer Maschine zum Waschen und Reinigen der Federn anstatt der bisher
üblichen Methoden, 2) in einem verbesserten Apparat zum Troknen und Zurichten der
Federn, nachdem sie gewaschen worden sind.
Die Operation des Waschens oder Reinigens der Federn kann durch irgend einen
zwekdienlichen Mechanismus bewerkstelligt werden; indessen hat sich der in der
beigefügten Abbildung dargestellte Apparat als dem Zweke vollkommen entsprechend
bewährt. Er besteht aus einem langen, cylindrischen feststehenden Behältniß mit
einer horizontalen
Welle, welche mit radialen Speichen oder Schlägern versehen und im Innern des
Behälters gelagert ist. Diese Welle wird durch irgend einen geeigneten Mechanismus
in Rotation gesezt. Dem Boden dieses Behälters entlang läuft ein Trog, welcher
seiner ganzen Länge nach mit einem starken Drahtsieb überzogen ist. Auch die krummen
Seitenflächen und Enden des cylindrischen Behälters sind mit einem Drahtgewebe
überzogen; dadurch, daß lezteres ungefähr ⅜ Zoll von den Seitenwänden und
Enden des Behälters absteht, entsteht eine freie Communication mit dem darunter
befindlichen Troge.
Fig. 25
liefert einen Längendurchschnitt durch die Mitte des ganzen Apparates, Fig. 26 einen
Querschnitt desselben mit seinen wirksamen Theilen. a, a
ist der cylindrische Behälter, b, b die Welle. Leztere
ist mit radialen Armen oder Schlägern c, c, c, c
versehen und ruht in Lagern d, d, welche im Innern des
Behälters a, a angebracht sind.
Der Trog e, e, e, e ist mit dem Drahtsieb f, f bedekt. An dem einen Ende der Welle b, b sizt ein Stirnrad g, g,
welches durch ein an der Achse i, i befindliches
Getriebe h umgetrieben wird. Die Achse i, i dreht sich in Lagern j,
j und durch Uebertragung der Bewegung auf die an der Achse i sizende Rolle k werden die
beweglichen Theile des Apparates in Rotation gesezt. Die Seiten- und
Endflächen des Behälters a, a sind mit einem Drahtgewebe
überzogen, dessen unteres Ende in den Trog e, e unter
das Sieb f, f hinab sich erstrekt.
Beim Gebrauch des Apparates kommt eine hinreichende Quantität Federn in den Behälter
a, a, welcher darauf durch die Röhre m mit Wasser gefüllt wird. Sezt man nun die Welle b in Rotation, so arbeiten die Schläger c, c die Federn durcheinander und sondern Schmuz und
fremdartige Substanzen von denselben ab. Die Unreinigkeiten sinken entweder durch
das Sieb f oder durch den Drahtflor l in den Trog e, e hinab,
von wo aus dieselben durch die Oeffnungen n, n
abfließen.
Wenn die Federn zur Genüge gewaschen sind, so läßt man das Wasser durch die
Oeffnungen n, n ab und nimmt die Federn entweder von
oben oder durch die seitwärts angebrachte Thür o aus dem
Behälter a, a. Sie werden darauf durch Uebergießen mit
siedendem Wasser erwärmt, sodann ausgepreßt und auf irgend eine zwekdienliche Weise
getroknet.
Der Apparat, dessen ich mich zum Troknen und Zurichten der Federn bediene, ist Fig. 27 und
28
dargestellt. Fig.
27 liefert einen Querschnitt und Fig. 28 einen
Längendurchschnitt desselben. Der Apparat besteht aus einem geräumigen metallenen
Cylinder p, p, p, p, welcher in Lagern q, q ruht und von einem zweiten Cylinder umgeben ist. Lezterer besteht
zum Theil aus einem gemauerten Baksteingewölbe r, r, um
die Wärme beisammen zu halten, zum Theil aus einem eisernen Halbcylinder s, s, welcher den unteren Theil des Cylinders p, p umgibt und ihn gegen die allzu plözliche, von dem
darunter befindlichen Ofen ausgehende Hize schüzt.
Der rotirende Cylinder p, p ist mit Armen t, t, t versehen, welche an die innere Seite desselben
befestigt und gegen das Centrum hin gerichtet sind. Durch die Umdrehungen des
Cylinders werden die in Folge des Dämpfens zusammenklebenden Federklümpchen
aufgelokert, so daß sie nun gleichförmiger und regelmäßiger den Einwirkungen der
Hize ausgesezt sind. Dieß wird noch durch die zur Verstärkung des Cylinders
dienlichen Arme z, z befördert. Gewisse Theile an den
Enden und Drahtflor u, u überzogen, um dem aus den
troknenden Federn sich entwikelnden Dampfe den Austritt in den ringförmigen, den
Cylinder umgebenden Raum zu gestatten. Von hier entweicht der Dampf durch die
Achsenlager q, q ins Freie. Damit dieses geschehen
könne, dreht sich der Cylinder ganz loker in den lezteren.
Durch Uebertragung der Triebkraft auf die Rolle v, v,
welche mit dem Cylinder p, p an einer und derselben
Achse sizt, wird derselbe in Umdrehung gesezt. Das Feuer spielt gegen den unteren
Theil s des metallenen Halbcylinders, wodurch die Wärme
sich gleichförmig über die Oberfläche des rotirenden Cylinders vertheilt. Auf diese
Weise wird das Sengen oder Verbrennen der Federn durch allzurasch beigebrachte Hize
verhütet.
Wenn die Federn hinreichend getroknet und zugerichtet sind, so werden sie durch eine
an dem einen Cylinderende befindliche Thür w
herausgenommen. Eine entsprechende Thür x ist an dem
Ende des eisernen Halbcylinders s angebracht, um zu der
Thüre w gelangen zu können.
Anstatt den rotirenden Cylinder in ein gemauertes Gehäuse einzuschließen, seze ich
ihn hie und da in einen oder mehrere Cylinder und gebe den äußern Cylindern kleine
Oeffnungen, durch welche der aus den Federn im innern Cylinder sich entwikelnde
Dampf ins Freie entweichen kann. Wenn man nun auf den äußeren Cylinder die Hize
einwirken läßt, indem man denselben entweder in einen Ofen einsezt oder ein Feuer
unter ihm anmacht, während man zugleich den inneren Cylinder rotiren läßt, so
vertheilt sich die Hize regelmäßig und gleichförmig durch den inneren Cylinder und
die in demselben befindlichen Federn werden auf die gehörige Weise getroknet und
zugerichtet.
Tafeln