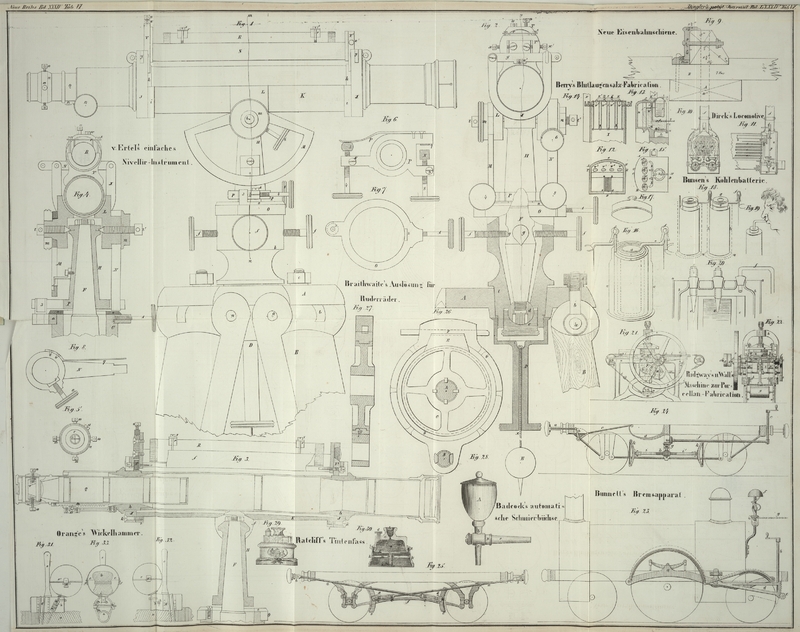| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung des Porzellans und Steinguts, worauf sich John Ridgway, Porzellanfabrikant in Stafford, Cauldon-place, und Georg Wall jun., ebendaselbst, am 11. Jan. 1840 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 84, Jahrgang 1842, Nr. LXX., S. 353 |
| Download: | XML |
LXX.
Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung des
Porzellans und Steinguts, worauf sich John Ridgway, Porzellanfabrikant in
Stafford, Cauldon-place, und Georg Wall
jun., ebendaselbst, am 11.
Jan. 1840 ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1842, S.
99.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Ridgway's Maschinen znr Verfertigung des Porzellans.
Vorliegende Verbesserungen bestehen in der Anwendung eines Paares gewöhnlicher
Doppelformen, welche mit Hülfe eines selbstthätigen, durch Dampf oder eine andere
Triebkraft in Bewegung gesezten Mechanismus an einander gepreßt werden. Der
Hauptzwek der Erfindung geht darauf hinaus, die verschiedenen Proceduren, nämlich
das Füllen der Presse, das Schließen der Formen zur Bildung des Fabricats und das
Herausnehmen derselben durch einen selbstthätigen Mechanismus, anstatt durch
Händearbeit verrichten zu lassen. Fig. 21 ist eine
Seitenansicht und Fig. 22 eine Front- oder Endansicht der in Rede stehenden
Maschine. a, a, a ist das Hauptgestell, welches das Preßgestell b, b, b trägt. An der in dem Gestelle a, a, a gelagerten Treibwelle
c, c sind die
Treibrollen, das Schwungrad e und die Getriebe f, f befestigt; die
Leit- oder Spannrollen g, g haben gleichfalls in dem Hauptgestell ihre Lager; in passender
Entfernung ist noch eine andere Spannrolle h gelagert.
Die Rollen g und h dienen
zur Leitung des Zuführbandes i, i, welches die Formenpaare k, k durch die Maschine führt. Das Preßgestell b, b ist mit parallelen
Seiten versehen, zwischen denen die untere Preßplatte m
auf und nieder beweglich ist, ferner mit einer Stellschraube n, um die obere stationäre Preßplatte o
adjustiren und dadurch den Druk auf die Formen k, k reguliren zu können. Die obere Preßplatte o oder die bewegliche Preßplatte m sind nöthigenfalls mit Federn versehen, um dem Druk einen gewissen Grad
von Elasticität zu geben. In dem Gestelle b, b läuft eine Welle p, an
deren Ende sich das Rad q befindet, welches mit einem
der Getriebe f im Eingriff steht. In Folge dieses
Eingriffes kommt die in der Mitte der Welle p befestigte
excentrische Scheibe r in Umdrehung und wirkt gegen
einen an der unteren Seite der Preßplatte m befindlichen
Vorsprung s.
Die Maschine arbeitet auf folgende Weise. Angenommen, die Triebkraft werde mittelst
eines um die Rolle d geschlagenen Riemens von einer Dampfmaschine oder
einem anderen Beweger hergeleitet, und ein Paar Formen k
mit einem zwischen ihnen befindlichen Thonklumpen seyen auf das Zuführband i, i gelegt, so sezt eines
der Getriebe f das an der dünneren Querwelle u befindliche Stirnrad t in
Umdrehung, so daß vermittelst der Kurbel v und der
Lenkstange w der Arm x in
Schwingungen versezt wird. Da dieser Arm mit der Führung y in Verbindung steht, so gleitet er längs der beiden Leitstangen z, z hin, und veranlaßt das
Fangrad 1, 1, gegen die an dem Riemen i befindlichen
Aufhälter 2, 2 anzuschlagen und eine Viertelsdrehung zu machen; einer der Fanghaken
des Rades 1 ergreift den Aufhälter 2 und zieht bei der rükgängigen Schwingung des
Armes x das Band i, i nach sich, bis die Formen k, k genau unter dem Mittelpunkt der Presse
liegen, worauf der Fanghaken den Aufhälter des Riemens i, i verläßt; der leztere steht nun still.
Zugleich kommt das Excentricum r gegen den an der
unteren Seite der Preßplatte m befindlichen Vorsprung
s in Wirksamkeit, drükt die Platte m mit den Formen k, k aufwärts und preßt dadurch den zwischen den lezteren
enthaltenen Thon in die verlangte Gestalt. Hierauf rükt das Band wieder auf dieselbe
Weise, wie oben, vor und bringt die Formen mit dem geformten Artikel in das
Trokenzimmer.
Auf solche Weise geht bei ununterbrochener Rotation der Maschinentheile das
abwechselnde Zuführen der mit Thon versehenen Formen, die Bildung der verlangten
Artikel mittelst Pressens und das Wegnehmen derselben aus der Maschine der Reihe
nach vor sich.Eine unvollstaͤndigere Beschreibung und Abbildung dieser Maschine
haben wir aus dem Mechanics' Magazine bereits im
polyt. Journal Bd. LXXVIII. S. 357 mitgetheilt.A. d. R.
Tafeln