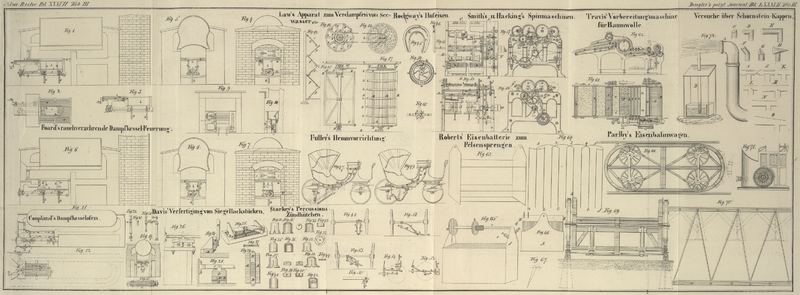| Titel: | Rotirender Apparat zum Verdampfen von Seewasser und anderen Flüssigkeiten, worauf sich Edward Law zu Downham-road, Kingsland in der Grafschaft Middlesex, am 20. März 1839 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. XXV., S. 91 |
| Download: | XML |
XXV.
Rotirender Apparat zum Verdampfen von Seewasser
und anderen Fluͤssigkeiten, worauf sich Edward Law zu Downham-road, Kingsland in der
Grafschaft Middlesex, am 20. Maͤrz 1839
ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Okt. 1842,
S. 201.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Law's rotirender Apparat zum Verdampfen von Seewasser
etc.
Meine Verbesserungen betreffen einen Mechanismus, mit dessen Hülfe ich das Wasser auf
eine wohlfeilere und geschwindere Weise zu verdampfen im Stande bin, als dieß bisher
geschah. Ich seze nämlich das Meerwasser oder andere Flüssigkeiten in einer großen
Oberfläche einem lebhaften, durch Notationsapparate erzeugten Luftstrom aus.
A, AFig. 15, ist
eine senkrechte Welle, welche, wie der Grundriß Fig. 16 zeigt, zehn
Rahmen B, B, B trägt. Ueber diese senkrechte Rahmen sind
Flächen C, C von starkem Kanvaß gespannt. Auf diese zehn
Flächen oder Flügel träufelt die zu verdunstende Flüssigkeit aus den Röhren D, D, D, Fig. 15 und 16, an deren
unterer Seite, von dem Centraltrichter ausgehend, Löcher angebracht sind. In diesen
Trichter ergießt sich die Flüssigkeit aus einem Seitenrohre F der Röhre G, G, welche mit dem die
Flüssigkeit enthaltenden Reservoir in Verbindung steht. Der untere stählerne Zapfen
H, Fig. 15, der senkrechten
Welle A, A ist an seiner unteren Seite flach und ruht
auf einer convexen oder etwas abgerundeten Fläche von gehärtetem Stahl, die in einem
gußeisernen Oehlbehälter befestigt ist, in dessen Dekel sich ein cylindrisches Loch
befindet, das genau auf den cylindrischen Wellzapfen paßt. In Folge dieser Anordnung
dreht sich der leztere mit sehr geringer Friction und wird beständig durch das in
dem gußeisernen Behälter befindliche Oehl geschmiert. Um das Eindringen des
Meerwassers in den Oehlbehälter zu verhindern, ist derselbe mit einem Hut oder Dekel
versehen. Der obere Zapfen I der Welle A, A ist ein Cylinder aus gehärtetem Stahl, der sich von
der untern Seite des Balkens J, J, an den er
festgeschraubt ist, in eine gußeiserne Oehlschale K
herab erstrekt. Diese Schale ist an dem oberen Ende der Welle A, A fest und hat in ihrem Dekel ein cylindrisches Loch, in welches der
Zapfen I genau paßt. Gießt man nun Oehl in die Schale,
so wird dadurch der obere Zapfen beständig schlüpfrig erhalten.
Der Apparat wird mittelst endloser Riemen oder verzahnten Räderwerks in rasche
Umdrehung gesezt. Auf diese Weise seze ich das Seewasser oder andere Flüssigkeiten, während sie in sehr
zertheiltem Zustande die senkrechten Flügel C, C
hinabrieseln, einem heftigen, durch die rasche Rotation der Flügel erzeugten
Luftstrome aus, und erziele dadurch eine rasche Verdunstung des Wassers. Dieß ist
jedoch noch nicht Alles. Da ich durch die Umdrehungen des senkrechten Apparates
einen lebhaften Luftstrom hervorbringe, so benüze ich diesen noch weiter, indem ich
rings um die Maschine Gestelle mit Rahmen anordne, die mit starkem Kanvaß oder
sonstigem Materiale überzogen und zikzakförmig gestellt sind, wie P, P, P, Fig. 19, zeigt. So wird
die in Folge der Centrifugalkraft von den Flügeln in theilweise concentrirtem
Zustande abgeschleuderte Flüssigkeit von Neuem einem kräftigen Luftstrome ausgesezt
und dadurch noch mehr concentrirt.
Zur Verdunstung des Seewassers und anderer Flüssigkeiten kann man auch den Fig. 17 und
18
dargestellten Apparat benüzen. Anstatt der Flügelrahmen sind an der Achse parallel
übereinander mehrere kreisrunde metallene Schalen L, L,
L angeordnet, welche auch von den senkrechten Trägern M, M, M und den Armen N, N
unterstüzt werden. Sämmtliche Schalen, deren äußere Ränder nach Innen umgebogen
sind, enthalten in gehörigen Abständen von einander Löcher, durch welche von Oben
bis Unten in kreisförmiger oder radialer Anordnung Schnüre gezogen und oben und
unten wohl befestigt sind. Die zu verdunstende Flüssigkeit läuft durch die von der
Hauptröhre G, G aus sich erstrekenden Seitenröhren P, P in die oberste Schale L. Die Röhren P, P endigen sich nämlich in eine
horizontale durchlöcherte Röhre Q, welche die
Flüssigkeit über die obere Schale verbreitet. Während nun der Apparat in rasche
Rotation versezt wird, rieselt die Flüssigkeit die Fäden hinab, wird auf ihrem Wege
der gesteigerten Einwirkung der Luft ausgesezt und kommt in einem sehr concentrirten
Zustande unten an. Sollte bei der einen oder der andern der beschriebenen Maschinen
die Flüssigkeit nach einmaligem Aufgießen noch nicht in genügend concentrirtem
Zustande unten anlangen, so fängt man sie in einer Rinne R auf, leitet sie in ein Reservoir, von wo aus sie in ein höher gelegenes
Bassin gepumpt werden kann, um zum zweitenmale dem Verdunstungsproceß zu
unterliegen. Dieser kann so oft wiederholt werden, bis die Flüssigkeit den
geeigneten Grad der Concentration erreicht hat, um in die Abdampfungspfanne gebracht
werden zu können.
Tafeln