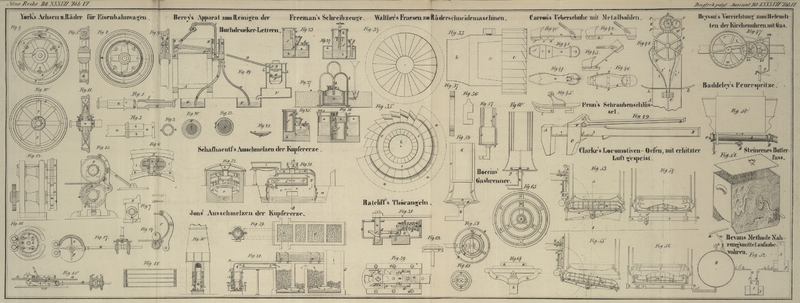| Titel: | Verbessertes Verfahren Kupfererze auszuschmelzen, worauf sich Dr. Karl Schafhäutl am 6. März 1839 in England ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. LXXV., S. 273 |
| Download: | XML |
LXXV.
Verbessertes Verfahren Kupfererze auszuschmelzen,
worauf sich Dr. Karl
Schafhaͤutl am 6. Maͤrz
1839 in England ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts. Dec. 1842, S.
344.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Schafhaͤutl's Verfahren Kupfererze
auszuschmelzen.
Die Erfindung besteht zuvörderst darin, daß das Kupfererz gepulvert und mit einer
alkalischen oder erdigen Basis, welche zu dem im Erz enthaltenen Schwefel eine
starke Verwandtschaft hat, innig gemengt wird. Der Patentträger gibt hiezu seiner
Wohlfeilheit wegen dem gebrannten Kalk den Vorzug.
Der Kalk und das Erz werden, wenn sie gemengt sind, mit Wasser zu einem dünnen Mörtel
angerührt, dem noch eine gewisse Quantität Kochsalz zugesezt wird. Wenn das Erz 5
bis 12 Proc. Kupfer enthält, werden auf 5 Theile des Erzes 2 1/2 Th. Kalk und 1 Th.
Salz zugesezt.
Das Gemenge wird nun im gewöhnlichen oder in dem verbesserten Röstofen, welcher den
zweiten Theil der Erfindung ausmacht, gebrannt und dann auf übliche Weise
geschmolzen.
Der verbesserte Röstofen soll erstens dem über seinem Gestell ausgebreiteten Erze
eine vollkommenere und schnellere Berührung mit der Luft gestatten; zweitens das
Entweichen aller schweflig- und arsenigsauren Dämpfe in die Luft verhindern
und erstere, so man will, in Schwefelsäure verwandeln.
Fig. 31 ist
ein Längendurchschnitt des verbesserten Röstofens; Fig. 32 ein senkrechter
Querdurchschnitt nach der Linie AB. a ist der Feuerrost, welcher durch den
Schieber b und die Thüren c,
die luftdicht schließen und wie gewöhnlich mit feuchtem Thone verstrichen werden,
von der unmittelbaren Verbindung mit der äußeren Luft abgeschlossen ist; das
entgegengesezte Ende des Röstofens ist ebenfalls durch die Thüren d luftdicht verschlossen. Der geschlossene Feuerraum communicirt mit der
Luftkammer e in der Mitte und mittelst des Canals g mit dem Gestell f, auf
welches das oben erwähnte Gemenge von Erz und Kalk behufs des Röstens gebracht wird.
Die Beschikung geschieht durch den Trichter h. Das
Gestell f ist dem Luftzutritt nur an der Seite f* geöffnet; in Folge davon tritt die das Feuer
speisende Luft, da alle andere Communication abgeschnitten ist, hier ein und
streicht in einem ununterbrochenen Strom über das Erz auf dem Gestell f, oxydirt den Schwefel und Arsenik und reißt alle
schweflig- und arsenigsauren Dämpfe durch den Canal g in die Luftkammer e mit sich fort. Von
dieser Kammer aus streicht sie mit dem vom Wasser i
(welches langsam unter dem Aschenfall und der Luftkammer hinwegfließt) aufsteigenden
Dampf durch das glühende Brennmaterial in dem Feuerraume, wobei die Dämpfe in
Schwefelsäure umgewandelt werden und mit der Flamme rükwärts durch die Züge oder
Füchse j, j, j in die (in der Abbildung nicht
sichtbaren) Flammenkammern an den beiden Seiten des Canals g strömen. Von hier streicht die Luft durch die Canäle k über den gewölbten Calcinirraum in den Schornstein I, wo die sauren Gase mittelst Dampf leicht condensirt
werden können. Der Zug der Luft und des Rauches vom Calcinirraume bis zum
Schornstein I ist durch die Pfeile in Fig. 31 angezeigt.
Wenn das Gemenge hinreichend geröstet ist, wird es durch die Canäle n, n langsam in das Wasser i
in der Luftkammer e hinuntergescharrt; der Calcinirraum
wird dann mit einer neuen Portion des Gemenges beschikt und eben so verfahren u.s.w.
Die zuerst in das Wasser geworfene Beschikung wird aber vorher durch die Thüren d herausgenommen und in den Raum m gebracht, wo die Masse sorgfältig ausgewaschen wird und dann zum
Schmelzen geeignet ist.
Tafeln