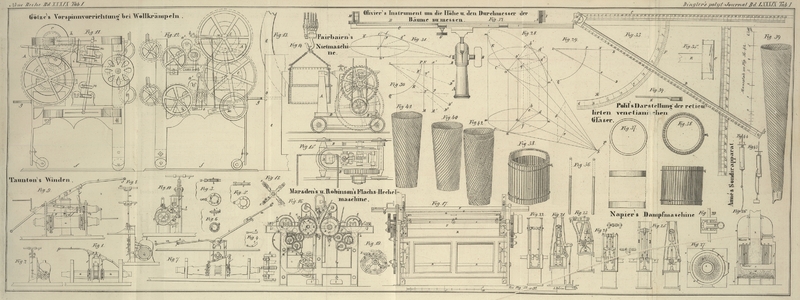| Titel: | Beschreibung des Verfahrens bei der Darstellung der reticulirten venetianischen Gläser; von Franz Pohl. |
| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. VIII., S. 21 |
| Download: | XML |
VIII.
Beschreibung des Verfahrens bei der Darstellung
der reticulirten venetianischen Glaͤser; von Franz Pohl.Dem Hrn. Verfasser wurde der von dem Verein zur Befoͤrderung des
Gewerbfleißes in Preußen ausgesezte Preis, betreffend die Darstellung von
Hohlglaͤsern nach Art der alten venetianischen,
zuerkannt.
Aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des
Gewerbfleißes in Preußen, 1843, 1ste Lieferung.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Pohl's Verfahren bei der Darstellung der reticulirten
venetianischen Gläser.
Die Darstellung der reticulirten venetianischen Gläser erfordert eine größere
Geschiklichkeit des Glasmachers, die natürlich nur durch vieles und unausgeseztes
Arbeiten erreicht werden kann. So viel man nach einer Probe von altem venetianischem
Glase, welches in meinem Besize sich befindet, urtheilen kann, glaube ich diese
schon erreicht zu haben. Sollte man mir noch vollkommneres aufweisen, so zweifle ich
gar nicht, auch darin alle Anforderungen befriedigen zu können.
Meine Versuche machte ich mit gewöhnlichem Kreide- oder Weißglase und einem
damit haltbar sich verbindenden sattweißen bleihaltigen Glase, während die
venetianischen Gläser aus einem leichtflüssigen, Borax enthaltenden Glase gefertigt
zu seyn scheinen, wodurch sie specifisch leichter sind, als die von mir gefertigten,
was indeß hier wohl nicht in Betracht kommen kann, wo die Aufgabe nur die äußere
gleiche Herstellung verlangt, keineswegs aber eine besondere Zusammensezung der
Glasmasse bedingt. Sollte die Fabrication dieser Gläser weiter verfolgt werden, so
ist es im Interesse dieser Fabrication selbst, sich eines weichen, boraxhaltigen
Glases zu bedienen, wobei die Gegenstände weit leichter ausfallen würden.
Das ganze Verfahren theilt sich füglich, weil das Glas dreimal erhizt werben muß, in
drei Abtheilungen: 1) in die Vorbereitung zur Vorarbeit, 2) die Vorarbeit selbst, 3)
die vollständige Herstellung.
1) Unter der Vorbereitung zur Vorarbeit ist das Herstellen von Glasstäbchen aus der rohen
Glasmasse zu verstehen (Fig. 36), welche auf die
Weise erhalten werden, daß der Glasmacher ein Stükchen des oben erwähnten sattweißen
Glases an die Pfeife nimmt, und cylinderförmig, etwa 1 Zoll lang, ¼ Zoll
stark formt. Hierauf wird nach verlangtem Verhältnisse Kreideglas aufgenommen, und
wie anderes Röhrenglas (z. B. Thermometerröhren) 30 bis 40 Fuß, je nach der
Quantität des aufgenommenen Glases, ausgezogen, wovon nun ohne weitere besondere
Kühlung durch Anrizen mit einer Feile Stäbchen gebrochen werden.
2) Die Vorarbeit besteht in der Anfertigung der geschnürten Hülsen. Dazu werden die
nach Angabe erhaltenen Glasstäbchen um zwei Glasringe (Fig. 37), welche an einem
cylinderförmigen Stük Holz oben und unten befestigt sind, ringsherum dicht an
einander aufgestellt und nachher mit zwei Drahtreifen umschlossen, so daß die
Stäbchen, nachdem der Holzcylinder herausgenommen, nach Innen und Außen nicht
weichen können. Fig. 38 zeigt einen so gebildeten Glasstäbchencylinder in Ober-,
Seiten- und perspectivischer Ansicht. Dieß Zusammensezen der Stäbchen
geschieht nach einiger erlangten Fertigkeit weit schneller und leichter, als es auf
den ersten Anblik scheint; die Zahl der Stäbchen richtet sich nach dem zu
fertigenden Gegenstande, wonach auch die Reifchen, welche beide immer von ganz
gleichem Durchmesser seyn müssen, größer oder kleiner gewählt werden.
Die so zusammengehaltenen Stäbchen werden nun in eigens dazu verfertigten thönernen
Töpfchen, die mit Dekeln versehen sind, im Aschofen langsam angewärmt, bis zu einer
Temperatur, bei welcher sie an frisch aufgenommenem Glase haften; sodann wird das
Töpfchen aus dem Ofen genommen, der Dekel entfernt und der aus den Glasstäbchen
gebildete Cylinder an eine Pfeife geheftet, die Drähte abgestreift und die Glasfäden
nach und nach aneinandergewärmt. Die noch offene Seite des hohlen Cylinders schließt
man durch angelegtes Glas. Der Cylinder, der schon eine mehr kegelförmige Gestalt
annimmt, wird nun, während gleichzeitig die Pfeife rechts oder links gedreht wird,
in die Länge gezogen, wodurch sich die Glasfäden spiralförmig winden, und in der
Spize des Kegels zusammenlaufen, wie Fig. 39 zeigt. Diese
Kegel werden, je nach der Größe des ursprünglichen Cylinders, 12 bis 24 Zoll lang,
und müssen in Vorrath gefertigt werden, ein Theil links, der andere rechts gewunden.
Man zersprengt sie in 3 bis 5 Zoll lange Hülsen (Fig. 40 und 41) am
Sprengrade und wählt aus dem Vorrathe ohne Schwierigkeit die zu einander passenden
aus. Dieß führt zur vollständigen Herstellung.
3) Aus jenen Hülsen nimmt man also zwei in entgegengesezter Richtung gewundene und
zusammenpassende, stellt sie, die engen Seiten ten nach Unten, in die schon oben gebrauchten Töpfchen
zum Anwärmen. Die engere der beiden Hülsen, welche stets um etwa ½ Zoll
länger seyn muß, als die weitere, wird nun zuerst angeheftet und an der vordern
engern Seite vorsichtig zugezogen, worauf die weitere Hülse darüber geschoben wird
(Fig.
42).
Nun werden beide Hülsen im Ofen zur Dehnbarkeit gebracht; sie kleben, indem man
gleichzeitig in die innere etwas bläst, mit ihren Glasreifen sich kreuzend,
aneinander, schließen die dazwischen befindliche Luft ein, und bilden so die
regelmäßigen Bläschen, als das Charakteristische dieser Gläser. Die nachherige
Behandlung ist bekannt und willkürlich, wie bei jedem andern Hohlglase.
Bei diesem Verarbeiten in Gefäße sind noch verschiedene Vorsichtsmaßregeln und
Vortheile zu beobachten, die jedoch der praktische Arbeiter nur aus eigener
Erfahrung sich aneignen kann.
Das Kreideglas zu diesen Gläsern verarbeite ich in derselben Zusammensezung, wie für
gewöhnliche Gläser, und zwar stelle ich es zusammen aus 80 Pfd. Kies, 80 Pfd.
raffinirter Potasche, 12 Pfd. Kalk, 2 Pfd. Mennige, 1 Pfd. Salpeter, 1 Pfd. Arsenik,
2 Loth Braunstein. Die Schmelzzeit eines solchen Gemenges dauert, je nach der Güte
des Ofens, 8 bis 42 Stunden und darüber.
Sattweißes Glas, wie ich es zu allen gesponnenen oder geschnürten Gläsern verwende,
stelle ich vollkommen haltbar zu obigem Kreideglase dar, aus: 12 Pfd. Kies, 24 Pfd.
englischer Mennige, 10 Pfd. gestoßener Schmelze des obigen Kreideglases, und 3 Pfd.
12 Loth Arsenik. Schmelzung wie bei gewöhnlichem Kreideglase.
Tafeln