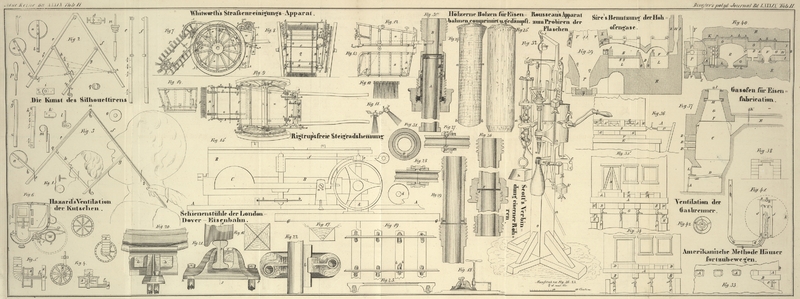| Titel: | Scott's verbesserte Verbindungsmethode gußeiserner und schmiedeiserner Röhren so wie weicher Metallröhren. |
| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. XXIV., S. 94 |
| Download: | XML |
XXIV.
Scott's verbesserte Verbindungsmethode
gußeiserner und schmiedeiserner Roͤhren so wie weicher
Metallroͤhren.
Aus dem Mechanics' Magazine. Febr. 1843, S.
104.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Scott's Verbindungsmethode gußeiserner und schmiedeiserner
Röhren.
Diese Verbesserungen sind verschieden modificirt, je nachdem sie sich auf gußeiserne,
schmiedeiserne Röhren oder weiche Metallröhren beziehen, besizen aber alle das
Eigenthümliche, daß jedes Röhrenstük seinen eigenen Schlüssel hat, mit dessen Hülfe
dasselbe nach Belieben fest angezogen oder loker gemacht werden kann. Der Schlüssel
ist unzertrennlich mit der Röhre verbunden, weßhalb er nie verlegt werden kann, und
braucht nur umgedreht zu werden.
I. Gußeiserne Röhren. Die
Vereinigung der Röhrenstüke bewerkstellige ich vermittelst Muttern und Schrauben;
anstatt jedoch die Muttern abgesondert von den Röhren zu gießen, wie dieß sonst
geschieht, gieße ich zu jedem Röhrenstük eine Mutter, welche dasselbe lose
umschließt, ohne sich jedoch von ihm trennen zu lassen. Beide Theile, Röhre und
Schraubenmutter, gieße ich in einer und derselben Operation. Zur Herstellung des
Innern der Röhre nehme ich einen glatten Kern aus Lehm, Sand oder einem sonstigen
geeigneten Material; auf der äußeren Seite erhält diese Röhre am einen Ende eine
Schraube und am andern Ende einen glatten hervorspringenden Rand (Flantsche). Ein
zweiter Kern, welcher eine Schraubenmutter enthält, ist ausgehöhlt, damit sich der
erste Kern hindurchsteken lasse, und weit genug, um dem das Aeußere der Röhre
bildenden Metalle den Durchfluß zu gestatten. An der äußern Fläche dieses zweiten
Kernes ist eine Vaterschraube von derselben Tiefe und Weite eingeschnitten, wie die
an dem Röhrenende befindliche Schraube, so daß die über die Röhre zu gießende Mutter
in ihrem Innern genau die der Vaterschraube entsprechenden Schraubenwindungen
enthält. Der Durchmesser der Mutter ist an der engsten Stelle kleiner als der
Durchmesser der oben erwähnten Flantsche, so daß die Mutter weder aus Sorglosigkeit,
noch mit Absicht von der Röhre abgestreift werden kann. Nachdem beide Kerne so weit
hergestellt worden sind, kommen sie in die Gießflaschen und werden darin auf die in
Gießereien übliche Art befestigt. Hierauf wird das Metall eingegossen, und Röhre und
Mutter auf einen Guß hergestellt. Nachdem sich das Metall abgekühlt hat, entfernt
man den Sand oder Lehm und beseitigt die in Folge schlechten Formens etwa sich
vorfindenden Auswüchse auf die gewöhnliche Weise mit Hülfe von Handwerkzeugen.
Fig. 26 stellt
zwei mit einander verbundene Röhrenstüke von der oben erwähnten Beschaffenheit dar.
Beide fassen an der Vereinigungsstelle einen Ring oder eine Scheibe E zwischen sich. Man sieht, wie die beide Röhrenstüke
umschließende Mutter das Flantschenende der einen Röhre erfaßt und auf das Ende der
andern Röhre geschraubt ist. Sämmtliche zu einem System gehörige Röhrenstüke und
Muttern müssen nach einem und demselben Muster gebildet seyn. Wenn ein
unvollkommenes oder schadhaft gewordenes Röhrenstük herausgenommen oder an einer lek
gewordenen Fuge eine neue Zwischenscheibe eingesezt werden soll, so braucht man nur
die Paar Schraubenmuttern, welche die Röhre festhalten, mittelst eines Schrauben
schlüssels loszuschrauben, das neue Röhrenstük oder die neue Zwischenscheibe
einzufügen und wieder festzuschrauben. Die Muttern lassen sich so fest aufschrauben,
als man nur will, und da sie mit den Röhren aus gleichem Metall bestehen, so wird
ihre Haltfähigkeit durch die Wirkung der Expansion und Contraction nicht leicht
geschwächt; deßhalb ist auch, so lange die Zwischenscheiben in gutem Zustande sich
befinden, weiter
nichts, als ein gelegentliches Anziehen der Schraubenmuttern nöthig, um die Fugen
dampf- oder wasserdicht, oder sogar gas- und luftdicht zu
erhalten.
II. Schmiedeiserne Röhren.
Sind die Röhren von Schmiedeisen, so lasse ich ihnen durch Ziehen von Innen und
Außen einen durchaus gleichmäßigen Durchmesser geben. Ueber jede Röhre schiebe ich
eine gußeiserne Mutter F1 und ein Schraubenstük
F2, Fig. 27; sodann erhize
ich die Enden der Röhre nach einander, steke einen runden Metallzapfen in dieselben,
damit die Röhre nach Innen keine Compression erleiden kann und stelle vermittelst
Hämmerns oder auch dadurch, daß ich die Röhre wiederholt erhebe und auf eine harte
Metallfläche herabfallen lasse, die Ränder oder Flantschen f,
f her, welche so weit hervorstehen, daß weder die Mutter noch die Schraube
darüber hinweggehen kann. Solche zwei Röhren lassen sich dann leicht mit einander
verbinden, indem man die Mutter F des einen Röhrenendes
auf die Schraube F2 des gegenüberstehenden
Röhrenendes schraubt, nachdem wie gewöhnlich irgend eine weiche Substanz zwischen
beide Röhrenenden eingefügt worden ist. Man kann auch, wie Fig. 28 zeigt, jeder
Röhre zwei rechts und links gewundene Schraubenstüke geben, und die Vereinigung
derselben durch eine gleichfalls rechts und links gewundene Schraubenmutter
bewerkstelligen.
III. Weiche Metallröhren, z.
B. bleierne, verbinde ich vermittelst eiserner oder messingener Schrauben ganz auf
die so eben beschriebene Weise, nur daß noch eine dünne metallene Zwischenscheibe
dazu kommt, und die Flantschen durch einfaches Kalthämmern, oder durch Compression
hergestellt werden.
Anstatt die Flantschen auf die mit Bezug auf Fig. 27 und 28
beschriebene Weise herzustellen, kann man auch Metallringe auf die Röhrenenden
treiben und vermittelst Schrauben oder Nietnägeln in der Fig. 29 dargestellten Art
befestigen. Diese Methode liefert jedoch, so bequem sie auch in manchen Fällen ist,
keine so dichte Verbindung wie die anderen und dürfte daher nicht vorzugsweise zu
empfehlen seyn.
Fig. 30 stellt
eine Anordnung dar, um den Röhren für die Verlängerung und Verkürzung in Folge der
Temperaturveränderungen den nöthigen Spielraum zu geben. A und B sind zwei Röhren. Die erstere ist an
ihrem Ende glatt bis auf einen unten näher zu erwähnenden hervorspringenden Stift
F, das Ende der lezteren besizt dreierlei
Durchmesser, nach denen es sich stufenweise erweitert; der erstere 1, 1 derselben
ist mit demjenigen der Röhre A gleich, die andern 2, 2
und 3, 3 sind größer. Die Röhre B endigt sich in eine
Schraube C. D ist eine
Mutter, deren Gewinde den Gewinden der Schraube C entsprechen. E′ ist ein röhrenförmiger Ring, welcher über die
Röhre A geschoben und bis auf den Boden der Mutter D vorgestoßen wird; F ein in
die Röhre A eingelassener Schraubenstift, dessen
hervorspringender Theil in eine Vertiefung G, Fig. 30 und
31,
greift, die sich längs des Theiles 2, 2 der Röhre B
erstrekt. Die äußere Seite der Röhre A wird von a bis b mit Hanf, Garn oder
dergleichen dicht umwunden und zwar bis zu einer Tiefe, die der Differenz zwischen
den Durchmessern 2 und 3 der Röhre B ziemlich gleich
kommt. Hierauf wird ein Metallring E2 über die Röhre A
geschoben, bis derselbe gegen das Ende b der eben
erwähnten Liederung stößt. Nun schiebt man die Röhre B
über die Röhre A, ihre Hanfliederung und den Ring E, worauf die Mutter D so
weit auf das Schraubenende C geschraubt wird, bis die
Liederung von a bis b
zwischen dem Röhrenring E1, dem Ring E2 und der Schulter H der Röhre B stark genug comprimirt ist. Auf diese Weise ist
zwischen beiden Röhren eine Verbindung hergestellt, welche, ohne die Ausdehnung und
Contraction in der Länge zu beeinträchtigen, für alle gewöhnlichen Fälle als
vollkommen dicht und gut sich erweist. Die Röhre A kann
in die Röhre B innerhalb der Röhrenweite 2, 2, so weit
man es für gut findet, eingefügt werden, wenn nur der für die Ausdehnung des Metalls
nöthige Spielraum I gelassen wird. Der in dem
Einschnitte G gleitende Stift gestattet die vor-
und rükgängige Bewegung der Röhre A innerhalb dieses
Einschnittes, und verhütet zugleich die Trennung beider Röhren. Denn angenommen, die
Röhre A würde bis zu dem Ende der Röhrenweite 2, 2
herausgezogen, so würde doch der Stift F gegen den Ring
E2 und die
Liederung zwischen a und b
anschlagen und jede Weiterbewegung in dieser Richtung hindern. Der größeren
Sicherheit wegen kann man auch zwei oder mehrere solcher Stifte F mit entsprechenden Einschnitten G anbringen. Die beschriebenen Vorkehrungen, um dem Einflusse der
Temperaturveränderungen auf die Verlängerung und Contraction der Röhren zu begegnen,
brauchen bei einem Röhrensystem nur von Streke zu Streke angeordnet zu werden, z. B.
da wo die Röhrenleitung einen Winkel bildet oder durch Mauern geführt werden
soll.
Tafeln