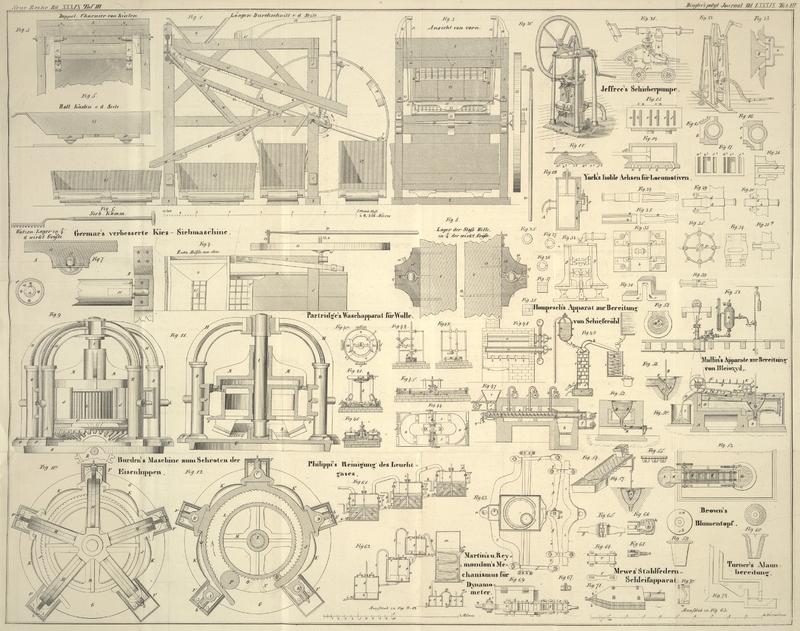| Titel: | Jeffree's patentirte Schieberpumpe. |
| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. XLIV., S. 173 |
| Download: | XML |
XLIV.
Jeffree's patentirte Schieberpumpe.
Aus dem Mechanics' Magazine. August 1842, S.
145.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Jeffree's patentirte Schieberpumpe.
Die Verbesserungen, welche den Gegenstand dieses Patentes bilden, sind wegen ihrer
sinnreichen Einrichtung und großen Einfachheit bemerkenswerth. Die Hauptverbesserung
besteht darin, daß bei Saugpumpen die gewöhnlichen beweglichen Ventile, welche so
leicht in Unordnung gerathen, wegfallen. Jeffree's
Apparat zeigt eine unverkennbare Analogie mit dem Schiebventil-System der
Dampfmaschinen, weicht jedoch in den Details von demselben ab.
An die Seiten des Pumpenstiefels befestigt der Patentträger eine glatt gearbeitete
rectanguläre Holz- oder Eisenfläche, welche mit sechs rectangulären
Oeffnungen a, b, c, d, e, f, Fig. 13, versehen ist.
Diese Oeffnungen stehen mit verschiedenen, in dem Körper des genannten Stükes
angebrachten Canälen, welche in Fig. 14, 15 und 16 in verschiedenen
Durchschnitten dargestellt sind, in Verbindung. Die Oeffnungen a und f communiciren mit den
Canälen, welche zu beiden Seiten des Kolbens in den Pumpenstiefel fuhren, wie der
Horizontaldurchschnitt Fig. 14 zeigt; die
Oeffnungen b und d führen,
wie der Verticaldurchschnitt Fig. 15 andeutet,
aufwärts nach den Ausflußröhren, während die Oeffnungen c und e, Fig. 13 und 16, abwärts
nach dem Brunnen führen. Die Ausfluß- und Speisungsröhren sind in den
Zeichnungen als unwesentlich weggelassen. An das glatte geebnete Stük Fig. 13 paßt
ein anderes glattes Stük Fig. 17, welches mit
sechs rectangulären Oeffnungen a2, b2, c2, d2, e2, f2 versehen ist, die nach den Canälen des Stükes
Fig. 17
führen; beide Theile communiciren auf die in dem Horizontaldurchschnitte Fig. 18
angedeutete Weise mit einander. An der Außenseite dieses Stükes ist eine Stange g, Fig. 18 parallel der
Kolbenstange befestigt, die sich, durch eine und dieselbe Kraft getrieben,
gleichzeitig mit der leztern hin- und herbewegt. Um die Parallelbewegung des
Schiebers Fig.
17 zu sichern, kann man ihn zwischen zwei an dem Theile Fig. 13 hervortretenden
Flantschen gleiten lassen; bei kleineren Pumpen ist jedoch diese Maßregel nicht
nöthig.
Das Spiel der Pumpe ist nun folgendes. Angenommen, der Kolben befinde sich am Boden,
so deken sich die Theile Fig. 13 und 17 vollkommen,
und die Oeffnungen und festen Theile beider Flächen befinden sich in einer solchen
Stellung zu einander, daß die nach dem Stiefel, die nach den Ausflußröhren und die
nach dem Brunnen führenden Oeffnungen a und b, b und d, c und e frei, die andern aber geschlossen sind. Wird nun der
Kolben in die Höhe gezogen, so steigt das Wasser in Folge des entstehenden Vacuums
aus dem Brunnen durch die Oeffnung e des Stükes Fig. 13 in die
Oeffnung e des Stükes Fig. 17 und tritt von da
durch die Oeffnung f, Fig. 13, in den
Pumpenstiefel. Beim rükgängigen Kolbenhub wird das gehobene Wasser durch die
Oeffnungen f und d aus dem
Stiefel in die obere mit der Oeffnung d in Verbindung
stehende Ausflußröhre hinausgetrieben. Zugleich veranlaßt das hinter dem Kolben
entstehende Vacuum das Aufsteigen des Wassers aus dem Brunnen; das Wasser tritt
durch die Oeffnungen b und a
in den Stiefel, um bei dem folgenden Hub entleert zu werden. Die Pumpe ist demnach
doppeltwirkend, und wenn man die mit den Oeffnungen b
und d in Verbindung stehenden Ausflußröhren in eine
gemeinschaftliche Röhre sich einmünden läßt, so wird das Wasser in einem
ununterbrochenen Strom ausgegossen werden.
Eine Pumpe dieser Art kann offenbar nur durch Verstopfung einer der Röhren in
Unordnung kommen. Dieser Uebelstand läßt sich jedoch einfach dadurch beseitigen, daß
man den Theil Fig.
17 abnimmt, und das Hinderniß entfernt, worauf die Pumpe wieder brauchbar
wie zuvor ist.
Eine andere Construction dieser Pumpe, welche mit dem Schiebventile der
Dampfmaschinen noch mehr Aehnlichkeit hat, ist durch Fig. 19 dargestellt,
welche die mit einem Schiebventil gewöhnlicher Art versehene Pumpe zeigt. Das durch
die Röhre A aufsteigende Wasser strömt durch einen rund
um den Pumpenstiefel laufenden Canal nach der Oeffnung B
und tritt von da durch einen Canal a in den Cylinder,
während gleichzeitig das in dem Raum unter dem Kolben befindliche Wasser durch den
Canal b in den Schieberkasten gedrükt wird und bei C ausfließt.
Tafeln