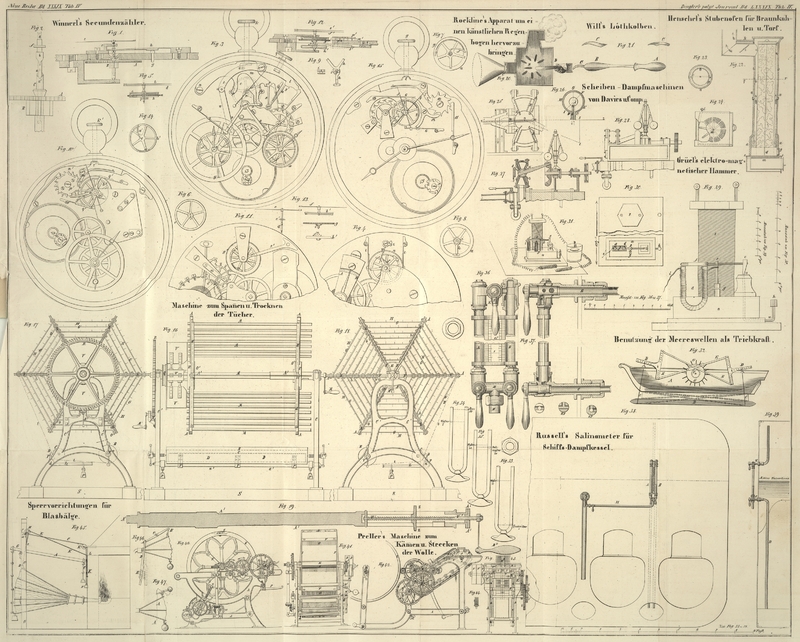| Titel: | Beschreibung mehrerer Secundenzähler von Hrn. Winnerl, Uhrmacher in Paris. |
| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. LXX., S. 268 |
| Download: | XML |
LXX.
Beschreibung mehrerer Secundenzaͤhler von
Hrn. Winnerl, Uhrmacher
in Paris.
Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement. Mai
1843, S. 192.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Winnerl's Secundenzähler.
Einfacher Zähler.
Fig. 1 ist ein
verticaler Längendurchschnitt eines Secundenzählers, welchen Hr. Winnerl im Jahre 1831 erfunden hat. Fig. 2 ist eine Ansicht
der Secundenradachse für diesen Zähler. Beide Ansichten sind im vergrößerten
Maaßstabe gezeichnet.
Das Secundenrad A ist auf einem hohlen Getriebe
befestigt, das jedoch nicht ganz durchbohrt ist, so daß auf der einen Seite ein
kleiner Zapfen angedreht werden konnte. Der Zapfen C auf
der Platte, welcher gewöhnlich den Secundenzeiger trägt, ist aus einem Röhrchen
gebildet, das sich in zwei schiefe Ebenen a endigt, auf
deren Grunde eine kleine Kerbe a′ angebracht ist.
Der Schaft, welcher in dem Röhrchen sich auf- und abbewegen läßt, trägt einen
Ring b, der sich in einen Schnabel endigt, welcher mit der
kleinen Kerbe a′ in Eingriff kommt, sobald dieser
Schaft auf dem Grunde des Röhrchens aufsteht. Eine stählerne Brüke c, welche auf der Platte befestigt ist, ist mit einem
Loche versehen, in welchem sich der Zapfen des Schaftes d, der den Secundenzeiger e trägt, frei dreht.
Unter dieser Brüke ist der Zapfen bis zum Ansaze f
verstärkt, damit dieser Theil ohne Spiel zu haben, in das Loch der Brüke eintreten
kann. Aus dieser Anordnung folgt, daß, wenn man den Schaft hebt, bis der Ansaz f an der Brüke ansteht, die Spize der schiefen Ebenen
a unter dem Schnabel des Ringes b vorbeigehen kann, ohne ihn zu berühren.
Wenn man den Secundenzeiger stille stellen will, drükt man auf einen Drüker, der
mittelst des Nagels g schnell die Feder h, welche auf der Platte aufgeschraubt ist, in die Höhe
treibt. Das Ende dieser Feder, welches gabelförmig gespalten ist, hebt den Ansaz f unter die Brüke c und hält
ihn da fest, während das Rad A unabhängig von dem Zeiger
seinen Gang fortsezt. Wenn aber der Drüker zurükgezogen wird, so drükt die Feder h auf den Ring b, dessen
Schnabel, indem er auf den schiefen Flächen a gleitet,
den Schaft mit dem Secundenzeiger drehen wird, bis er in die Kerbe a′ zu liegen kommt, von wo aus dann beide mit
einander sich drehen werden. Zu gleicher Zeit legt sich die Feder h auf einen kleinen Vorsprung unter der Brüke c, so daß sie weder den Ring b, noch den Ansaz f berührt.
Secundenzähler, um sowohl den Anfang als
das Ende von Beobachtungen notiren zu können (Compteur gardeobservation).
Fig. 3 ist die
Ansicht des Mechanismus, welcher unter dem Zifferblatt eines solchen Secundenzählers
angebracht ist, den Hr. Winnerl im Jahr 1838 erfand.
Dieser Zähler trägt auf drei abgesonderten Zifferblättern, für die Stunden, die
Minuten und Secunden, doppelte Zeiger, wovon die einen durch einen Druk auf einen
Knopf stille gestellt werden können, um genau den Anfang der Beobachtung anzuzeigen,
während die anderen fortgehen, bis ein Druk auf einen zweiten Knopf sie wieder in
Bewegung sezt, um das Ende der Beobachtung anzuzeigen, indem sie die zwischen Anfang
und Ende verflossene Zeit, welche jedoch von beliebiger Dauer seyn kann, fortwährend
beibehalten, bis die Beobachtung notirt ist. Indem man nun diesen Knopf wieder
zurükzieht, stellen sich die Zeiger wieder über einander, um eine neue Beobachtung
anzufangen.
Der Mechanismus, um den einen Secundenzeiger stille zu stellen, und ihn wieder in Gang zu
bringen, indem die zwischen Anfang und Ende der Beobachtung verflossene Zeit
zwischen beiden Zeigern beibehalten wird, ist der nämliche wie der für die
Minuten- und Stundenzeiger.
Das Secundenrad a von 80 Zähnen ist auf einer Achse
befestigt, welche den oberen Zeiger b von blau
angelassenem Stahle trägt. Auf diese Achse ist eine Scheibe c frei aufgestekt, und wird daselbst durch einen Stift, welcher sich in
einer Nuth der Achse dreht, gehalten. Auf der hohlen Nabe der Scheibe c ist ein goldener Zeiger d
(Fig. 5)
befestigt. Diese Scheibe trägt eine stählerne Platte e
Fig. 6 mit
zwei schiefen Ebenen, welche zusammen die Form eines Herzes bilden. Auf dem
Secundenrade Fig.
7 ist mittelst eines Stiftes ein Sperrkegel f
befestigt, der durch die Feder g so angedrükt wird, daß
wenn die Scheibe frei ist, dieser Sperrkegel, indem er auf den schiefen Ebenen des
Herzes e
Fig. 6
gleitet, die Scheibe so lang dreht, bis er an dem dem Mittelpunkte am nächsten
gelegenen Punkte des Herzes ankommt, und so die Lage der beiden Zeiger übereinander
wieder herstellt.
Auf der anderen Seite des Secundenrades a ist eine Feder
h, Fig. 8 befestigt, welche
mit zwei Armen versehen ist, die an ihren Enden Vorsprünge tragen, welche durch das
Secundenrad sezen, und sich gegen die Scheibe c
andrüken. Auf dieser Seite der Secundenradachse dreht sich frei ein Stern i, welcher durch den einen seiner beiden Hebel j, die sich auf der Nabe des Sternes befinden, in einer
Kerbe der Feder h zurükgehalten wird. Fig. 9 stellt zwei
Ansichten dieser Vorrichtung dar. Die Feder ist überdieß noch mit einer schiefen
Ebene versehen, so daß, während der Stern sich dreht, der Hebel unter dieser
schiefen Ebene weggleitet, die Feder hebt, und so die Scheibe frei macht.
Fig. 3 zeigt
die Lage der einzelnen Theile, während die doppelten Zeiger auf den drei
Zifferblättern miteinander gehen. Indem man nun beim Anfange der Beobachtung auf den
Knopf k drükt, werden die drei Scheiben c, welche bisher frei waren, mit ihren goldenen Zeigern
d durch den Druk der Federn l gegen die Ränder derselben festgehalten. Dieß geschieht auf folgende
Weise. Das Stük m, welches sich um seinen Zapfen n dreht, bewegt das dreiarmige Stük o, mit welchem es verbunden ist, und welches die Federn
der Stunden und Minutenscheiben frei macht. Während dieser Bewegung macht dasselbe
Stük m mittelst zweier Warzen p, p, womit es versehen ist, die Federn l, l der Secundenscheibe
frei. (S. Fig.
4.) Zur selben Zeit schiebt die schiefe Ebene r in der Kerbe des Stükes m das zweiarmige
Stük s, s zurük, und macht
das Stük t frei, welches hierauf zu seiner Zeit mittelst des
zweiten Knopfes q eingedrükt werden kann. Der auf das
Stük t durch den Knopf ausgeübte Druk bringt, sey es nun
direct durch den Stift z, womit es versehen ist, oder
mittelst des Zwischenstüks u, womit es vergliedert ist,
eine Veränderung der Lage der Stüke v hervor, deren
Enden Federn bilden und die Sterne i bewegen. Auf diese
Weise greifen die Hebel j in die Kerben der Federn h ein, und diese Federn drüken nun mit ihren Ansäzen auf
die Scheiben c, um sie mit ihrem zugehörigen
Secundenrade, oder Minutenrade x oder Stundenrade y zu vereinigen. Zu gleicher Zeit schiebt der Zapfen z des Stükes t, welches
durch ein Loch in dem Stük m sezt, das Stük m zurük, und hebt die Federn l, l, um den mit ihren Rädern vereinigten
Scheiben die Drehung zu gestatten. Diese behalten dann ihre auf die Zeitdauer der
Beobachtung sich beziehenden Stellungen gegen einander bei.
Während dieß Alles geschieht, spannen sich die Arme s,
s′, welche sich federn und durch die schiefe
Ebene in der Kerbe des Stükes m zusammengedrükt waren,
ab, und der eine davon, s, kommt unter den Ansaz des
Stükes m zu stehen, so daß keine Bewegung desselben mehr
möglich ist.
Indem man nun das Stük t mittelst des Knopfes q zurükzieht, um die Beobachtung zu vertilgen, geschieht
die Bewegung der Stüke v, v
in entgegengesezter Richtung, um die Sterne i in
entgegengesezter Richtung zu drehen. Die kleinen Hebel j
heben die Federn h, indem sie unter den schiefen Ebenen
derselben weggleiten, und die Scheiben welche nun frei geworden sind, werden durch
die Sperrkegel f so weit gedreht, bis die goldenen
Zeiger sich wieder unter den stählernen befinden, um nun mit diesen ihren Gang
fortzusezen. Das Stük s, gedrängt durch seine Feder,
nimmt seine frühere Stellung wieder ein, und der kürzere Arm desselben stellt sich
vor die Kerbe r des Stükes m, um eine neue Beobachtung möglich zu machen.
Fig. 10 stellt
einen Zähler dar, den Hr. Winnerl im Jahr 1840 erfunden
und ausgeführt hat. Er ist mit zwei Secundenzeigern versehen, welche man den einen
nach dem anderen durch einen Druk auf einen Knopf stille stellen kann, um desto
bequemer die Anzahl Secunden und deren Bruchtheile, welche zwischen dem Anfange und
dem Ende der Beobachtung verflossen sind, ablesen zu können. Sie bleiben beide
stille gestellt, indem sie ihre Entfernung beibehalten, bis ein dritter Druk auf den
Knopf sie schnell auf die Stelle bringt, welche sie eingenommen hätten, wenn sie
unausgesezt fortgegangen wären.
Um diesen Mechanismus zusammenzusezen, hat Hr. Winnerl
beide Arten von schiefen Ebenen, wie sie bei den Zählern 1 und 3 angewandt wurden, benuzt, mit
dem Unterschiede daß hier der Sperrkegel a′ auf
der Scheibe b′ (Fig. 14) unmittelbar
befestigt ist, während das herzförmige Stük c′
(Fig. 13)
mit der Achse d′, welche den stählernen
Secundenzeiger e′ trägt, vereinigt ist. Die
Scheibe b′ ist oberhalb des Herzes c′ frei auf die Achse d′ aufgestekt und trägt auf ihrer hohlen Nabe den goldenen
Secundenzeiger f′, während auf der anderen Seite
das Secundenrad g′, welches durch einen Stift
gehalten wird, der in eine Nuth der Achse eingreift, sich frei drehen kann.
Das Ende der stählernen Nabe des Secundenrades g′
bilden zwei schiefe Ebenen i′, ähnlich denen am
Zapfen a
Fig. 2.
Unterhalb dieser schiefen Flächen ist auf der Achse d′ eine Feder h′ befestigt, welche
eine kleine Platte j′ trägt, die mit einem
Schnabel versehen ist, welcher auf den Grund der schiefen Flächen i′ eingreift. Diese Platte kann zurükgedrükt
werden, so daß das Secundenrad sich frei um die Achse d′ drehen kann, ohne daß das Ende seiner Nabe den Schnabel der Feder
berührt.
Wenn man auf den Knopf k′ beim Anfange einer
Beobachtung drükt, wird die Scheibe b′ mit ihrem
goldenen Zeiger f′ stille gestellt, während die
Achse d′ mit dem stählernen Zeiger e′, die mit dem Secundenrade g′ durch den Druk des Schnabels der Feder h′ auf den Grund der schiefen Flächen verbunden
ist, ihre Bewegung fortsezen wird, bis ein neuer Druk auf den nämlichen Knopf k′ beim Ende der Beobachtung die Feder h′ durch ihre Platte j′ zusammendrükt, um nun auch die Achse d′ mit dem stählernen Zeiger e′
stille zu stellen.
Das Secundenrad g′ wird seinen Gang fortsezen, bis
ein dritter Druk auf den Knopf k′ den Schnabel
der Feder h′ auf die schiefe Fläche i′ gelangen läßt. Die Feder wird sich hierauf mit
der Achse drehen, bis der Schnabel auf dem Grunde der schiefen Flächen angekommen
ist. Zu gleicher Zeit wird der Druk des Sperrkegels a′ die Scheibe b′, welche nun mit
ihrem goldenen Zeiger f frei geworden ist, auf der
schiefen Fläche der Achse d′ drehen, bis er mit
der kleinen Kerbe des Herzes c′ zusammen
kommt.
Auf diese Art wird die Uebereinanderlage der beiden Zeiger wieder hergestellt seyn,
und geführt durch die schiefen Flächen i′ des
Secundenrades g′, werden diese Zeiger sich an der
nämlichen Stelle befinden, als wenn sie gar nicht stille gestellt worden wären, und
so mit einander fortgehen.
Wir wollen nun den Mechanismus beschreiben, welcher die Zeiger in Thätigkeit
sezt.
Indem man beim Anfange der Beobachtung auf den Knopf k′ drükt,
schiebt das Stük l′ (Fig. 10) mit seinem
Sperrhaken m′ das Sperrrad n′ um einen Zahn weiter. Zu gleicher Zeit fällt das Stük o′ in den Ausschnitt einer Platte p′, welche auf das Sperrrad n′ aufgeschraubt ist.
Die zwei Federn q′, q′ werden frei und drüken nun gegen die Scheibe b′, um sie sammt ihrem goldenen Zeiger f′ aufzuhalten. Am Ende der Beobachtung treibt durch einen zweiten
Druk auf den Knopf k′ das Stük l′ von Neuem das Sperrrad n′ vorwärts, und die Löcher mit schiefen Flächen, welche sich darin
befinden, drüken den Zapfen r′ (Fig. 12) heraus, der dann
mittelst einer Feder s′, deren gabelförmiges Ende
sich auf die kleine Platte j′ stüzt, die Feder
h′ zusammendrükt, und so auch den stählernen
Zeiger e′ stille stellt, während das Secundenrad
seinen Gang fortsezt.
Durch einen neuen Druk auf den Knopf fällt der Stift r′ in ein zweites Loch im Sperrrade n′ und gestattet der Feder h′ sich
wieder auszudehnen. Zu gleicher Zeit ist das Stük o′ aus seinem Einschnitte ausgetreten, und entfernt die Federn q′, q′, um die
Scheibe b′ frei zu machen, worauf dann die Zeiger
ihre gehörige Stelle einnehmen und mit einander vorwärts gehen werden.
Bei dem Zähler Fig.
15 hat Hr. Winnerl einen Theil des in Fig. 10
dargestellten Mechanismus angewandt und ihn bei Secundenuhren, welche eine
hinreichende Höhe haben, unter dem Zifferblatte angebracht. Indem er die Dike des
neuen Secundenzapfens ein wenig vermehrt und seine Verlängerung konischer macht,
bringt er das stählerne herzförmige Stük 1 durch Reibung darauf an, und zwar in
einer solchen Enfernung, daß das Oehl des Zapfens es nicht erreichen kann. Auf der
Verlängerung des Zapfens läßt er die Scheibe 2 mit ihrem Sperrkegel 3, der mit einer
Feder wie in Fig.
14 versehen ist, sich frei drehen. Die hohle Nabe der Scheibe trägt den
goldenen Secundenzeiger 4. Auf das Ende des Zapfens ist der stählerne Zeiger 5 in
einer kleinen Entfernung, welche der hohlen Nabe der Scheibe zu spielen erlaubt,
aufgestekt. Die zwei gleich starken Federn 6,6, welche gleichzeitig gegen die
Scheibe drüken, geben dem Zapfen des Secundenrades hinreichende Freiheit.
Es bleibt nur noch eine leichte Reibung des Sperrkegels um die Herzscheibe, deren
Rand abgerundet ist. Der Sperrhaken 7, welcher auf das Stük 8 aufgeschraubt ist,
trägt an seinem Ende zwei Zähne, deren Entfernung gleich ist der Hälfte der
Entfernung zweier Zähne auf dem Sperrrade 10.
Wenn man nun auf den Drüker 9 drükt, so wird der Sperrhaken das Sperrrad um die
Hälfte eines Zahnes drehen, und die Springfeder 11, deren Ende ebenfalls doppelt
ist, wird das Sperrrad
entweder an einem, oder zwischen zwei Zähnen festhalten. Auf diese Weise werden die
Zähne des Sperrrades nach der Reihe vor das Stük 12 zu stehen kommen, welches, indem
es die Federn 6, 6 hebt, die Scheibe 2 frei macht. Der Sperrhaken 3 wird, indem er
auf der schiefen Ebene des kleinen Herzes gleitet, den goldenen Zeiger 4 unter den
stählernen 5 bringen.
Tafeln