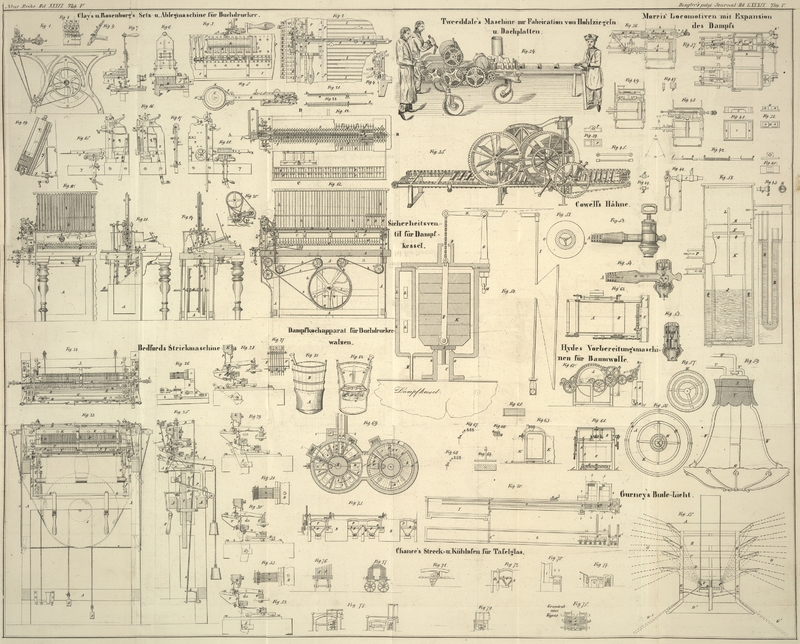| Titel: | Verbesserungen an Strikmaschinen, worauf sich William Bedford, Strumpfwirker zu Hinckley, Leicestershire, am 17. Sept. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. LXXXV., S. 329 |
| Download: | XML |
LXXXV.
Verbesserungen an Strikmaschinen, worauf sich
William Bedford,
Strumpfwirker zu Hinckley, Leicestershire, am 17. Sept. 1840 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts. Mai 1843, S.
263.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Bedford's Strikmaschine.
Diese Verbesserungen bestehen in neuen Anordnungen und Vereinfachungen in der
Construction des Strumpfwirkerstuhls, wodurch die Production sehr befördert und der
Arbeitsaufwand vermindert wird.
Fig. 23 ist
eine Frontansicht der verbesserten Maschine, Fig. 24 ein Grundriß und
Fig. 25
ein senkrechter Querschnitt derselben nach der Linie z
z, Fig.
23, ungefähr durch die Mitte der Maschine. Die übrigen Figuren stellen
abgesonderte Maschinentheile in einem größeren Maaßstabe dar.
Auf dem hölzernen Maschinengerüste A, A, A sind die eisernen
Träger B, B, B befestigt, auf denen die wirksamen Theile der Maschine
gelagert sind. Das vordere Trägerpaar ist durch eine Stange C, C, die Hauptstange, verbunden, die sich
horizontal durch die Maschine erstrekt. Eine Reihe in Blei eingesezter Bartnadeln
a, a, a von gewöhnlicher Form ist auf einer horizontalen
Schiene D, D befestigt.
Diese Schiene ist an zwei Rädergestelle E, E befestigt, welche auf den Bahnschienen b, b hin- und
herlaufen, und bildet mit ihren Gestellen einen Wagen, mit dessen Hülfe die Nadeln
vorgerükt und zurükgezogen werden, wie aus Fig. 26 deutlicher
erhellt, die einen Theil der Nadelschiene mit ihrem Rädergestell und der Bahn,
worauf das leztere läuft, im Grundrisse darstellt. An der Vorderseite der
Hauptstange C ist eine Preßschiene F festgeschraubt, deren Zwek unten näher erläutert
werden soll. Eine Reihe von Armen c, c, c ist um eine Stange d in einem Kamm e drehbar.
Lezterer ist an der stationären Stange G befestigt,
welche durch Querstangen f, f unterstüzt ist, die mit den vordern und hinteren Trägern verbunden sind.
Von jedem der Arme c hängt an einem Nietstift h
ein „Sinker“
g herab.
Eine Reihe dünner gekrümmter Metallstüke i, die
sogenannten Theiler, ist unter der Preßschiene in einer
an die Hauptstange geschraubten Stange k befestigt.
Diese Theiler haben den Zwek, das ganze Fabrikat in gleiche Maschen zu theilen.
Das Strikgarn ist auf einer über der Maschine angeordneten Spule aufgewikelt, und
nimmt von da seinen Weg durch einen Führer l, welcher
längs der Fronte der Maschine hin- und hergeht. Dieser Fadenführer l ist eine kleine Röhre, die mittelst eines Arms m an den mit einer Längenschiene H fest verbundenen Schieber n befestigt ist.
Dieser Schieber wird mit Hülfe der mit dem Rade I
verbundenen Schnüre o, o und
der Tretschämel J, J* in
hin- und hergehende Bewegung gesezt.
Bei Beginn der Arbeit befinden sich alle Maschinentheile in der Fig. 25 dargestellten
ruhenden Lage. Die Arme c, c, c werden alle durch eine Reihe an einer
Längenschiene K befestigter krummer Federn in die Höhe
gehalten, und ihre seitliche Bewegung wird durch einen Führerkamm q beschränkt. Nachdem die Arbeit auf die gewöhnliche
Weise auf die Nadeln gelegt worden ist, so drükt der vor der Maschine sizende
Arbeiter den Tretschämel J mit seinem Fuße nieder,
wodurch die Schnurscheibe I um einen Bogen gedreht und
die Schnur o veranlaßt wird, den Schieber n und den Fadenführer l nach
der linken Seite hin zu bewegen, so daß sich der Faden über die oberen Seiten der
Nadeln legt. An die Schnurscheibe I sind auch noch
andere Schnüre t, t
befestigt, welche über die an der festen Schiene L
befindlichen Rollen gehen, und mit dem Wagen der Theile (slur-cocks) M verbunden sind. Die
Schnüre t, t werden etwas
schlaff gemacht, so daß sich der Schieber mit dem Führer bereits eine kleine Streke
vorwärts bewegt hat, ehe die Schnüre t, t gespannt werden. So folgen die Theile M den Führern, um die Arme und Sinker unmittelbar,
nachdem der Faden über die Nadeln gelegt worden ist, niederzudrüken; dadurch werden,
wie der partielle Fxontaufriß Fig. 27 und der
Querschnitt Fig.
28 zeigt, zwischen je zwei Nadeln Maschen gebildet. Fig. 27 stellt einen
Theil der Preßschiene F, einige Sinker g und einige Nadeln a, a, a dar; Fig. 28 ist ein
Querschnitt mit den Theilern und dem Nadelwagen. Die Länge der Maschen wird auf die
gewöhnliche Weise durch die Stellung der Fallschiene j
regulirt.
Der Schieber besteht aus zwei Theilen. Den einen Theil bildet eine leichte Schiene
r, r, an deren Enden die Schnüre o, o befestigt sind. Diese
Schiene geht durch Schlize in Trägern, die sich von dem Schieber n aus erstreken, und wird durch eine Feder s mit dem Schieber in Berührung erhalten. Hieraus folgt,
daß sich durch Anziehen der Schnur o die Schiene r und der Schieber n mit den
Armen m und der Röhre l alle
mit einander fortbewegen, bis der Schieber durch die adjustirbaren Hälter u, u, welche zur Regulirung
der Breite des Fabricates angeordnet sind, aufgehalten wird. Die Schiene r kann indessen vermittelst des leichten Drukes der
Feder s noch weiter gleiten, um die Schnur o wieder in den Zustand der Spannung zu bringen. Der
Theil M hat, wie bei gewöhnlichen Strikmaschinen, den
Zwek die Arme und Sinker niederzudrüken.
Die folgende Bewegung wird durch Erhebung der Handhaben N, N hervorgebracht. Diese Handhaben sind an einer
longitudinalen Stange O befestigt, deren Enden mit zwei
senkrechten um v drehbaren Hängehebeln S, S verbunden sind. Die
Erhebung der Handhaben N und der Hebel S hat zunächst den Erfolg, daß die an die Schiene O befestigten Arme w von den
an den unteren Theilen der Hebel P, P befindlichen Hervorragungen x, x zurükgezogen werden. Diese Hebel P hängen an den festen Bolzen y, y und sind an ihren anderen Enden mit den
krummen Stangen Q, Q und den
Hebeln R, R verbunden. Die
Umdrehungsbolzen der lezteren sind in festen Trägern gelagert, die sich von den
vorderen Hauptträgern aus erstreken. Durch das Zurükziehen der Arme w von den Hervorragungen x,
x werden die Hebel P,
Q und R in Freiheit
gesezt. Da nun das Gewicht der Führerröhren l, l, ihre Arme m, m, der verschiebbare Apparat n, r und s, mit
der auf den äußeren Enden der Hebel R aufliegenden
Schiene H nicht länger durch die Hebel aufgehalten
werden, so sinken sie herab, wobei sie durch Stifte und Schlize in den Enden der
Schiene H die nöthige Führung erhalten. Die Röhren l sinken zwischen den Nadeln a, a herab und führen dadurch die Fäden unter
die Nadeln.
Die mittelst der Handhaben N erhobenen Hebel S wirken auf den Nadelwagen E. Dieß geschieht mit Hülfe einer in dem oberen Ende eines jeden Hebels
angebrachten Gabel I, welche einen am Wagen E befindlichen Stift 2 erfaßt, wie am deutlichsten aus
den Figuren
26 und 29 ersichtlich ist. Die Erhebung der Hebel S
treibt demnach den Nadelwagen, wie Fig. 29 zeigt, zurük, und
bringt die Bärte der Nadeln unter die Preßschiene F; die
vorher durch die Sinker zwischen den Nadeln verschlungenen und festgehaltenen Fäden
werden beim Zurükgehen des Wagens nach den Köpfen der Nadeln hingezogen, während die
vorher darüber gelegte Arbeit hinter den Bärten hängt. Indem der Wagen E über eine kleine an der Bahn b
angebrachte Erhöhung 3
hinweggeht, erhebt er die Nadelköpfe gegen den unteren Rand der Preßschiene, wie
Fig. 29
zeigt.
Wenn die Arbeit so weit vorgerükt ist, so müssen die Arme c in die Höhe gehoben werden, was auf folgende Weise bewerkstelligt wird.
An die oberen Enden eines jeden der Hebel S ist eine
kleine Frictionsrolle 4 befestigt, welche beim Steigen der Hebel S mit den geneigten Ebenen T
in Berührung kommt. Diese sind an Arme U, U befestigt, die an den Enden der Maschine um die
Drehungsbolzen der Arme c, c
drehbar sind. Hiedurch werden die Arme U, U in die Höhe gehoben und mit ihnen eine longitudinale
Stange V, welche, indem sie mit den unteren Theilen der
Arme c, c in Berührung
kommt, dieselben erhebt, bis sie alle, wie Fig. 30 zeigt, von den
gebogenen Federn p, p erfaßt
werden. Eine von der Rükseite der Schiene K
herabhängende Stange Z, Z
sezt der Erhebung der Arme c, c eine Gränze. Da der Nadelwagen immer noch in der Zurükbewegung begriffen
ist, so ziehen die Nadeln a, a, a, indem sie zwischen den Theilern i, i hindurchgehen, die
Maschen unter die krummen Kanten der Theiler, wie die Figuren 30 und 31 nachweisen;
dadurch werden sämmtliche Maschen gleichförmig auf die Nadeln vertheilt. Bei dieser
rükgängigen Bewegung der Nadeln werden, während ihre Bärte durch die Preßschiene F niedergehalten werden, die Maschen der bereits
fertigen Arbeit über die niedergedrükten Bärte geschoben, und wenn der Wagen am Ende
seines Laufs angekommen ist, sind die Maschen bereits über die Köpfe der Nadeln
gezogen worden und haben die Maschen unter den Bärten umfaßt, um eine neue
Maschenreihe zu bilden, wie die Figuren 32 und 33 zeigen.
Indem nun der Arbeiter die Handhaben N, N niederdrükt, wird der Wagen wieder vorwärts bewegt;
durch diese Bewegung wird das durch einen Hebelrahmen W
gehaltene Stük Arbeit gegen die hinteren Theile der Nadeln hingeschoben; die
Maschinentheile sind alsdann in den Fig. 23, 24 und 25 dargestellten Lagen
bereit, die Arbeit von neuem zu beginnen. Das Hebelgestell besizt ein Maul W*, dessen Bewegung durch Fanghaken in Gränzen gewiesen
wird, und das Ganze dreht sich um Zapfen 5, deren Lager an die Hauptträger befestigt
sind. An das untere Ende eines der Hebel W ist eine
Schnur 6 befestigt, welche über eine Rolle geschlagen und mit einem unten
angebrachten Tretschämel verbunden ist. Durch Niederdrüken des lezteren ist der
Arbeiter im Stande, die Arbeit nöthigenfalls nach den Köpfen der Nadeln
hinzubringen. Der Hebelrahmen tritt durch eine Schnur 7, woran ein Gewicht hängt, in
seine Stellung zurük.
Das Einziehen des Arbeitsstükes wird dadurch bewerkstelligt, daß man irgend eine
Anzahl beweglicher Hälter u, u in die Vertiefung der Führerschiene H einfügt,
wodurch dem seitlichen Fortschreiten des Schiebers n
Einhalt gethan wird, und um eine dichte Sahlleiste herzustellen, werden zwei an der
Vorderseite der Maschine angebrachte Schieber Y, Y auf ihrer festen Stange dergestalt adjustirt, daß die
Hervorragungen g unmittelbar unter die äußeren Arme c zu liegen kommen. Durch diese Hervorragungen werden
die von diesen äußeren Armen herabhängenden mit einer kleinen Spize versehenen
Sinker verhindert, so weit als die übrigen Sinker herabzufallen und veranlaßt kurze
Maschen zu erzeugen.
Tafeln