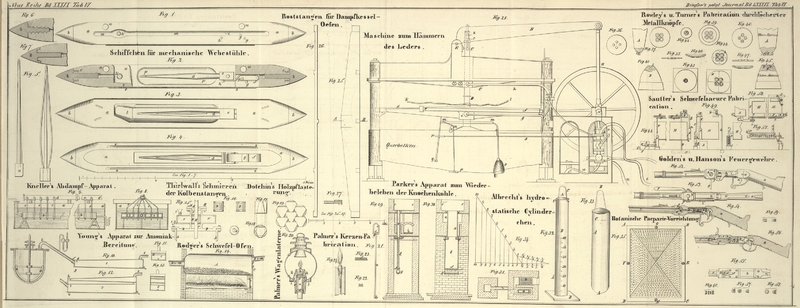| Titel: | Verbessertes Verfahren zum Wiederbeleben der Knochenkohle, worauf sich Frederick Parker im New-Gravel-lane, Grafschaft Middlesex, am 22. Jun. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. CXVIII., S. 447 |
| Download: | XML |
CXVIII.
Verbessertes Verfahren zum Wiederbeleben der
Knochenkohle, worauf sich Frederick Parker im New-Gravel-lane, Grafschaft Middlesex,
am 22. Jun. 1839 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts. August 1843, S.
28.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Parker's Verfahren zum Wiederbeleben der Knochenkohle.
Bekanntlich wird beim Raffiniren des Zukers zum Entfärben der Syrupe viel thierische
Kohle verbraucht, welche, nachdem sie eine Zeit lang benüzt wurde, wieder belebt werden muß, was durch Ausglühen derselben
bewerkstelligt wird. Man bedient sich hiezu verschiedener Vorrichtungen, wie
Retorten, Töpfe, Oefen, die während ihres Gebrauches so luftdicht als möglich
verschlossen werden und man verfuhr dabei wie folgt: man ließ 1) die Kohle in
demselben Gefäße, in welchem sie erhizt wurde, wieder abkühlen; dieses Verfahren ist
zwar in Bezug auf die Güte der wiedergewonnenen Kohle vortheilhaft, aber auch
langwierig und kostspielig; oder man nahm 2) die in verschlossenen Töpfen etc. auf
den gehörigen Grad erhizte Kohle in glühendem Zustande heraus und brachte sie in
luftdicht verschließbare Abkühlgefäße; dabei leidet aber die Güte der wiederbelebten
Kohle.
Vorliegende Erfindung bezwekt nun, daß beim Wiederbeleben der Knochenkohle die
Retorte, der Ofen, oder das Gefäß nicht abgekühlt zu werden braucht und dennoch die
Kohle beim Herausnehmen und Abkühlen weder in rothglühendem, noch überhaupt in einem
Zustand, welcher ihr schaden könnte, in Berührung mit der Atmosphäre kömmt; es
werben nämlich das Gefäß, in welchem sie geglüht, und dasjenige, in welchem sie
abgekühlt wird, so vorgerichtet, daß sie temporär oder beständig mit einander in
Verbindung gesezt werden können und die Luft vom Anfang des Ausglühens bis zur
gehörigen Abkühlung ausgeschlossen bleibt.
In Fig. 29,
30 und
31 ist
ein solcher Apparat abgebildet, in welchem das Ausglühen und Abkühlen in
unmittelbarer Aufeinanderfolge ohne Zutritt der Luft bis nach hinlänglicher
Abkühlung stattfindet, a ist eine verticale Retorte von
Eisen, welche von den Feuercanälen des Ofens b umgeben
ist; c ist ein Rumpf, in welchem sich beständig ein
Vorrath wieder zu belebender Knochenkohle befindet; aus diesem fällt, wenn der
untere Raum der Retorte a entleert wird, frische Kohle
nach, oder wird nachgeschoben. Hiebei kann zur erhizten Kohle keine Luft zutreten,
d ist das Abkühlgefäß, welches mit dem untern Ende
der Retorte a mittelst einer mit Sand abgesperrten Fuge
e in Verbindung steht. Diese Abkühlvorrichtung ist
von dünnem Eisenblech und ziemlich groß, um hinlängliche große Oberfläche
darzubieten; das untere Ende ist durch einen Boden und einen Schieber verschlossen,
in denen sich Reihen von Oeffnungen befinden, welche, wenn Kohle herausgenommen
werden soll, übereinander treffend gemacht werben.
Nach dem Herabfallen vom Gefäße a wird die Kohle im
Gefäße d allmählich abgekühlt und kann, bis sie in f ankömmt, ohne Anstand herausgenommen werden.
Es ist gerade nicht nöthig, daß die Abkühlvorrichtung unten verschlossen sey, da die
niedergegangene und herausgefallene Kohle in einem Haufen liegen bleiben und so die
Vorrichtung verschließen kann. Es muß Acht gegeben werden, daß die Kohle nicht zu
früh wieder der Luft ausgesezt werde, g ist eine
Vorrichtung zum Messen der aus dem Kühler d kommenden
Kohle; sie ist ebenfalls mit einem Schieber und gelöcherten Boden versehen wie der
oben bei d beschriebene.
Tafeln