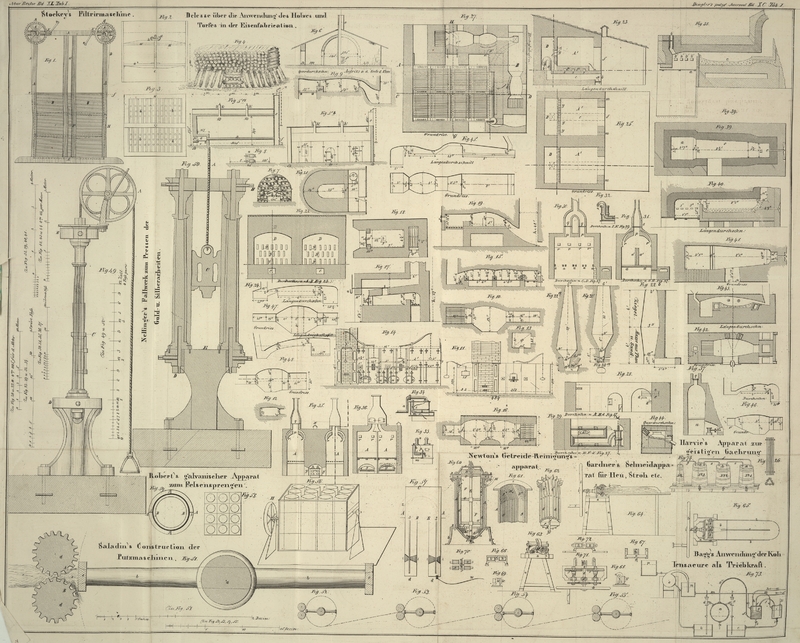| Titel: | Beschreibung eines neu construirten Fallwerkes zum Pressen der Gold- und Silberarbeiten; von Alexander Nellinger in Pforzheim. |
| Autor: | Alexander Nellinger |
| Fundstelle: | Band 90, Jahrgang 1843, Nr. IV., S. 8 |
| Download: | XML |
IV.
Beschreibung eines neu construirten Fallwerkes
zum Pressen der Gold- und Silberarbeiten; von Alexander Nellinger in
Pforzheim.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Nellinger's Fallwerk zum Pressen der Gold- und
Silberarbeiten.
Dieses Fallwerk wird besonders zum Pressen der Gold- und Silberarbeiten
benüzt. Das Ganze besteht meistens aus Gußeisen, und es sind nur die verschiedenen
Stellschrauben, so wie der unten in den Hammer C
eingepaßte Kopf von Stahl.
Diese Maschine ruht auf einem steinernen Fundamente von circa 4 Fuß Tiefe und 3½ Fuß Durchmesser; auf diesem Fundamente
liegt ein Holzblok F, welcher dem gußeisernen Fuße D, Fig. 49 und 50, als
Unterlage dient und mittelst vier starken Schrauben auf ersteren aufgeschraubt ist.
Um größere Festigkeit zu erreichen, sind an den Fuß vier aufrecht gehende Nerven
angegossen. Oben auf dem Fuße D ist der aufgegossene
Amboß E sichtbar, auf welchen ein gehärtetes Gesenke
mittelst vier starker Stellschrauben fest eingespannt werden kann. Zu beiden Seiten
des Ambosses E sind Löcher zur Aufnahme der beiden
Säulen gebohrt und es werden leztere mit starken Muttern von Unten auf den Fuß
aufgeschraubt. Beide Säulen sind oben durch ein Querstük B mit einander verbunden, welches ebenfalls durch zwei starke Muttern auf
beide Säulen befestigt ist. Auf diesem Querstük B, Fig. 49, ruht
eine schmiedeiserne Gabel, in welcher sich die Seilrolle dreht. An beide Säulen ist
ein dreiekig gehobeltes Lineal angegossen, zwischen welchen Linealen sich der Hammer
C passend auf und nieder bewegt. Sollte durch
längeren Gebrauch der Hammer C nicht mehr ganz passend
gehen, so können durch die zu beiden Seiten vorstehenden Stellschrauben die Säulen
dem Hammer genähert werden.
Den Hammer C läßt man auf dem winkelförmigen Träger h so lange ruhen, als man mit dem Einspannen eines
nöthigen Gesenkes zu thun hat. Das den Hammer C tragende
Seil hat an seinem untern Ende einen Steigbügel, so daß man beim Aufziehen des
Hammers mit Fuß und Händen zugleich arbeiten kann. Der in den Hammer C eingepaßte Stahlkopf ist an seiner untern Fläche mit
vielen kleinen Löchern versehen, welche alle schief eingebohrt sind, und in denen
sich das zum Pressen nöthige Blei oder Kupfer fest anhängt.
Fig. 50 zeigt
den obern Theil des Fußes D; aus dieser Figur ersieht
man sowohl die ovale Form, als auch die zur Aufnahme der Säulenzapfen nöthigen
Oeffnungen, nebst den vier starken Stellschrauben, zwischen welchen das gehärtete
Gesenke eingespannt ist; ferner wie sich der Hammer C
zwischen beiden Säulen in dreiekigen Prismen bewegt; auch sieht man darin die oben
erwähnten kleinen Oeffnungen, welche zur Aufnahme (zum Festhalten) der nöthigen
Blei- und Kupferpfaffen dienen.
Diese neue Art von Fallwerken zeigt sich in mehrfacher Beziehung sehr vortheilhaft,
indem sie von sehr großer Dauer sind, ganz wenig Raum erfordern, gar leicht in
wenigen Stunden auf eine andere Stelle versezt werden können und man damit überdieß
viel schneller als mit einer Presse arbeiten kann, weil das zu prägende Metall nach
jedem Schlage von selbst aus dem Gesenke hüpft, während es bei Anwendung der Presse
erst aus dem Gesenke heraus gelüpft werden muß. Um das Zerreißen des zu prägenden
Metalles zu verhüten, schlägt man zuerst einen sogenannten Bleipfaff in den am
Hammer C befindlichen Stahlkopf ein; da aber mittelst
Blei allein sich die Bleche nicht scharf ausschlagen, so befestigt man auf ähnliche
Weise einen Kupferpfaff, mittelst dessen dann fertig geprägt werden kann.
Das Gewicht der ganzen Maschine beträgt 17 Cntr.; der Hammer C ist 65 Pfd. schwer. Die vollständige Maschine kostet 375 fl.
Tafeln