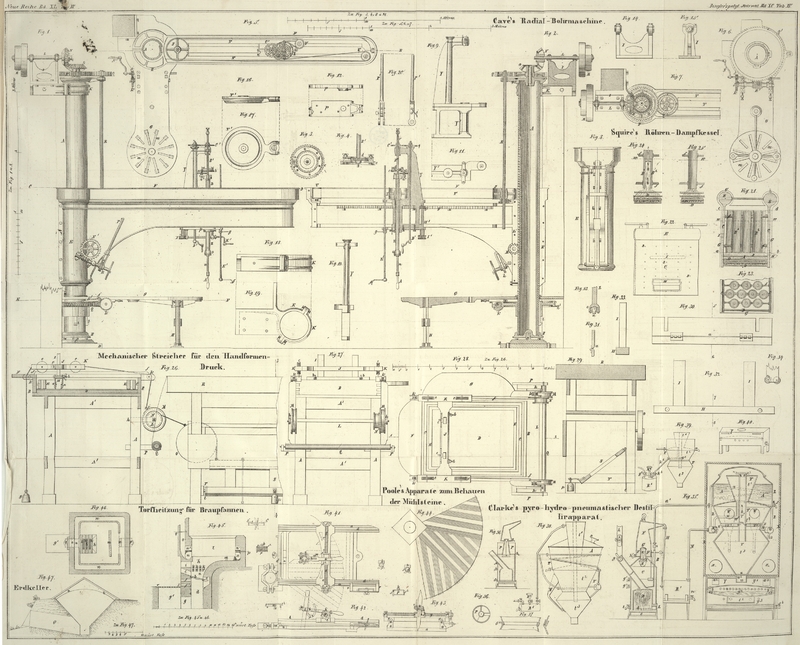| Titel: | Squire's patentirter Röhrendampfkessel. |
| Fundstelle: | Band 90, Jahrgang 1843, Nr. LVI., S. 241 |
| Download: | XML |
LVI.
Squire's patentirter Roͤhrendampfkessel.
Aus dem Mechanics' Magazine Jul. 1843. S.
2.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Squire's patentirter Roͤhrendampfkessel.
Fig. 21 ist
die Seitenansicht eines Dampfkessels nach Squire's
Verbesserungen; um die innere Construction sichtbar zu machen, ist der äußere Mantel
in der Abbildung weggelassen. Fig. 22 ist die hintere
Ansicht und Fig.
23 der Grundriß des Dampfkessels, nach der Linie c
d, Fig.
21. A ist der Ofen; B1, B2 eine Reihe doppelter Röhren, die sich in
senkrechter Lage vom Ofen aus erheben, und deren Construction und Verbindungsweise
aus dem Grundriß Fig. 23 und dem Durchschnitt und Aufriß Fig. 24 und 25 einer
einzelnen Röhre ersichtlich ist. Die äußeren Röhren B′ sind cylindrisch, oben und unten geschlossen, und bis zur Höhe der
allgemeinen Wasserlinie w w mit Wasser gefüllt. Die
inneren Röhren B2
dagegen sind oben und unten offen, damit die Flamme und die heißen Dämpfe frei durch
dieselben streichen können. Zur Verstärkung des Zuges sind sie bis in die Nähe der
Wasserlinie w w konisch und verengen sich dann in einen
engen cylindrischen Canal e. Sämmtliche Räume zwischen
diesen Röhren stehen oben und unten vermittelst kurzer Querröhren f, f, welche zugleich zur
Verbindung der Röhren dienen, mit einander in Communication. C, C sind zwei verticale Seitenkammern, deren Platten durch Bolzen S, S mit einander verbunden, und die bis zur nämlichen
Höhe wie die Röhren B2
mit Wasser gefüllt sind. D, D, D, D sind horizontale
Wasserröhren, welche die Kammern C, C an beiden Enden
verbinden; die unteren dieser Röhren vertreten zugleich die Stelle der Roststäbe.
E, E sind zwei cylindrische durch eine Querröhre F mit einander verbundene Dampfrecipienten, in die der
Dampf von den Kammern C, C aufsteigt, um von da nach den
Cylindern der Dampfmaschine fortgeleitet zu werden. G,
G′ ist ein Mantel von dünnem Eisenblech,
welcher den Dampfkessel umgibt, um die Entweichung der Wärme zu verhüten und die
Seitenkammern so wie die Dampfrecipienten gegen den kühlenden Einfluß der Atmosphäre
zu schüzen. Oben ist dieser Mantel durchlöchert, um den von dem Ofen durch die
Röhren B′ aufsteigenden heißen Dämpfen den Ausweg
zu gestatten. H (Fig. 21 und 22) ist eine
an der Rükseite des Kessels angebrachte Thür, durch die der Ofen mit Brennmaterial
gespeist wird. I (durch Punktirungen in Fig. 22 angegeben) ist
eine an der Vorderseite des Dampfkessels befindliche Oeffnung, durch die der
verbrauchte oder überflüssige Dampf mittelst Röhren von den Dampfcylindern in den
Kessel zurükgeleitet wird, um daselbst absorbirt zu werden. Die Verbindung zwischen
den inneren und äußeren Röhren B1, B2 wird auf folgende Weise bewerkstelligt. Das
obere Ende der äußeren Röhre besizt einen mit einer Flantsche versehenen Dekel,
welcher eingetrieben und festgenietet wird. In die Mitte dieses Dekels ist zur
Aufnahme des oberen Theils der innern Röhre ein Schraubenloch eingeschnitten; durch
dieses Loch wird die innere Röhre hindurchgeschraubt und dann mittelst einer
Schraubenmutter und eines Halses befestigt. Unten ist die äußere Röhre mit der
inneren durch einen soliden Ring verbunden, an den beide Röhren festgenietet
sind.
Tafeln