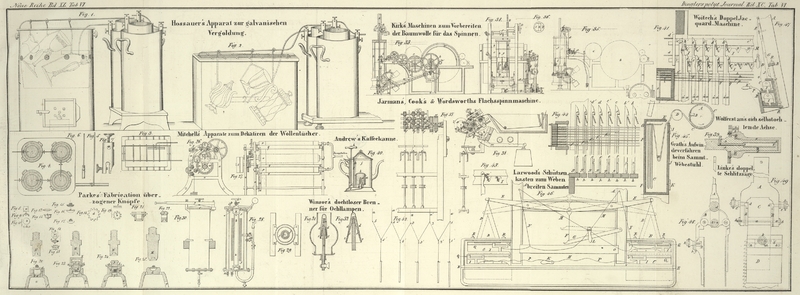| Titel: | Frederick Albert Winsor's dochtloser Brenner für Oehllampen. |
| Fundstelle: | Band 90, Jahrgang 1843, Nr. XCVII., S. 436 |
| Download: | XML |
XCVII.
Frederick Albert Winsor's dochtloser Brenner
fuͤr Oehllampen.
Aus dem London Journal of arts. Okt. 1843, S.
168.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Winsor's dochtloser Brenner für Oehllampen.
Dieser Brenner besteht im Wesentlichen aus einer mit dem Oehlbehälter communicirenden
Centralröhre a, Fig. 31, welche an ihrem
oberen Ende a′ offen und daselbst abgerundet ist. Unter dieser Mündung
befindet sich eine kleine Schulter oder Hervorragung b.
Unter dieser Schulter ist die Röhre von einer dünnen metallenen Büchse c umgeben, welche eine geneigte Ebene darstellt, über
die das aus der Mündung der Centralröhre hervorquellende brennbare Material
herabfließt. Ein dünner metallener Mantel d umgibt
sowohl die innere Büchse, als auch den oberen Theil der Centralröhre. Dieser äußere
Mantel ist länger als die innere Büchse und erhebt sich etwas über die Mündung der
Centralröhre, um für ein nachher zu beschreibendes Filtrum oder eine Reihe
Metallringe Raum zu lassen; er ist mit dem unteren Ende der inneren Büchse luftdicht
verbunden. Rings um dieses untere Ende über der Vereinigungsstelle mit dem äußeren
Mantel ist eine Anzahl kleiner Löcher e, ähnlich
denjenigen der gewöhnlichen Gasbrenner, gebohrt, aus denen das an dieser Stelle
anzuzündende Oehl oder sonstige brennbare Material heraustritt. Diesen Theil des
äußeren Mantels kann man nach Gutdünken erweitern und die Löcher unter einem Winkel
von 15 bis 20° gegen den Horizont bohren. Der über der Schulter b befindliche Theil der Röhre ist zur Aufnahme eines
ungefähr ¾ Zoll breiten und 2 bis 4 Zoll langen Streifens Leinwand oder
ähnlichen Fabricates bestimmt. Dieser rings um die Centralröhre zu wikelnde Streifen
dient dem aus der Mündung der Centralröhre hervorquellenden Oehl als Filtrum, bevor
dasselbe in den engen Raum zwischen der inneren Büchse und dem Mantel herabfließt.
Obgleich die Leinwand durch die Hize, der sie ausgesezt ist, verkohlt, so entspricht
sie doch ihrem Zwek, indem sie ein unstetes Flakern der Flamme, welches sonst
stattfinden würde, verhütet; übrigens muß sie von Zeit zu Zeit erneuert werden.
Denselben Zwek erreicht man durch drei oder vier Metallringe, welche man anstatt der
Leinwand in kurzen Abständen übereinander um die Centralröhre legt, wie Fig. 32
zeigt.
Um die Höhe des Brenners und des Zugglases zu reguliren, kann man Schrauben anwenden,
oder eine Röhre, die in einer Stopfbüchse verschiebbar ist. Das Niveau des Oehls in
dem Behälter fällt
gerade unter die in den Brenner gebohrte Löcherreihe. Die dünnen Metallbüchsen
müssen aus einem Metalle angefertigt werden, welches sich ohne Nachtheil bis zur
Rothglühhize erwärmen läßt und nicht leicht einer Corrosion in Folge chemischer
Einwirkung unterliegt. Silber, Silberlegirungen und Platin besizen diese Eigenschaft
und verdienen daher den Vorzug.
Die Lampe wird dadurch angezündet und in Thätigkeit gesezt, daß man zuerst die
Metallbüchsen mit Hülfe von etwas Weingeist rothglühend macht; der Weingeist ist in
einer Art Löffel enthalten, der so eingerichtet ist, daß er die Centralröhre rings
umgibt. Sobald der Brenner die geeignete Temperatur erreicht hat, läßt man das Oehl
allmählich zufließen. Das Oehl quillt aus der Mündung der Centralröhre hervor,
fließt durch das Filtrum oder die erwähnten Ringe hinab in den engen Raum zwischen
der innern Büchse und dem Mantel und kommt an den rings um den Mantel angeordneten
Oeffnungen zum Vorschein. Da das Oehl auf seinem Wege einer sehr starken Hize
ausgesezt war, so hat es sich in Gas zersezt, ehe es die Brennmündung erreicht.
Einmal angezündet unterhält die Flamme von selbst die zum fortdauernden
Brennungsproceß erforderliche Temperatur.
Tafeln