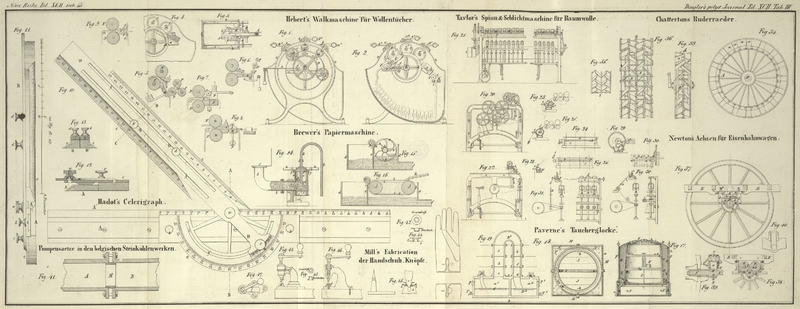| Titel: | Verbesserte Walkmaschine für Wollentücher, worauf sich Luke Hebert, zu Birmingham, zufolge einer Mittheilung am 20. Sept. 1841 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 92, Jahrgang 1844, Nr. XLIX., S. 173 |
| Download: | XML |
XLIX.
Verbesserte Walkmaschine fuͤr
Wollentuͤcher, worauf sich Luke Hebert, zu Birmingham, zufolge einer Mittheilung am 20. Sept. 1841 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts, Maͤrz 1844, S.
77.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Hebert's Maschine für Wollentücher.
Den Gegenstand vorliegender Verbesserungen an Walkmaschinen bilden:
1) gewisse Modificationen in der Form und Anordnung der Cylinder, welche das Tuch in
der Richtung seiner Breite zu walken gestatten, um die Mängel zu beseitigen, die
sich ergeben, wenn man sich über einander liegender Cylinderpaare bedient;
2) gewisse Anordnungen um den Parallelismus der Achsen der Preßwalzen zu sichern;
3) die Form und Construction des Troges, worin das Tuch in der Richtung seiner Länge
gewalkt wird;
4) Anordnungen, um das Walken durch Druk mit dem Walken durch Stoß zu verbinden;
5) die Substitution anderer Materialien an die Stelle des Holzes oder Metalles bei
der Construction gewisser Maschinentheile.
Die Abbildungen Fig.
1–4 erläutern die verbesserte Maschine zum Walken des Tuchs mittelst Druks.
Fig. 1
stellt eine Seitenansicht und Fig. 2 einen
Längendurchschnitt dieser Maschine dar. Fig. 3 ist ein schiefer,
und Fig. 4 ein
senkrechter Durchschnitt eines Theils von Fig. 2. A ist der große hölzerne oder kupferne Cylinder, dessen
Welle B in dem Maschinengestelle gelagert ist. An dieser
Welle ist ein Stirnrad D befestigt, welches durch ein an
der Treibwelle der Maschine sizendes Getrieb E in
Umdrehung gesezt wird. An die Seiten des Cylinders A
sind kupferne Flantschen befestigt, welche mit der Peripherie des Cylinders eine
tiefe Rinne oder einen Canal bilden. Diese Rinne nimmt das Tuch auf und leitet es
der Reihe nach unter drei schmale Cylinder C, C, C',
welche das Tuch mittelst Druks von der Seite her walken. Die Achsen dieser Cylinder
drehen sich zu beiden Seiten der Maschine in Lagern a',
und diese sind an Zahnstangen a angebracht, deren
unteres Ende in Führungen gleitet, die an der äußeren Seite des Troges befestigt
sind. b, b sind gezahnte Quadranten, die mit den
Zahnstangen a, a im Eingriff stehen und b' belastete, an die Achsen der Quadranten befestigte
Hebel, um den Druk der kleineren Cylinder gegen den großen zu reguliren.
Die oberen Enden der Zahnstangen a, a erhalten durch
kleine Frictionsrollen die nöthige Führung. An der Welle des Cylinders C' befindet sich ein kleines Rad c, welches durch das Rad D in Umdrehung gesezt
wird und dadurch dem Cylinder C' während seiner
Einwirkung auf das Tuch, die wegen der longitudinalen Walkprocedur an dieser Stelle
einen größeren Widerstand erfährt, eine sichere Bewegung ertheilt. d ist ein Abstreifer, der so geformt ist, daß das Tuch
nicht zwischen ihn und den Cylinder gelangen kann; sein oberes Ende streift das Tuch
von der Oberfläche des großen Cylinders ab, und legt dasselbe in den Trog, worin es
der Länge nach gewalkt wird. e ist ein anderer
Abstreifer, der in Beziehung auf den Cylinder C'
denselben Zwek hat, wie der Abstreifer d in Beziehung
auf den Cylinder A. Dieser Abstreifer ist mittelst eines
Querstüks an die Arme e* befestigt, deren Lager sich auf
der Achse des Cylinders C' drehen, und auf diese Weise
den Abstreifer mit dem Cylinder verbinden, so daß der Abstreifer mit dem Cylinder
stets in Berührung bleibt, welche Bewegung auch der leztere annehmen möge. Die
Gestalt und Wirksamkeit dieser Abstreifer wird am deutlichsten aus Fig. 4 erhellen, welche
zugleich eine Modification des expansiblen Trogs oder Canals erläutert. F, Fig. 2, ist eine der
beiden mit Rinnen versehenen Platten oder Bretter, welche die Seiten des expansiblen
Trogs bilden. Diese Platten sind an die Theile f
befestigt, die sich um Zapfen an den Armen g der
Winkelhebel G drehen; und das innere Ende f* der Seitenplatten wird durch eiserne Stangen x, Fig. 3, welche an die
Seite der Maschine festgeschraubt sind, festgehalten. An die Winkelhebel G sind ferner die Stangen h
befestigt, von denen aus Schnüre, die ein Gewicht tragen, über eine Rolle geleitet
sind. Dieses Gewicht strebt vermittelst der Winkelhebel die Seiten des expansiblen
Trogs zu schließen und dadurch das Tuch mit einer gewissen Kraft zu comprimiren. K ist ein Brett, mit einem Schliz l, durch welchen das aus der Cisterne oder dem unteren Theil der Maschine
kommende Tuch gezogen und eingesammelt wird. Von da nimmt das Tuch seinen Weg durch
die rectanguläre Röhre L, die es der Rinne des großen
Cylinders A zuführt. Die längliche Oeffnung der Röhre
L ist so angeordnet, daß ihre Breite die Breite des
Schlizes l in dem Brette K
durchkreuzt. Das Tuch i wird auf seinem Wege von K nach L in verschiedenen
Richtungen gepreßt, wodurch sich die Lage seiner Falten bei jeder Umdrehung ändert.
V ist eine Walze zur Unterstüzung des Tuchs.
Die Figuren 3
und 4 stellen
eine andere Construction der Seiten des expansiblen Trogs anstatt der gefurchten
Platten F dar. Die Seiten bestehen nämlich im vorliegenden Fall aus zwei
gußeisernen Platten H, H, in deren jede eine Reihe
kleiner senkrechter cannelirter Cylinder J eingesezt
sind. Diese Cylinder sind so angeordnet, daß jedesmal ein Cylinder der einen Reihe
in den Raum zwischen zwei Cylindern der gegenüberstehenden Reihe paßt.
Die Figuren 5,
6, 7 und 8 stellen
verschiedene Modificationen an Apparaten zum Walken der Tücher durch Stoß dar. In
allen diesen Figuren wird das Tuch durch die Walzen N, N
in einen Trog O geleitet; von diesem gelangt dasselbe
nach einem Tisch R, wo es der Wirkung der Schläger P ausgesezt wird. Die Cylinder N,
N können als Ersaz des großen Cylinders A und
der kleineren Cylinder C der oben beschriebenen Maschine
angesehen werden. Der Boden des Trogs O ist fest, der
obere Theil desselben aber beweglich. Dieser Theil wird entweder, wie in den Figuren 5, 7 und 8 durch ein
angehängtes Gewicht oder wie in Fig. 6 durch eine Feder
niedergehalten. Die Schläger P können verschieden
gestaltet und auf verschiedene Weise in Bewegung gesezt werden; so sind die Schläger
in den Figuren
5 und 6 cylindrisch und jeder derselben dreht sich außer der Bewegung um den
gemeinschaftlichen Mittelpunkt p noch um seine eigene
Achse. In Fig.
7 wird ein Hammer P durch einen Welldaumen p und in Fig. 8 der Hammer P durch ein Excentricum oder eine Kurbel p in Thätigkeit gesezt. Die Gewalt des Schlags kann
dadurch regulirt werden, daß man den Tisch R um ein
Scharnier beweglich macht und demselben, wie aus den Figuren 5, 6 und 8 erhellt, durch ein
Gewicht einen Druk nach oben gibt. Der Tisch kann aber auch wie Fig. 7 zeigt, fest seyn,
und die Gewalt des Schlages durch Gewichte, die an dem Schläger selbst angebracht
sind, regulirt werden.
Fig. 9
erläutert eine andere Anordnung, um das Tuch in der Richtung seiner Breite zu
walken. Die Theile s, s des Bodens und Dekels des Troges
sind hier um Scharniere beweglich und mit den Stangen t,
t verbunden, deren Bewegung die Theile s, s
abwechselnd heftig einander nähert und von einander entfernt. Dadurch wird ein Theil
des Filzens der Breite nach bewerkstelligt, während das Filzen nach der Länge wie
bei den schon beschriebenen Vorrichtungen geschieht. Um auf der einen Seite die
durch Rost oder Oxydation veranlaßten Uebelstände, wenn einige Maschinentheile aus
Metall bestehen sollten, auf der andern Seite die Nachtheile in Folge der
abwechselnden Ausdehnung und Zusammenziehung des Holzes zu vermeiden, construirt der
Patentträger einzelne Maschinentheile, insbesondere die Tröge und Cylinder aus Stein
oder andern politurfähigen Materialien, z.B. Granit, Marmel, Glas, Porzellan oder
Steingut.
Die Maschine arbeitet auf folgende Weise. Das zwischen den Cylindern hervorkommende
Tuch wird zuerst durch die festen Canäle, dann durch den expansiblen Trog geleitet,
worauf die beiden Enden desselben zusammengenäht werden. Sezt man nun die Maschine
in Gang, so wird das in der Cisterne oder auf dem Boden des Apparats liegende Tuch
durch den ersten festen Canal gesammelt. Von da gleitet das Tuch über die
Leitungswalze und tritt in den zweiten festen Canal, dessen Oeffnung, wie oben
bemerkt, eine verschiedene Lage zu der des ersteren hat – eine Anordnung, in
deren Folge das Tuch sich nicht nur leichter zwischen die Walzen legt, sondern auch,
so oft derselbe Theil des Tuchs bei seinen successiven Umdrehungen durch diese
Canäle tritt, die Lage seiner Falten ändert. Aus dem zweiten festen Canal gelangt
das Tuch in die Rinne des großen Cylinders, wo es zwischen diesem und den kleineren
Cylindern in der Richtung seiner Breite je nach dem auf den kleineren Cylindern
lastenden Druk mehr oder weniger gewalkt wird. Der dritte oder lezte von den kleinen
Cylindern häuft das Tuch in dem expansiblen Trog an, bis es die beiden Seiten
desselben sanft zurükdrängt und so in gewissen Intervallen heraustritt. Bei seinem
Durchgang durch diesen Trog wird das Tuch der Länge nach gewalkt. Im vorliegenden
Fall bestehen die Seiten des expansiblen Trogs aus kleinen Cylindern, von der in den
Figuren 3
und 4
dargestellten Anordnung, wodurch der Walkproceß rasch und vollständig vor sich
geht.
Beim Walken durch Stoß in Vereinigung mit Druk bearbeiten die Schläger, in Gegensaz
mit der Wirkung der gewöhnlichen Schläger, das Tuch in successiven Abtheilungen;
ihre Gewalt läßt sich entweder durch aufgelegte Gewichte oder durch den Grad des den
Tischen ertheilten Widerstands reguliren.
Tafeln