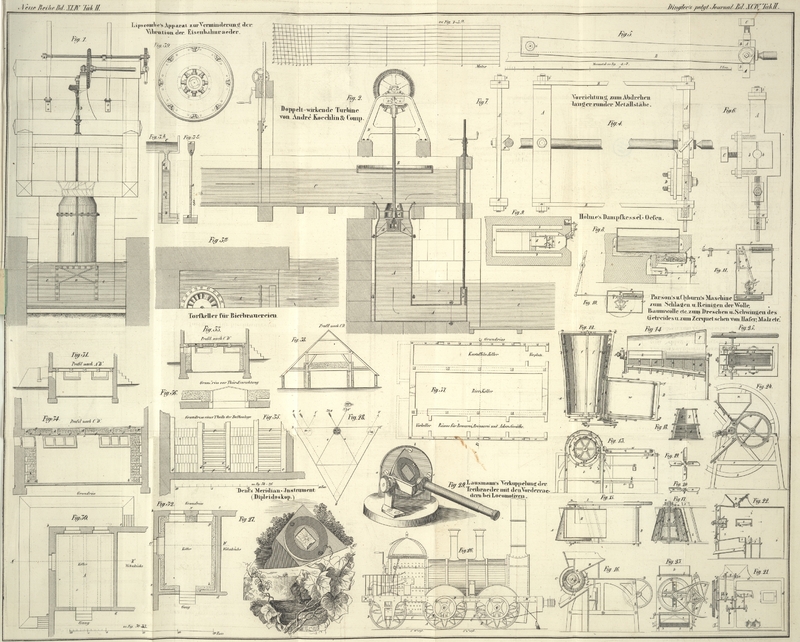| Titel: | Verbesserungen an den Oefen für Dampfkessel, worauf sich George Holmes, Ingenieur zu Stroudwater, Grafschaft Gloucester, am 9. Nov. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. XIX., S. 115 |
| Download: | XML |
XIX.
Verbesserungen an den Oefen für Dampfkessel,
worauf sich George
Holmes, Ingenieur zu Stroudwater, Grafschaft Gloucester, am 9. Nov. 1845 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts, Aug. 1844, S.
10.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Holmes' Verbesserungen an den Oefen für Dampfkessel.
Vorliegende Erfindung besteht in einem neuen Verfahren die Luft zur Beförderung der
Rauchverzehrung den Feuercanälen der Oefen oder Feuerstellen zuzuführen; ferner in
den Mitteln, den Luftzutritt nach Maaßgabe der Quantität des aus dem Brennmaterial
entwikelten Rauchs zu reguliren. Die zur Erreichung dieses Zweks von dem
Patentträger angewendeten Mittel bestehen darin, daß in dem Aschenfalle unter dem
Roste eine Luftkammer angeordnet wird, die mit Thüren oder Klappen versehen ist,
welche sich beliebig öffnen lassen. Diese Thüren oder Klappen stehen auf irgend eine
geeignete Weise mit der Feuerthür in Verbindung, so daß, wenn die leztere, in der
Absicht, eine neue Ladung Brennmaterial in das Feuer zu füllen, geöffnet wird, auch
die Klappen des Luftcanals sich öffnen und somit eine große Quantität Luft in den
Feuercanal des Ofens dringen lassen. Mit den Klappen steht ferner ein Apparat in
Verbindung, welcher verhütet, daß sie sich unmittelbar nach Verschluß der Feuerthür
schließen. Mit Hülfe dieses Apparats wird gerade zu der Zeit, wo frisches
Brennmaterial aufgegeben wird, und eine Menge Rauch aus demselben sich entwikelt,
einer großen Menge Luft der Zutritt in das Feuer gestattet; in dem Maaße aber, als
der Rauch sich vermindert, vermindert sich auch durch allmähliches Schließen der
erwähnten Klappen der Luftzutritt, bis die Klappen ganz geschlossen sind.
Fig. 8 stellt
einen Dampfkessel-Ofen mit den an demselben in Anwendung gebrachten
Verbesserungen im senkrechten Längendurchschnitt und Fig. 9 im horizontalen
Durchschnitt nach der Linie 1, 2, Fig. 8 dar. a ist der Ofen; b, b der
Feuercanal; c der Aschenfall, d die Luftkammer, welche die Feuercanäle vermittelst einer in der Brüke angebrachten
Oeffnung e mit Luft versieht. An der Vorderseite der
Luftkammer sind die Thüren oder Klappen f, f angebracht,
welche durch die mit dem Schiebrahmen h, h beweglich
verbundenen Stangen g, g geöffnet oder geschlossen
werden. Dieser Rahmen enthält eine lange Stange i, deren
äußeres Ende mit einem zweiarmigen an dem unteren Ende der verticalen Welle k befindlichen Hebel j
verbunden ist. Das andere Ende des Hebels j articulirt
mit einer Stange n, die sich gegen eine starke in einer
eingemauerten Büchse angeordnete wurmförmige Feder lehnt. Das obere Ende der
verticalen Welle k enthält einen Arm l und das äußere Ende des leztern ist mit einem
bogenförmigen Schliz (Fig. 9) versehen, in
welchem ein an dem Ende der Verbindungsstange m
befindlicher Stift spielt und dadurch den Arm l mit der
Feuerthür verbindet.
Beim Oeffnen der Feuerthür wird der Arm l zurükgedrängt.
Diese Bewegung ertheilt der senkrechten Achse k eine
Drehung, zieht die lange Stange i vorwärts, öffnet
dadurch die Klappen f, f der Luftkammer und gestattet
der Luft den Zutritt in den Feuercanal. Wenn die Thür wieder geschlossen wird, so
gleitet der Stift, welcher die Stange m mit dem Hebel
l verbindet, längs des erwähnten Schlizes, und
erlaubt mit Hülfe eines nachher zu beschreibenden Apparats, diesen Theilen
allmählich in ihre ursprüngliche Lage sich zurük zu bewegen und dadurch die Klappen
der Luftkammer langsam zu schließen.
Die Figuren 10
und 11
stellen den Apparat, welcher die Klappen der Luftkammer allmählich schließt, nachdem
die Feuerthür geöffnet und Brennmaterial aufgegeben worden ist, abgesondert und in
größerem Maaßstabe dar. Fig. 10 liefert einen
Grundriß des Apparats mit dem Durchschnitt des Gehäuses; Fig. 11 ist eine
Seitenansicht des Apparats mit Hinweglassung der Seitenwand des Gehäuses. Die
wirksamen Theile des Apparats sind in ein eingemauertes Gehäuse p, p eingeschlossen. k, k
ist die oben erwähnte senkrechte Welle, an deren unterem Ende der zweiarmige Hebel
j, j angebracht ist, dessen eines Ende mit der
langen Stange i, Fig. 9, und dessen anderes
Ende mit der gegen die Feder o drükenden Stange n in Verbindung steht. Die respectiven Theile in allen
Figuren sind in derjenigen Lage dargestellt, welche sie einnehmen, wenn die
Feuerthür und die Klappen der Luftkammer geschlossen sind; sind dagegen Feuerthür
und Luftkammerklappen offen, so befinden sich sämmtliche Theile in der Fig. 9 und 11 durch
Punktirungen bezeichneten Lage. Mit dem Arm n, Fig. 11, ist
ein Hebel q verbunden, der um eine Achse 2 sich
vor- und rükwärts bewegen laßt; die Achse 2 befindet sich an dem Ende eines Winkelhebels v. Das untere Ende des Hebels q enthält einen gezahnten Quadranten, welcher gelegentlich mit dem kleinen
Getriebe r in Eingriff gesezt wird. An einer Welle mit
dem Getriebe r befindet sich ein Hemmungsrad s, dessen Rotation durch die an der verticalen Welle t* befestigten Hemmungslappen t,
t regulirt wird. Wenn die Feuerthür geschlossen ist, so befindet sich der
gezahnte Quadrant des Hebels q mit dem Getriebe außer
Eingriff; wird aber die Thür geöffnet, so drängt sie die Stange n zurük und eine an der unteren Seite des Arms n hervorstehende Nase u
kommt mit dem oberen Ende des um 1 drehbaren Hebels v in
Berührung, dessen anderes Ende den oscillirenden Hebel q
trägt; dadurch wird das Ende 2 und mit diesem der Hebel q, der inzwischen die punktirte Lage eingenommen hat, niedergedrükt, so
daß der Quadrant mit dem Getriebe r in Eingriff kommt.
Nun beginnt die durch das Vorräten der Stange n
zusammengepreßte Feder o vermöge ihrer Elasticität die
Stange und mit ihr den Hebel q wieder zurükzutreiben,
und sezt daher vermittelst des gezahnten Quadranten das Getriebe r und das Hemmungsrad s in
Rotation. Unmittelbar unter dem unteren Hemmungslappen und an einer Spindel mit ihm
ist ein kleines Zahnrad y befestigt, welches in ein an
der Achse des Schwungrads A sizendes Getrieb z greift. Aus dieser Beschreibung wird erhellen, daß die
Hemmung die Geschwindigkeit des Räderwerks regulirt und die allzurasche Ausdehnung
der Feder verhütet. Durch diese Mittel wird der allmähliche Verschluß der Klappen
der erwähnten Luftkammer bewerkstelligt. Die Stelle der Feder o kann auch ein Gewicht vertreten, welches durch das Oeffnen der Klappen
gehoben wird und dann wieder langsam herabsinkt, um die Klappen allmählich wieder zu
schließen.
Tafeln