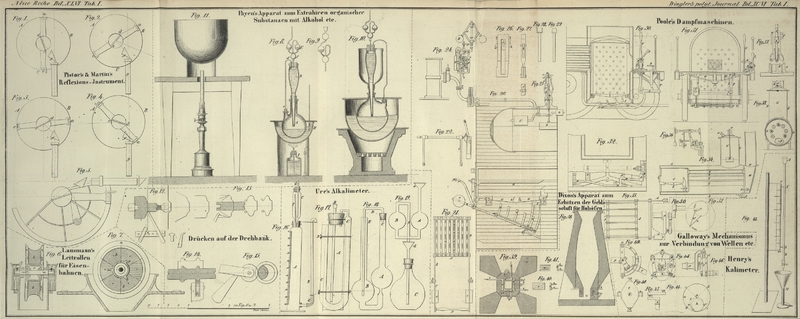| Titel: | Mechanismus zur Verbindung von Achsen oder Wellen, um sie mit verschiedenen relativen Geschwindigkeiten rotiren zu lassen, worauf sich Elijah Galloway, Civilingenieur in Blackfriars-road, Grafschaft Surrey, am 12. Junius 1844 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 96, Jahrgang 1845, Nr. III., S. 9 |
| Download: | XML |
III.
Mechanismus zur Verbindung von Achsen oder
Wellen, um sie mit verschiedenen relativen Geschwindigkeiten rotiren zu lassen, worauf
sich Elijah Galloway,
Civilingenieur in Blackfriars-road, Grafschaft Surrey, am
12. Junius 1844 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jan.
1845, S. 29.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Galloway's Mechanismus zur Verbindung von Achsen oder
Wellen.
Meine Erfindung betrifft einen Mechanismus, der so eingerichtet ist, daß die
Geschwindigkeit einer Achse doppelt so groß wird, als die einer andern.
Wenn ein Rad im Innern eines andern Rades von doppelt so großem Durchmesser rollt, so
daß der Mittelpunkt des größeren die Peripherie des kleineren Rades berührt, und das
leztere in einer gegebenen Zeit doppelt so viel Umdrehungen macht als der erstere,
so beschreibt bekanntlich jeder Punkt in der Peripherie des kleineren Rades quer
durch die Fläche des größeren eine gerade Linie. Auch werden sich die von den
gegenüberliegenden Punkten e, f, Fig. 44, beschriebenen
Linien im Mittelpunkte g rechtwinkelig durchschneiden.
Wären nun e und f Kurbelzapfen oder
die Lager einer gekröpften Achse, Fig. 47, und wäre mit dem
größeren Rade irgend ein geeigneter Mechanismus verbunden, vermöge dessen die
erwähnten Zapfen oder Lager in Beziehung auf das größere Rad nur eine geradlinige
Bewegung, z.B. c, c und d, d
machen könnten, so würde die Achse g eine Umdrehung
machen, während die Achse h zweimal rotirte.
Die Figuren 45
und 46
stellen nun die End- und Seitenansicht eines Mechanismus dar, womit der
erwähnte Erfolg erzielt wird.
Fig. 47 ist
ein Grundriß des Krummzapfens e, h, f. An die Hauptachse
g, Fig. 45, ist eine Kurbel
z befestigt, in deren Zapfen der dreiekige Hebel i eingehängt ist. An den Enden dieses Hebels befinden
sich Zapfen c und d, welche
an den entgegengesezten Seiten hervorragen, so daß sie beziehungsweise in den Ebenen
der Krummzapfenlager f und e
liegen. In diese Zapfen sind die Verbindungsstangen j
und k eingehängt. In der Mitte von j befindet sich ein Lager, worin ein Zapfen s spielt, welcher an das eine Ende einer
Verbindungsstange r befestigt ist. Mit ihrem andern Ende
ist die Stange r an einem von der Mitte der Hauptwelle
hervorstehenden Zapfen befestigt. Ist nun j doppelt so
lang wie r, so kann begreiflicher Weise der Punkt f nur die gerade Linie d, d
beschreiben. Nehmen wir nun zunächst an, j sey mit
seinem unteren Ende an den Kurbelzapfen f, deßgleichen
die Stange k an den Kurbelzapfen e befestigt und die Achsen g und h rotiren in geeigneten Lagern, so wird g eine Umdrehung machen, während h zweimal rotirt.
Sollen die rotirenden Wellen einen Winkel mit einander bilden, so kann man sich der
Fig. 48
und 49
dargestellten Anordnung bedienen. Diese Anordnung bildet eine andere Methode, eine
Bewegung zu vervielfachen und nähert sich dem mit Bezug auf Fig. 44 erläuterten
Princip. An eine Achse g ist der diamantförmige Körper
t, von welchem in radialer Richtung vier Zapfen u, u und v, v abstehen,
befestigt. Mit den Zapfen v, v ist der Bogen w, Fig. 49, verbunden, der
in seiner Mitte v' gleichfalls ein Lager besizt. Ein
zweiter kleinerer Bogen x ist auf ähnliche Weise mit den
Zapfen u, u verbunden und besizt in seiner Mitte
gleichfalls ein Lager u'. Bei dieser Anordnung sind die
Arme y, y, anstatt wie in Fig. 47 gerade zu seyn,
gebogen und mit den Bogen x und w von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte aus construirt. Aus dieser
Anordnung folgt, daß sich die Rotationsgeschwindigkeiten der erwähnten Achsen, auch
wenn sie einen Winkel mit einander bilden, wie 2 : 1 verhalten werden.
Ich werde nun eine Modification der obigen Anordnung zur Erzielung einer
Geschwindigkeitsveränderung beschreiben; diese Anordnung nähert sich dem mit Bezug
auf Fig. 44
beschriebenen Princip. Die Linien a¹, a² und a³, Fig. 51, bezeichnen die
Fig. 50
entsprechenden Krummzapfen nebst Verbindungsstange. Dreht man a¹ in die bezeichnete Lage, so rotirt der Krummzapfen a² um seine Achse und zwar mit der doppelten
Geschwindigkeit von a¹. Wenn aber beide
Krummzapfen wie in Fig. 50 in einer Linie liegen, so würde
offenbar a¹ nicht im Stande seyn a² bewegen, weßwegen der Achse a² nothwendig ein Schwungrad gegeben werden muß.
Hinsichtlich der Anwendung bei Dampfmaschinen ist zu bemerken, daß die Kolbenstange
in den Kurbelzapfen a⁴ eingehängt werden sollte,
so daß die Richtung der Kraft durch die Mittelpunkte geht. Es ist einleuchtend, daß
alle diese Anordnungen angewendet werden können, sowohl um die Bewegung von Wellen
zu reduciren als zu vervielfachen, und daß sie in allen solchen Fällen anwendbar
sind, bei welchen eine Achse in derselben Zeit doppelt so viel, oder auch
vermittelst Wiederholung der bezeichneten Anordnung 4, 8, 16 u.s.w. mal so viele
Umdrehungen machen soll als eine andere.
Tafeln