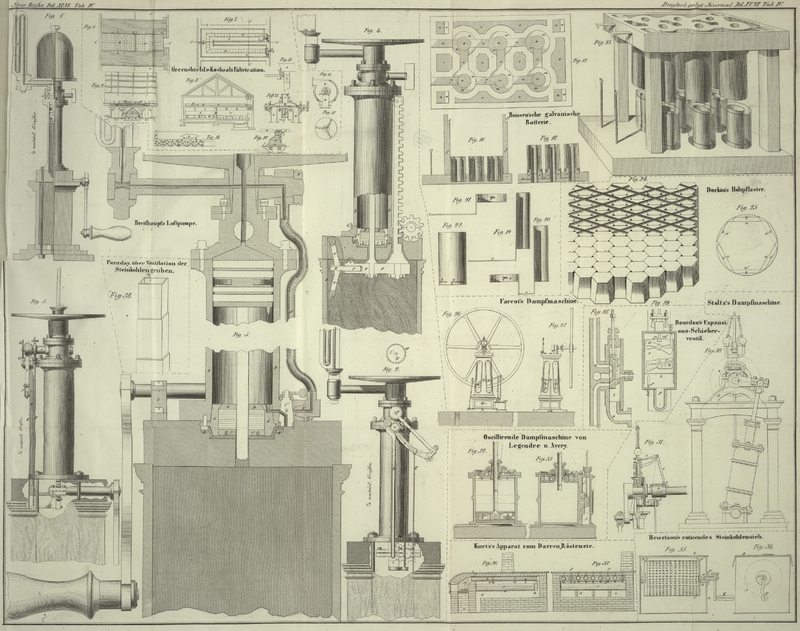| Titel: | Beschreibung einer vortheilhaften Anordnung der Bunsen'schen galvanischen Batterie; von Dr. Tasché. |
| Autor: | Tasché |
| Fundstelle: | Band 96, Jahrgang 1845, Nr. LXX., S. 273 |
| Download: | XML |
LXX.
Beschreibung einer vortheilhaften Anordnung der
Bunsen'schen
galvanischen Batterie; von Dr. Tasché.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Tasché's Anordnung der Bunsen'schen galvanischen
Batterie.
Die zur Erzeugung galvanischer Ströme so überaus wirksame Bunsen'sche Kette bietet in ihrer gewöhnlichen Construction bei Anwendung
vieler Elemente die Unbequemlichkeit dar, daß man nicht im Stande ist, die
Thätigkeit des Apparates mit einem Male aufzuheben und wieder herzustellen. Oefters
kommt man in den Fall, den Strom eine Zeit lang nicht benuzen zu können; alsdann muß
man entweder den Apparat unnöthigerweise der Wirkung der Säure aussezen, oder man
sieht sich genöthigt, denselben auseinander zu nehmen und dann von Neuem
zusammenzusezen. Folgende Anordnung soll dieser Unbequemlichkeit abhelfen. Nach dieser
Anordnung besteht nämlich der Apparat aus zwei gesonderten Theilen, dem Gestelle und
dem Nahmen. Das Gestell (Fig. 16 zeigt davon den
Längendurchschnitt) besteht aus einem 1 1/2 Zoll diken Brette und enthält zwei
Reihen cylindrischer, 1 Zoll tiefer Löcher, welche zur Aufnahme der die Säure
enthaltenden Gläser bestimmt sind. Auf dem Boden der Gläser ist ein schmaler
Glasring ausgekittet, worin die Thonzellen gesezt werden. – Der Rahmen, wovon
Fig. 17
den Grundriß darstellt, ein vierekiges Brett von 1 1/2 Zoll Dike, ist zur Aufnahme
der Zink- und Kohlenelemente bestimmt. Er enthält kreisförmige Vertiefungen
(Fig. 17,
m) von gleicher Anzahl und gleichem Abstande als die
des Gestells. Diese Vertiefungen, welche einen Zoll tief in das Brett hinein
reichen, sind mit Schraubenwindungen versehen, worin hölzerne Schrauben (Fig. 18, s) passen, welche in der Mitte hohl sind, so daß die
Cylinder der Zinkelemente mit einiger Reibung hindurch gestekt werden können.
₁ⁿ, ₂ⁿ (Fig. 17) sind Rinnen,
welche um die Dike des Zinkblechs, woraus die Zinkcylinder bestehen, tiefer als die
Schraubenmutter in das Brett eingeschnitten sind und die Schraubenwindungen
durchbrechen. Die übrigen im Rahmen befindlichen Löcher (o,
Fig. 17)
haben den Zwek, denselben leichter zu machen. – Um nun die Zinkelemente auf
den Nahmen zu befestigen, verfährt man auf folgende Art. Man sezt zuerst das
Zinkelement (Fig.
19) so ein, daß der Zinkstreifen p in die
Rinne ₁ⁿ zu liegen kommt, schiebt sodann die Schraube über den
Zinkcylinder und schraubt dieselbe so tief ein, daß sie fest auf dem Zinkstreifen
aufsizt. Auf das Ende der Schraube wird alsdann der Ring q des folgenden Zinkelements Fig. 20 so aufgepaßt, daß
dessen Zinkstreifen r in die folgende Rinne
₂ⁿ zu liegen kommt, und die Befestigung des zweiten Zinkcylinders wie
vorhin bei dem ersten bewerkstelligt. Auf gleiche Weise werden die übrigen
Zinkelemente von der Form Fig. 20 auf dem Rahmen
befestigt. Den Schluß bildet ein Element von der Form der Fig. 21. Um die
Kohlencylinder zwischen dem über die Schraube hervorragenden Zinkringe und der
Schraube befestigen zu können, enthalten die beiden leztern kleine hervorstehende
Zäpfchen (z, Fig. 18, 19, 20); in die äußere und
innere Oberfläche der ersteren dagegen sind hakenförmige Rinnen (k,
Fig. 22)
eingeschnitten. Sezt man nämlich die Kohlencylinder so auf, daß sich die Zäpfchen in
die Rinnen schieben und gibt man jenen alsdann eine kleine Drehung, so sind
dieselben auf der Schraube so befestigt, daß sie beim Umdrehen des Rahmens nicht
fallen können, siehe Fig. 18. – Dreht
man nun den Rahmen um und paßt ihn so auf das Gestell auf, daß die Pfosten (f, f, Fig. 16) des leztern
durch die Löcher (a,
Fig. 17) des
Rahmens gehen, so werden sich die Zinkcylinder in den Thonzellen und die
Kohlencylinder zwischen Glas und Thonzellen schieben und der Apparat sofort in
Thätigkeit gerathen. Will man den Apparat außer Thätigkeit sezen, so braucht man nur
den Rahmen nach dem Emporheben ein wenig auf die Seite zu rüken, so daß die
prismatischen Zapfen (w, Fig. 17) in die
Einschnitte d der Pfosten hineinpassen. Damit beim
Aufziehen des Rahmens die Thonzellen nicht mit in die Höhe gehoben werden, müssen
Zink- und Kohlencylinder ohne zu große Reibung an denselben vorbeistreifen.
Fig. 23
stellt eine perspectivische Ansicht des Apparates dar.
Tafeln