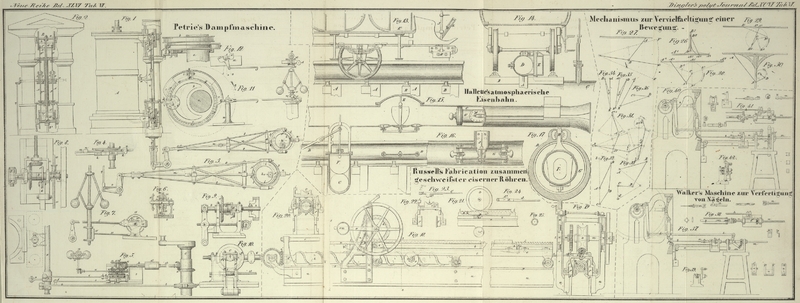| Titel: | Maschine zur Verfertigung von Nägeln, worauf sich Bernard Peard Walker zu Wolverhampton am 6. März 1844 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 96, Jahrgang 1845, Nr. CVIII., S. 434 |
| Download: | XML |
CVIII.
Maschine zur Verfertigung von Naͤgeln,
worauf sich Bernard Peard
Walker zu Wolverhampton am 6. Maͤrz 1844 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai
1845, S. 314.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Walker's Maschine zur Verfertigung von Nägeln.
Fig. 37
stellt die Seitenansicht einer Maschine dar, an welcher meine Verbesserungen in
Anwendung gebracht sind; die Abbildung zeigt einige Theile im Durchschnitte.
Fig. 38 ist
der Grundriß und
Fig. 39 die
Endansicht einiger Haupttheile. Die andern zu diesen Abbildungen gehörigen Figuren
sind Separatansichten einzelner Details. a ist die
Treibwelle, welche von einer Dampfmaschine oder sonstigen Triebkraft aus in Bewegung
gesezt wird. Die Welle a enthält eine Kurbel, die mit
Hülfe der Verbindungsstange c das Messer d in Bewegung sezt; e ist
die feste Schneide. Ein an derselben Welle befindliches Excentricum f sezt den Hebel g in
Bewegung, an dessen unterem Ende die Verbindungsstange h
eingehängt ist, die mit dem Arm i des gezahnten Sectors
j in Verbindung steht. Dieser Sector greift in das
Winkelrad k und ertheilt demselben eine halbe Umdrehung
erst in der einen, dann in der andern Richtung, wodurch der Eisenstreifen, woraus
die Nägel geschnitten werden sollen, umgewendet wird; und da die Achse des schmalen
Metallstreifens mit der Schneide des Messers einen Winkel bildet, so erhält man
Nägel, deren Spize zuerst von der einen und dann von der andern Kante des
Metallstreifens aus gebildet werden. Das Rad k ist an
der in geeigneten Lagern sich drehenden Röhre l
befestigt. In dieser Röhre gleitet eine Stange m, jedoch
so, daß sie sich mit derselben drehen muß, indem sie mit einer longitudinalen
Vertiefung versehen ist, in welche eine im Innern der Röhre l befindliche Hervorragung tritt. n ist ein
auf der ekigen Stange o gleitender Schlitten; die Stange
m, die sich in Lagern l¹ dreht, steht durch ein Universalgelenk p
mit dem Hälter m¹ in Verbindung. Der leztere
besteht aus zwei Platten, welche mittelst Schraube und Mutter zusammengeschraubt
werden und den schmalen Metallstreifen q fest
einklemmen. Da sich die Stange m¹ in einem
geschlizten Lager l³ dreht, so kann der Hälter
während der Drehung gehoben werden, damit derselbe während einer halben Umdrehung
nach jedem Schnitte den Eisenstreifen leicht umwenden könne. Ein Gewicht r zieht den Schlitten und die Stange m, mithin auch den Metallsreifen beständig vorwärts;
dieser wird durch den Theil s
dem Messer zugeführt.
t ist eine an dem Wagen angebrachte Feder, welche
gegen die untere Seite der ekigen Stange drükt.
Fig. 40 ist
die theilweise im Durchschnitt genommene Seitenansicht einer andern Maschine, wobei
die Stange m beim Umwenden des Metallstreifens durch den
Mechanismus gehoben wird.
Fig. 41 ist
der Grundriß eines Theils der Maschine und
Fig. 42 eine
Endansicht einiger Theile; die übrigen Figuren neben Fig. 41 und 42 sind
Separatansichten einzelner Details dieser Maschine. Diese Theile, welche den bereits
erwähnten ähnlich, und mit denselben Buchstaben bezeichnet sind, bedürfen keiner
weiteren Beschreibung. Anstatt des gezahnten Sectors zur Drehung der Röhre, worin
sich die Stange m bewegt, ist hier eine Zahnstange
angeordnet, welche durch die Rotation der Hauptachse a
auf die aus der Abbildung deutlich zu entnehmende Weise auf und nieder bewegt wird.
An der Röhre l sind zwei excentrische Scheiben v befestigt, die sich zwischen den festen Theilen w, w drehen. Während sich also die Röhre l dreht, steigt sie mit der Stange m und dem Hälter m¹
in die Höhe, und hebt den Metallstreifen, während sich dieser umwendet. Die Röhre
l dreht sich in einem verschiebbaren Lager und die
Stange m in einem am Schlitten n angebrachten verschiebbaren Lager. Der Stiel m¹ des Hälters tritt in die Stange m
und an dieser ist ein zwischen zwei festen Flächen w¹, w¹ rotirendes Excentricum v¹ angebracht. Wenn daher die Röhre l in die Höhe geht, so geht auch der Hälter mit in die
Höhe.
Tafeln