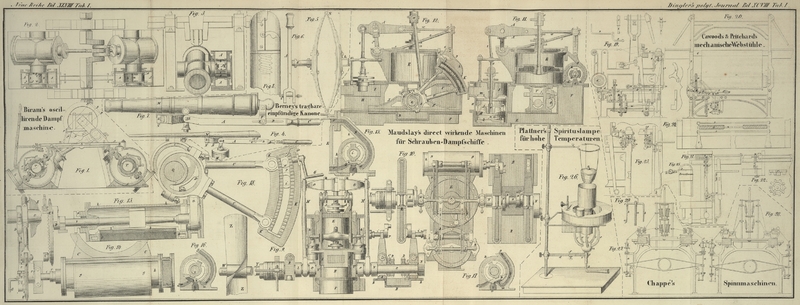| Titel: | Verbesserungen an mechanischen Webestühlen, besonders für leinene Gewebe, worauf sich Martin Cawood, Mechaniker zu Leeds, und William Pritchard zu Burley bei Leeds, am 12. Sept. 1844 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 98, Jahrgang 1845, Nr. V., S. 10 |
| Download: | XML |
V.
Verbesserungen an mechanischen
Webestuͤhlen, besonders fuͤr leinene Gewebe, worauf sich Martin Cawood, Mechaniker zu
Leeds, und William Pritchard zu Burley
bei Leeds, am 12. Sept. 1844 ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jul.
1845, S. 20.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Cawood's und Pritchard's Verbesserungen an mechanischen
Webestühlen.
Unsere Erfindung bezieht sich
1) auf eine Methode die Kette zu liefern;
2) auf geeignete Mittel den Webestuhl still zu stellen, wenn der Eintrag nicht mit
dem Schüzen durch die Kette gegangen seyn sollte;
3) auf die Construction einer selbstthätigen Vorrichtung, um das Gewebe ausgespannt
zu erhalten;
4) auf eine Methode dem leinenen Gewebe in mechanischen Webestühlen Elasticität zu
geben, damit die Lade nicht, wie bisher, Nachtheile erleide.
Wir haben es nicht für nöthig erachtet, in den Abbildungen den vollständigen
Webestuhl darzustellen, sondern dieselben hauptsächlich auf unsere Verbesserungen
beschränkt. In allen Figuren findet man gleiche Theile mit gleichen Buchstaben
bezeichnet. a, Fig. 19 und 20, ist der
Kettenbaum, an dessen Achse das Rad b befestigt ist,
welches seine Bewegung von der Schraube c erhält. Die
Geschwindigkeit der Schraubenachse d wird durch den
abnehmenden Durchmesser der Kettenwalze regulirt, damit die Bewegung der Kette
ungeachtet des abnehmenden Durchmessers des Kettenbaumes stets gleichförmig sey.
Dieser Zwek wird auf folgende Weise erreicht. e ist eine
Walze, welche beständig gegen die Oberfläche der Kette auf dem Kettenbaum drükt;
diese Walze ist in den an einer Achse g befestigten
Armen f gelagert. Eine Feder h an dem Ende des gleichfalls an der Achse g
befestigten Arms f1
drükt die Walze e fortwährend gegen die Oberfläche der
Kette auf dem Kettenbaume. f2 ist ein anderer an die Achse g befestigter
Arm und i eine Verbindungsstange, welche mit dem Arm f2 und dem um k drehbaren Winkelhebel j
artikulirt. An das andere Ende des Hebels j ist die
Verbindungsstange l eingehängt, welche vermöge ihrer
gabelförmigen Gestalt zu beiden Seiten des um m1 drehbaren und mit einem Schliz versehenen
Winkelhebels vorbeigeht. Mit der Stange l steht die
Verbindungsstange n in Verbindung; der Bolzen, welcher
das gabelförmige Ende der ersteren mit der lezteren vereinigt, geht durch den Schliz
in dem Hebel m und das andere Ende der Stangen ist mit
dem geschlizten Arm durch einen Bolzen verbunden. Der Arm o
ist mit einem Schliz
versehen, damit sich der Bolzen, womit die Stange n mit
demselben verbunden ist, durch den Arbeiter adjustiren lasse, so daß, je nachdem
dieser Bolzen höher oder niedriger in dem Schlize befestigt wird, die Quantität des
auf eine gegebene Länge des Fabricates kommenden Eintrags regulirt werden kann. An
der Achse der Schraube c befindet sich das Sperrrad p, welches durch die an dem Ende der Stange r angebrachten Sperrklauen q
umgetrieben wird. Das vordere Ende der Stange r ruht in
einem Loche oder Lager an der Vorderseite der Maschine, und nahe an dem Ende, wo die
Klauen angebracht sind, befindet sich ein kleiner Hals oder eine Hervorragung
rechtwinkelig zu der Seite der Stange. Dieser Hals tritt in ein an dem Ende des
Winkelhebels m angebrachtes Lager; wenn sich daher
dieses Ende des Hebels auf und nieder bewegt und dadurch die Sperrklauen in
Thätigkeit sezt, so behaupten sie doch immer eine beinahe verticale Stellung,
anstatt sich durch denselben Bogen zu bewegen, den das untere Ende des Hebels m beschreibt. Dieser leztere Umstand ergibt sich daraus,
daß die Stange r, woran die Klauen befestigt sind, auf
der einen Seite einen Hebel von beträchtlicher Länge bildet. An der Achse der
Schraube befindet sich eine Rolle c2, welche von einem Riemen, woran ein Gewicht
hängt, die nöthige Reibung erhält, um der Achse eine stetige Bewegung zu geben. Aus
der ganzen Einrichtung erhellt nun, daß in dem Maaße, als der Garnbaum an
Durchmesser zunimmt, das Sperrrad um einen größeren Bogen umgedreht wird, daß also
die Kette mit gleichförmiger Bewegung fortschreitet.
Wir kommen nun zum zweiten Theil unserer Erfindung. s ist
eine geschlizte Stange. Der geschlizte Theil steht an der Vorderseite des Rietblatts
und die Stange ist an einen um t1 drehbaren Hebel t
befestigt. Um das geschlizte Ende s1 dieser Stange in der geeigneten Lage zu
erhalten, ist ein belasteter, vertical hängender Hebel v
angebracht. Mit dem anderen Ende der Kurbel t steht die
Stange t2 in
Verbindung, deren unteres Ende eine Erweiterung enthält; je nachdem nun diese
Erweiterung unter dem Riegel t3 weggeschoben oder daselbst gelassen wird, fährt
der Webestuhl in seiner Thätigkeit fort oder hält still, wobei die Stange t2 durch das Gewicht
im Zustande des Gleichgewichtes erhalten wird. Der Riegel t3 wird vermittelst einer gewundenen
Feder beständig zurükgehalten und die Hervorragung t4 an der Excentricumwelle drükt den Riegel bei
jeder Umdrehung hinauf. Bleibt die Erweiterung zwischen dem Ende des Riegels und des
Hebels u, so wird der Webestuhl durch den Hebel u außer Thätigkeit gesezt, indem dieser den Riemenhebel
frei läßt; sinkt dagegen die Erweiterung aus dem Raume zwischen dem Ende des Riegels und dem Hebel
nach dem Riemen herab, so sezt der Webestuhl seine Thätigkeit fort. Eine kleine
Hervorragung w ist gerade an der Vorderseite des
Rietblattes so befestigt, daß sie in dem Augenblike, wo die Lade aufschlägt, leicht
zwischen die geschlizten Enden s1 der Stange s tritt,
wobei sie den Eintrag zwischen sich und das geschlizte Ende nimmt; dadurch wird
dieses Ende mit dem Eintrag vorwärts geführt, und veranlaßt nun die Erweiterung der
Stange t2 unter den
Riegel hinabzugehen; der Riegel kommt daher mit dem Hebel des Treibriemens nicht in
Berührung, weßwegen der Webestuhl zu arbeiten fortfährt. Sollte jedoch der Eintrag
nicht durch die geöffnete Kette gegangen seyn, so wird das geschlizte Ende nicht
bewegt, die Erweiterung der Stange t2 bleibt zwischen dem Riegel und dem Hebel des
Treibriemens und veranlaßt dadurch den Stillstand des Webestuhls.
Wir kommen nun zur Beschreibung einer zweiten Anordnung zum Einstellen des
Webestuhls, wenn der Eintrag nicht durch die Kette gegangen seyn sollte. Fig. 23 stellt
diese Einrichtung dar. Die Stelle des oben erwähnten Riegels vertritt hier ein Rad
x, welches bei jedem Aufschlagen der Lade y um einen Zahn vorwärts bewegt wird. y enthält einen Treiber y1 welcher bei der Vorwärtsbewegung des Schwertes
auf die Zähne des Rades wirkt. Gegen den unteren Theil des Rades lehnt sich das eine
Ende des Hebels z, während das andere Ende desselben
durch die Umdrehung des Rades auswärts bewegt wird. Sollte sich daher die
Erweiterung an dem unteren Ende der Stange t2 zwischen ihm und dem Riemenhebel befinden, so
würde der Webestuhl in Stillstand kommen; wird dagegen diese Erweiterung aus dem
Raume zwischen dem Hebel z und dem Riemenhebel
hinwegbewegt, so sezt der Webestuhl seine Arbeit fort. Die übrigen Theile des
Apparates sind den bereits beschriebenen ähnlich.
Der dritte Theil unserer Erfindung ist in Fig. 24 und 25
dargestellt. An den Brustbaum sind die Federn 1,1 befestigt, woran die Endplatten
2,2 angebracht sind; diese sind mittelst zweier Stangen 3,3 mit einander verbunden.
4 ist eine in den Platten 2,2 gelagerte Achse. Die Achsenenden enthalten
Erweiterungen oder Cylinder 5,5, um die ein schmales Drahtkrazenband mit kurzen
Zähnen schraubenförmig gewunden und befestigt ist, so daß das von dem Riet kommende
Gewebe durch die Rotation der Achse 4 ausgespannt wird. Das Gewebe geht über die
Stange 3 nächst dem Rietblatt, tritt unter die Achse 4, dann über die Stange 3
nächst dem Brustbaum und von da über den Brustbaum.
Wir kommen nun an den vierten Theil unserer Erfindung, welcher in einer solchen
Anordnung der Kette für Leinwand besteht, daß die Kette in Ermangelung der natürlichen
Elasticität von dem Webestuhl selbst die nöthige elastische Bewegung erhält. Die
Kette geht von dem Kettenbaum über eine Walze 6 und von da über den Brustbaum. Die
Walze 6 ist in den an das Maschinengestell befestigten gußeisernen Armen 7 gelagert.
Diese Arme besizen wegen ihrer Länge einen gewissen Grad von Elasticität oder
elastischer Nachgiebigkeit, welche es möglich macht, leinene Gewebe mit Sicherheit
auf mechanischen Stühlen zu erzeugen.
Tafeln