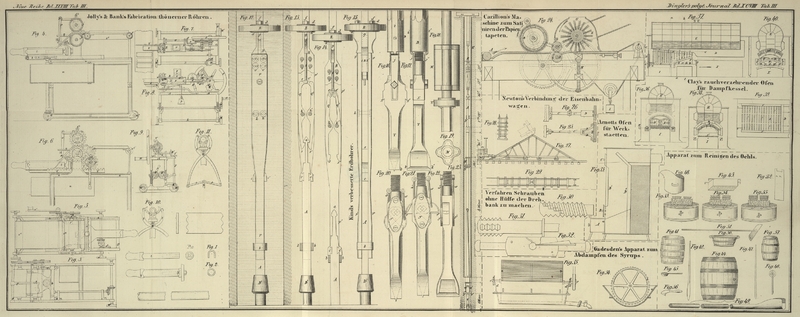| Titel: | Beschreibung einer einfachen Methode zum Reinigen des Oehls; von E. O. Schmidt. |
| Autor: | Eduard Oscar Schmidt [GND] |
| Fundstelle: | Band 98, Jahrgang 1845, Nr. LVII., S. 195 |
| Download: | XML |
LVII.
Beschreibung einer einfachen Methode zum Reinigen
des Oehls; von E. O.
Schmidt.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Schmidt, über Reinigen des Oehls.
Ich nehme an, daß man 10 Cntr. Oehl auf einmal raffiniren will und gebe deßhalb die
Quantität der Species, die dazu gebraucht werden, immer in Rüksicht auf dieses
Quantum an. Vorerst werden 10 Cntr. Rüböhl auf den Ansezkübel Fig. 41 gezogen, worauf
unter dasselbe 15 Pfd. concentrirte Schwefelsäure gemischt werden, indem man während
dem beständigen Umrühren des Oehls mit der Stange Fig. 42 das Vitriolöhl
nur tropfenweise in das Oehl eingießt. Um dieses zu bewerkstelligen, wird das Sieb
Fig. 43,
welches zwischen zwei hölzernen Stangen befestigt ist, über den Ansezkübel gehängt
und zwar etwas nach Hinten zu, damit die Bewegungen der Stange nicht gehindert
werden. In diesem Sieb sind hie und da kleine Löcher von so geringer Dimension als
nur möglich angebracht, durch welche das nach und nach in das Sieb geschüttete
Vitriolöhl fadenförmig und langsam in das Rüböhl laͤuft. Weil das Vitriolöhl
wegen seiner alles angreifenden und zerstörenden Schärfe auch das Metall zerfrißt,
so ist es am zwekmäßigsten, sich dieses Sieb bei einem Töpfer aus Steingut
anfertigen zu lassen, wobei jedoch demselben zu bemerken ist, es mit einem
umgebogenen Rande zu versehen, damit es zwischen die Stangen gehaͤngt werden
kann. Das Umrühren des Oehls mit der Stange muß unausgesezt und ohne daß sich der
damit beschäftigte Arbeiter auch nur die geringste Pause gönnt, eine Stunde lang
fortgesezt werden, wo dann das Oehl anstatt der im Anfang durch das Verbrennen der
Pflanzentheile
entstandenen grünen Farbe eine weißliche annimmt, was man auch, sobald ein Stok in
das Oehl getaucht wird, an den Tropfen, die an demselben nach dem Herausziehen
herunter laufen, erkennen kann. Bei dem Rühren selbst ist darauf hin zu arbeiten,
daß das Oehl mittelst der Stange bestmöglich mit dem Vitriolöhl vereinigt werde und
dadurch dieses seinen Zwek, die Pflanzentheile des Rüböhls zu verbrennen, vollkommen
erfüllen kann. Am besten wird diese Absicht erreicht, wenn der Arbeiter die Stange
so führt, daß er dieselbe auf der einen Seite von der Oberfläche nach dem Grunde zu
und auf der andern entgegengesezten von dem Grunde aus nach der Oberfläche zu
bewegt, indem er dabei einen Kreis beschreibt. Nach Vollendung dieser Operation läßt
man das Oehl in dem Ansezkübel 12 Stunden lang stehen, wodurch dasselbe Zeit
gewinnt, die verkohlten Pflanzentheile abzusezen, welche auf dem Boden des Fasses
einen schwarzen Niederschlag bilden. Länger jedoch, als wie bis zu dem bestimmten
Termin, darf man das Oehl nicht auf dem Ansezkübel lassen, indem das noch darin
befindliche Vitriolöhl sonst das Oehl beizen und demselben eine röthliche statt eine
weiße Farbe geben würde. Nach Ablauf der Zeit wird das angesezte Oehl, damit
dasselbe gewaschen werden kann, auf das Waschfaß Fig. 44 gebracht. Das
Oehl schöpft man mit der Schöpfkelle Fig. 45 aus dem
Ansezkübel heraus in das Waschfaß, wobei jedoch das Beunruhigen des Oehls zu
vermeiden ist, indem sonst sehr leicht der sich zu Boden gesezte Schleim wieder
aufsteigen und mit dem Oehl vereinigen kann. Auch muß so viel als nur möglich das
Fallen des Oehls aus der Schöpfkelle in den Ansezkübel während des Ausschöpfens in
das Waschfaß vermieden werden, da hiedurch gleichfalls das Oehl beunruhigt wird. Hat
man das Oehl so weit ausgeschöpft, daß man nicht gut ohne Niederschlag mit zu
erhalten, dasselbe noch mit der Kelle Fig. 45 schöpfen kann, so
bedient man sich dazu der flachen Kelle Fig. 46, wobei aber
darauf zu sehen ist, daß man keinen Schlamm mit schöpft. Es würde aber nicht möglich
seyn, das Oehl ohne Niederschlag mitzuschöpfen, ganz rein aus dem Ansezkübel
herauszubringen; deßhalb wird dieses Ansezfaß, nachdem man so viel als möglich das
Oehl noch abgeschöpft hat, gestürzt, wo dann das sich noch auf der Oberfläche des
Niederschlags befindende Oehl in ein unter den Ansezkübel gehaltenes hölzernes Gefäß
Fig. 50
läuft. Damit der Ansezkübel nicht so hoch gehoben zu werden braucht, so ist in der
Nähe desselben in dem Boden der Raffinerie ein mit einem Dekel verschließbares Loch
angebracht, in das das hölzerne Gefäß gesezt wird. Der Niederschlag selbst wird
mittelst einer hölzernen Kraze Fig. 51 aus dem Faß
entfernt. Stets aber läuft bei dem Ausschütten des Oehls aus dem Ansezkübel etwas Niederschlag mit
aus demselben heraus; diesen scheidet man von dem Oehl dadurch, daß man nach Verlauf
von einigen Stunden etwas heißes Wasser in das Gefäß gießt und so den Niederschlag
zu Boden schlägt. Dieses so gewonnene Oehl wird bei der nächsten Waͤsche mit
gewaschen. Um bei dem Ausschöpfen zu vermeiden, daß viel Oehl durch den Transport
desselben nach dem Waschfaß verloren geht, bedient man sich der blechernen Rinne
Fig. 49.
Dieselbe besteht, damit sie je nach der Entfernung, in der das Waschfaß von dem
Ansezkübel sich befindet, vergrößert oder verkleinert werden kann, aus mehreren
Theilen. Damit das Oehl schneller durch dieselbe hindurchläuft, wird an dem
Ansezkübel das Brett Fig. 52, welches 4 Zoll
höher als das Waschfaß ist, angehängt, wozu an der Rükseite des Brettes zwei Haken
angebracht sind. Das Waschen des Oehls besteht darin, daß man 100 Quart kochendes
Wasser, in welchem 10 Pfd. Kochsalz aufgelöst worden sind, nach und nach unter das
Oehl gießt, wobei ebenfalls mittelst Umrührens mit der Stange Fig. 47 das Oehl mit dem
Wasser gemischt wird. Bei dem Umrühren gilt dasselbe, was ich davon schon erwähnt
habe, als von dem Ansezen des Oehls die Rede war, und ist der einzige Unterschied
der, daß hier nur eine halbe Stunde gerührt zu werden braucht. Zum Waschfaß selbst,
das natürlich hoch und weit genug seyn muß, um die Masse fassen zu können, bedient
man sich in der Regel Stükfässer, deren oberer Theil in der Höhe von 5 Fuß
abgeschnitten wird. Auf dem Waschfaß muß nun das Oehl fünf Tage lang in der größten
Ruhe stehen bleiben und ist alles Schaukeln und Stoßen an dem Waschfaß, wodurch das
Oehl beunruhigt werben könnte, zu vermeiden. Während dieser Zeit sondert sich das
Wasser vollkommen von dem Oehl und schlaͤgt sich sammt den Schleimtheilen,
die noch in dem Oehl enthalten sind, auf dem Boden des Fasses nieder. Dann schöpft
man das Oehl, so wie es gebraucht wird, mittelst der Kelle Fig. 45, die auch schon
beim Ansezkübel angewendet worden ist, in den Ständer Fig. 48, um es in
demselben auf den Filtrirapparat zu bringen. Das Ausschöpfen des Oehls aus dem
Waschfaß ist mit der größten Ruhe zu vollziehen und vorzüglich das Zurükträufeln des
Oehls aus der Schöpfkelle in das Waschfaß zu vermeiden, indem sich leicht, wenn das
Oehl beunruhigt wird, Wasser wieder mit jenem vermischen kann, wo alsdann, weil das
Wasser durch das Filtriren sich nicht von dem Oehl entfernen läßt, das raffinirte
Oehl beim Verbrennen anfängt zu knistern und eine flakernde Flamme zu geben. Hat man
das Oehl so weit ausgeschöpft, daß dasselbe noch ungefähr 4 Zoll hoch über dem
Wasser steht, so wird dann zum ferneren Ausschöpfen des Oehls die flache Kelle Fig. 46
genommen, wobei man sich jedoch sehr in Acht nehmen muß, Wasser mit zu schöpfen. Ist man endlich
nicht mehr im Stande diese Operation zu vollziehen, ohne Gefahr zu laufen Wasser mit
zu schöpfen, so schöpft man das sich noch auf der Oberfläche des Wassers befindende
Oehl rein ab und gießt es in das Faß Fig. 57 rein ab, wo es
dann durch das später beschriebene Verfahren von dem Wasser, welches man
mitgeschöpft hat, befreit wird. Hierauf wird das im Waschfaß zurükgebliebene Wasser
ausgeschöpft und jenes rein ausgescheuert.
Jezt bleibt nur noch übrig, das Filtriren genau zu beschreiben. Hiezu hat man die
Fig. 53,
54, 55
abgebildeten Apparate nöthig. In Fig. 53 ist ein auf einem
hölzernen Kübel stehender, aus Weidenruthen geflochtener Korb abgebildet, der in
vier Abtheilungen getheilt ist, in deren jeder ein Filzhut steht. Durch diese hüte
läuft das vom Waschfaß auf dieselben aufgefüllte Oehl in den Kübel. Von diesem wird
es wieder mittelst des Hahns a, der sich an ihm
befindet, abgezogen und auf den Apparat Fig. 54 gebracht. Dieser
Apparat weicht von dem vorhin beschriebenen dadurch ab, daß sich nicht wie bei jenem
ein Filz in jeder Abtheilung befindet, sondern daß es deren zwei sind, die in
einander gestekt werden. Das von dem Kübel, der sich unter dem Apparat Fig. 54 zum
Sammeln des Oehls befindet, abgezogene Oehl wird auf den Apparat Fig. 55 aufgegeben, auf
dem es endlich den nöthigen Grad der Klarheit erhält. In dem Apparat Fig. 55 sind drei solcher
Filze in einander gestekt. Die zum Filtrirapparat nöthigen Hüte sind von Filz und
können von jedem Hutmacher angefertigt werden. Um diese Filze von dem Oehlschleim zu
reinigen, bedient man sich der in Fig. 56 dargestellten
Schabe, die mit etwas scharfen Enden versehen ist und mit welcher man durch Schaben
die Oehlschleimtheile aus dem Filze entfernt. Das im Faß Fig. 57 sich befindende
Oehl wird, nachdem es sich durch mehrtägige Ruhe von dem Wasser getrennt hat,
ausgeschöpft und nochmals mitgewaschen.
Tafeln