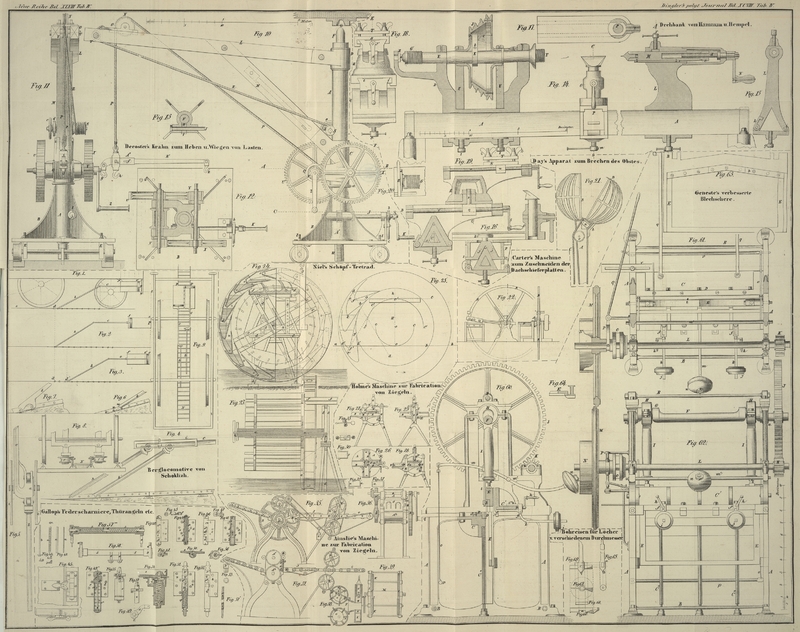| Titel: | Bericht des Hrn. Theodor Olivier über einen von Decoster construirten Krahn zum Heben und Wiegen von Lasten. |
| Fundstelle: | Band 98, Jahrgang 1845, Nr. LXXII., S. 258 |
| Download: | XML |
LXXII.
Bericht des Hrn. Theodor Olivier uͤber einen von
Decoster
construirten Krahn zum Heben und Wiegen von Lasten.
Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement,
Maͤrz 4845, S. 91.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Olivier, über Decoster's Krahn zum Heben und Wiegen von
Lasten.
Hr. Decoster, Maschinenfabrikant in Paris (rue Stanislas No. 9, Faubourg
Saint-Germain) wendet zum Betriebe seiner Werkstätte eine
Dampfmaschine von 12–15 Pferdekräften an; 180 Arbeiter sind täglich bei ihm
mit der Verfertigung von 38 verschiedenartigen Maschinen zur Bearbeitung des Eisens,
z. B. Hobelmaschinen, Walzwerken, Blechscheren, Fräse- und
Nuthenhobelmaschinen, Bohrmaschinen, Drehbänken etc. beschäftigt. Mehrere dieser
Maschinen haben zwekmäßige Abänderungen und glükliche Vervollkommnungen durch ihn
erhalten; vorzüglich sind seine Bohr- und Ausbohrmaschinen beachtenswerth,
welche durch ihn gleichsam zu neuen Maschinen umgearbeitet wurden. Kürzlich erfand
er einen neuen Krahn, der sehr geeignet für Maschinenbau-Werkstätten ist, wo
man beständig mit großen Gußstüken von mehreren Tausend Kilogrammen zu thun hat.
Dieser Krahn, welcher auf einem 0, 90 Meter breiten Wagen ruht, läßt sich auf einer
Eisenbahn, die sich in der Werkstätte zwischen den Arbeitsmaschinen befindet,
bewegen, und kann auf diese Weise überallhin gebracht werden, wo man ihn nöthig hat.
Damit man ihn aber leicht überallhin schieben kann, mußte seine verticale Achse
einige Centimeter niederer als die Deke der Werkstätte gemacht werden; ist er aber
an der Stelle, wo man ihn nöthig hat, so muß man seine verticale Achse oben an der
Deke befestigen können. Hr. Decoster
nahm als Achse einen
hohlen Cylinder, worin sich mittelst einer Winde eine schmiedeiserne Stange der
Länge nach bewegen läßt, welche in eine hölzerne Pfanne tritt, die an der Deke
zwischen zwei Balken befestigt ist. Um den hohlen Cylinder, welcher fest mit dem
Wagen verbunden ist, dreht sich der Krahn mit seinem Zubehör, indem zwei Muffe oder
lange cylindrische Ringe, die als Halsbänder dienen, über denselben gestekt sind. An
dem einen dieser Muffe ist die hölzerne Stüze befestigt, und von dem anderen wird
das eine Ende des horizontalen Krahnarmes, der ebenfalls von Holz ist, gehalten.
An dem ersten oder unteren Muff ist das Rädersystem, welches zur Bewegung des Krahns
dient, angebracht. Mit der hohlen Säule aus einem Stüke ist ein starker Ring, auf
welchem der erste Muff aufruht, und auf dem er sich drehen läßt.
Mit diesem Krahn, dessen Gewicht ungefähr 1400 Kilogr. beträgt, können Stüke bis zu
4000 Kilogr. Gewicht gehoben werden. Er unterscheidet sich von den gewöhnlichen
dadurch, daß man mit ihm die aufgehobenen Gußstüke nach Belieben wiegen kann, wie
dieß bei dem von Hrn. George erfundenen (im
polytechnischen Journal Bd. XCIII S. 196 beschriebenen) Krahn der Fall ist; bei lezterem
wiegt man aber jedesmal den Krahn mit, während bei dem Krahn von Decoster nur der zu wiegende Gegenstand gewogen wird. Das
Wiegen geschieht bei dem Krahn von Decoster auf folgende
Weise:
Anstatt daß man das zu hebende Gußstük unmittelbar an das Ende des Taues anhängt,
bringt man zwischen beide eine römische oder Schnellwaage. Will man wiegen, so
schlägt man eine Kette oder ein zweites Tau um den am kürzeren Waagearm angebrachten
Haken und das zu wiegende Stük. Will man ein Gußstük bloß aufheben, so hängt man es
mittelst einer Kette oder eines Taues an den Haken, welcher unten am hause der Waage
befestigt ist. Oben trägt dieses Haus einen Ring, mittelst dessen es an das Ende des
Krahntaues befestigt ist, sey es nun, daß man zu wiegen beabsichtigt, oder daß man
die Last bloß heben will. In lezterem Falle hat die Schneide der Waage nichts zu
tragen, und sie ruht bloß auf der Pfanne, wird also nicht verdorben, da sie bloß
dann gebraucht wird, wenn gewogen werden soll. Der längere Waagearm könnte übrigens
beim gewöhnlichen Gebrauche des Krahns hinderlich seyn, denn es reicht hin, ein zu
bearbeitendes Stük zweimal zu wiegen; zuerst vor Beginn der Arbeit, und dann nach
Vollendung derselben; während der Arbeit selbst jedoch ist man oft genöthigt das
Stük zu wenden, vertical oder horizontal oder schräg zu stellen, je nach der Art der
Maschine, die daran hobelt oder fräst etc. Deßwegen machte Hr. Decoster den längeren Waagearm aus zwei Theilen, und will man wiegen, so
stekt man den
großen, abnehmbaren Waagearm an den Theil der Waage, welcher beständig am Krahntau
befestigt bleibt, und an das Ende des mit einer Schraube befestigten langen
Waagearmes wird dann die Waagschale gehängt, die ein bestimmtes Gewicht trägt, was
sich nicht wie ein Laufgewicht verschieben läßt. Dieses Gewicht besteht aus einer
Reihe einzelner Gewichtsteine, die zusammen 400 Kilogr. ausmachen. Da nun das
Verhältniß der Waagearme wie 1 : 10 ist, so braucht man 400 Kilogr. um 4000 Kilogr.
zu wiegen.
Beschreibung des Krahns.
Fig. 10 ist
die Seitenansicht des Krahns;
Fig. 11 zeigt
den Krahn von Vorn gesehen;
Fig. 12
horizontaler Durchschnitt nach der Linie A B
Fig. 10.
Fig. 13
horizontaler Durchschnitt nach der Linie C D des unteren
Theiles, der Eisenstange mit Zahnstange und des Getriebes, welches in leztere
eingreift.
Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Ansichten denselben Gegenstand.
A hohle gußeiserne Säule, welche mit ihrem unteren Theile
A′ fest mit dem Wagen B verbunden ist, der sich auf Eisenschienen fortbewegen läßt, die am Boden
der Werkstätte befestigt sind.
C Muff oder unterer Halsring, welcher die Säule A umgibt und sich auf dem Ansaze a, der aus einem Stüke mit der Säule ist, drehen läßt. Dieser Halsring
trägt das Rädersystem des Krahns und nimmt die Krahnstüze auf, welche durch eine
starke Schraube in demselben gehalten wird.
D oberer Halsring, der sich ebenfalls um die Säule dreht
und in welchem der horizontale Krahnarm befestigt ist.
E, E Bügel, in welchem die Radachsen liegen.
F verticale Achse des Krahns, die sich in der hohlen
Säule A verschieben läßt.
G hölzerne Pfanne, welche an den Balken der Werkstattdeke
befestigt ist und in die das obere Ende der Achse F zu
liegen kommt, um dem Ganzen die gehörige Stabilität zu geben.
H verzahnte Stange, die mit dem unteren Theile der Achse
F aus einem Stüke ist und in welche ein Getriebe I eingreift, das sich auf der Achse J befindet. Man dreht die Achse J mittelst einer Kurbel K, um die Achse F zu heben und ihren oberen Zapfen in die Pfanne G zu bringen.
b Sperrrad auf der Achse J,
um die rükgängige Bewegung zu vermeiden.
c Sperrklinke mit einem Handgriff, welcher in die Zähne
des Sperrrades einfällt.
L hölzerner horizontaler Arm des Krahns, welcher sich mit
dem halsringe D um die verticale Säule A drehen läßt.
M Stüze, welche diesen Arm tragen hilft; sie ist
ebenfalls von Holz und durch eine Schraube in dem unteren Halsringe C befestigt, mit welchem sie sich ebenfalls drehen
läßt.
N Seilrolle auf einer Platte O, die sich in einer Nuth verschieben läßt, welche sich in dem Arme L befindet.
P Seil, welches über diese Rolle geht und sich auf die
Trommel Q aufwikelt; es ist dazu bestimmt die Lasten zu
heben.
R anderes Seil, welches sich um die Trommel S wikelt und über die Rolle T geht; es ist an der Platte O befestigt und
verschiebt diese nach der Länge des Armes L.
d Sperrrädchen auf der Achse der Trommel S.
e kleines Schwungrad, mittelst dessen man die Trommel S dreht.
U großes verzahntes Rad, auf dessen Achse sich ein
Getriebe V befindet, welches im Eingriff mit dem Rade
X ist.
Y Getriebe auf der Achse X,
welches das Rad U in Bewegung sezt.
Z Kurbel, welche auf den vierekigen Theil der Achse
aufgepaßt ist, die durch das Rad U geht.
A″ Schnellwaage, die an dem Tau P hängt und zum Wiegen der Lasten dient.
B″ abnehmbarer Arm, welcher an die Waage A″ angestekt ist.
f Schraube, um diesen Arm zu befestigen.
g Haken am kurzen Waagearm, an welchen man die Last
hängt, wenn man sie wiegen will.
h anderer Haken, welcher sich an dem Hause i der Waage befindet und an welchen die Last gehängt
wird, wenn sie gehoben werden soll.
k Haken am Ende des abnehmbaren Waagearmes, an welchen
die Waageschale mit den Gewichten gehängt wird.
Tafeln