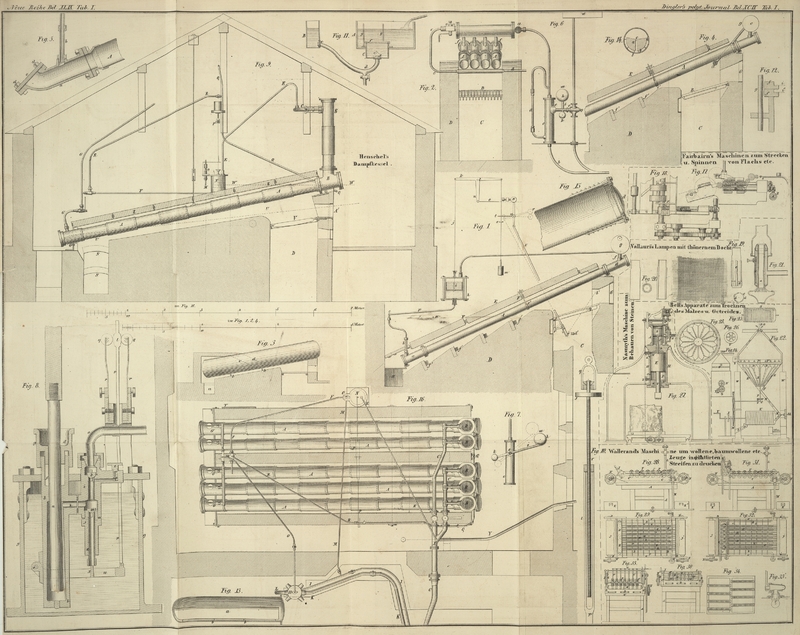| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zum Behauen, Zerbrechen, Zerklopfen und Pressen von Steinen und andern Materialien, worauf sich James Nasmyth, Civilingenieur zu Paticroft in Lancashire, am 2. Dec. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. IV., S. 28 |
| Download: | XML |
IV.
Verbesserungen an Maschinen zum Behauen,
Zerbrechen, Zerklopfen und Pressen von Steinen und andern Materialien, worauf sich
James Nasmyth,
Civilingenieur zu Paticroft in Lancashire, am 2. Dec.
1844 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts, Oct. 1845, S.
162.
Mit einer Abbildung auf Tab. I.
Nasmyth's Maschine zum Behauen der Steine.
Vorliegende Erfindung besteht:
1) in der Anwendung von Hochdruckdampf in der Art, daß durch denselben ein in einem
verticalen Cylinder gleitender Kolben auf directe Weise abwechselnd gehoben und
dessen Fall beschleunigt wird; an diesen Kolben sind zur Bearbeitung des Steins
gewisse Instrumente, z. B. Meißel, Messer, Stampfer oder Hämmer befestigt;
2) in einer eigenthümlichen Methode die Geschwindigkeit und Intensität der Schläge
nach Erforderniß zu modificiren.
Fig. 27 stellt
den verbesserten Apparat im Verticaldurchschnitt dar. Er besteht aus einem Cylinder
A, in welchen ein Kolben B paßt, dessen Kolbenstange C in einer
dampfdichten Stopfbüchse D läuft. In diesen Cylinder
wird der Dampf durch eine Röhre E aus irgend einem
geeigneten Dampfkessel geleitet, so daß derselbe mit Hülfe eines Schieberventils F seine elastische Kraft abwechselnd auf die obere und
untere Seite des Kolbens ausüben kann. Das Ventil F
erhält seine Bewegung von einem kleinen in einem Cylinder G gleitenden Kolben, dessen Stange zugleich die Ventilstange ist. Die
Bewegung dieses Ventils wird durch ein kleines Schwungrad g, g regulirt, welches zugleich das Ventil des
kleinen Cylinders G mit Hülfe des Excentricums W regulirt.
Die Kolbenstange C ist an einen cylindrischen Eisenblock
K befestigt, der beinahe luftdicht in einem
unmittelbar unter dem Cylinder A angebrachten Cylinder
H gleitet. Läßt man nun Dampf durch eine Röhre bei
J in den kleinen Cylinder G strömen, so ertheilt er dem Ventil F eine
auf- und niedergehende Bewegung, deren Rapidität durch die Art der Zulassung
und den Druck des Dampfs regulirt wird. Während das Ventil F auf diese Weise bewegt wird, läßt man Dampf durch die Röhre F einströmen, der somit abwechselnd über und unter den
Kolben B tritt. Dieser wird daher mit seinem Block
gehoben und mit einer Kraft und Schnelligkeit niedergedrückt, die von dem Dampfdruck
gegen den Kolben B und dem Gewicht der Masse K abhängt. Damit jedoch die Auf- und
Niederbewegung des Kolbens mit seinem Gewicht innerhalb gewisser Gränzen stattfinde,
ist folgende Anordnung getroffen. In dem Cylinder H
oberhalb und unterhalb des Klotzes K befinden sich
Räume, ungefähr gleich den Räumen ober- und unterhalb des Kolbens B. Wenn der obere Rand des Blocks K bei seiner aufwärts erfolgenden Bewegung an dem Loch D vorbeigeht, so schneidet er die in dem Raum M, M befindliche Luft ab,
und da diese nicht so schnell entweichen kann, als sie durch die rasche Bewegung des
Blocks K nach oben comprimirt wird, so erlangt sie sehr
bald einen hinreichenden Grad von Elasticität, um zu verhüten, daß das obere Ende
des Blocks K gegen den Boden des Cylinders und daß der
Kolben gegen den Cylinderdeckel anschlage; was aber noch wichtiger ist, die auf solche
Weise eingeschlossene und comprimirte Luft übt eine elastische Rückwirkung aus,
welche in Verein mit dem auf die obere Kolbenfläche wirkenden Dampfdruck das Gewicht
K mit großer Energie hinabtreibt.
Auf ähnliche Weise wird auch die Wirkung des Blocks K
nach unten gemäßigt. Der Cylinder H ist nämlich unten
mit einem beinahe luftdichten Loch n versehen, durch
welches der Meißelhälter T gleitet. Da nun die untere
Fläche des Blocks K bei abwärts erfolgender Bewegung
neben der Oeffnung o vorbeigeht, so wird die Luft in dem
Raume P, P abgesperrt und
comprimirt. Daher ist es nur nöthig, je nach dem Grade der Intensität, womit der
Block K sein Moment auf irgend ein unter dem
Meißelhälter befindliches Object übertragen soll, die Compression der Luft in der
unteren Kammer P zu reguliren, und dieses geschieht ganz
einfach durch Regulirung der bei Z befindlichen
Oeffnung. Durch dieses einfache Mittel ist man im Stande, jede Abstufung elastischen
Stoßes, vom feinsten bis zum kräftigsten, auf den Gegenstand einwirken zu lassen;
außerdem trägt die Elasticität der in P eingeschlossenen
Luft zur Erleichterung der aufwärtsgehenden Bewegung des Blocks K und Beseitigung aller mit dem Wechsel der Bewegung
sonst verbundener Erschütterungen wesentlich bei. Dieselbe Anordnung ist zur
Regulirung der Elasticität der Lust in der oberen Kammer M, M getroffen. Bei jedem Hube tritt die Luft
durch die Oeffnungen L und O
vollkommen frei ein.
Aus dieser Einrichtung erhellt, daß man die Gewalt womit der Block K niederfällt, mithin auch die Wirkung der Meißel,
Stampfer, Hämmer oder sonstiger an den Hälter T zu
befestigender Instrumente vollkommen in seiner Gewalt hat, um den unter denselben
angeordneten Gegenstand, z. B. die Oberfläche eines Steins, gehörig bearbeiten zu
können; man braucht in letzterem Fall den Stein nur an ein Gestell zu befestigen,
welches in rechtwinkelig zu einander stehenden Richtungen beweglich ist, so daß
jeder Theil der Steinfläche nach und nach der Einwirkung der auf dieselbe
herabfallenden Instrumente ausgesetzt werden kann.
Tafeln