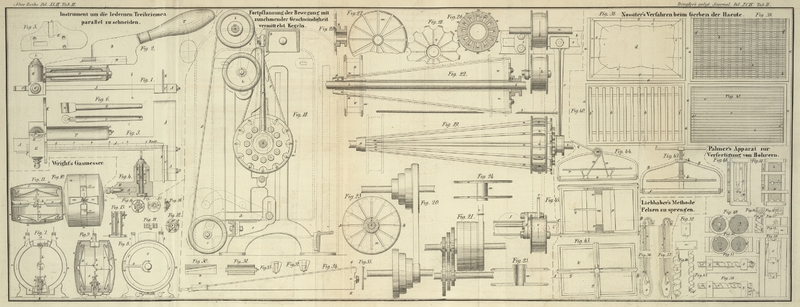| Titel: | Verbesserungen an Gasmessern, worauf sich Alexander Wright, Ingenieur in South Lambeth, Grafschaft Surrey, am 17. Oct. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. XXVI., S. 113 |
| Download: | XML |
XXVI.
Verbesserungen an Gasmessern, worauf sich
Alexander Wright,
Ingenieur in South Lambeth, Grafschaft Surrey, am 17. Oct. 1844 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts, August 1845, S.
17.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Wright's Verbesserungen an Gasmessern.
Vorliegende Construction des Gasmeters liefert eine sicherere Methode, das Volumen
des durch den Apparat gegangenen Gases zu ermitteln, gewährt eine bedeutende
Ersparniß hinsichtlich der Fabricationskosten des Meters und kann in Folge ihrer
Einfachheit nicht in Unordnung gerathen.
Fig. 7 ist ein
Verticaldurchschnitt ungefähr durch die Mitte des Meters und Fig. 8 ein Frontaufriß mit
Hinweglassung eines Theils des Gehäuses; Fig. 9 ist ein
Verticaldurchschnitt nach der Linie A B, Fig. 7; Fig. 10 eine untere
Ansicht des Meters, welche die Canäle für das Gas zeigt; Fig. 11 ein
Horizontaldurchschnitt etwas über den Kurbeln der Verticalachse.
Dieser Gasmesser besteht aus einem metallenen Gehäuse, das durch zwei Scheidewände in
drei besondere Kammern A, B
und C abgetheilt ist. Jede dieser Kammern wird
abwechselnd mit Gas gefüllt und entleert sich durch ein eigenthümlich construirtes
Ventil D, welches in einer der Kammern angeordnet ist.
a, a ist das aus
galvanisirtem Eisen construirte Gehäuse des Meters; b
die Einströmungsröhre und c die Ausströmungsröhre; d, d, e, e sind conische Scheiben, welche durch
einen Ring f, f aus Leder
oder einem andern biegsamen Material mit dem Gehäuse a,
a verbunden sind und auf diese Weise Scheidewände
bilden, welche durch einen Arm g, Fig. 8, in horizontaler
Richtung geführt werden. Eine in der Mitte des Meters angeordnete verticale Achse
h, h ist mit zwei unter
einem Winkel von 60 Graden gegen einander gestellten Kurbeln versehen. Diese Achse
wird durch die mit den Scheidewänden d und e verbundenen Verbindungsstangen i, i, Fig. 9 und 11, in Bewegung gesetzt.
Ihr unteres Ende ruht auf einem Stege k über dem Ventile
D, und ihre rotirende Bewegung wird durch den
Treiber l dem Ventile mitgetheilt. Das obere Ende der
Achse h, h tritt durch eine
Stopfbüchse und setzt einen Zählapparat in Thätigkeit.
Die Figuren
12, 13,
14, 15, 16 und 17 stellen das
Ventil D in verschiedenen Ansichten abgesondert und in
einem größeren Maaßstabe dar. Dieses Ventil besteht, wie man bemerkt, aus zwei Theilen; der obere Theil
ist Fig. 15
im Grundrisse und Fig. 16 und 17 in rechtwinkelig zu
einander stehenden Durchschnitten abgebildet. Dieser Theil des Ventils dreht sich
vermöge der nachher zu erläuternden Anordnung mit der Kurbelachse h, während der untere Fig. 12 im Grundriß, Fig. 13 im
Verticaldurchschnitt und Fig. 14 im
Horizontaldurchschnitt abgebildete Theil an den Boden des Metergehäuses gelöthet
oder auf sonstige Weise befestigt ist, wo derselbe mit der Einlaßröhre b*, der Austrittröhre c* und
mit Hülfe der Canäle m und n, Fig.
9 und 10, sowohl mit den Seitenkammern B und C, als auch mit der mittleren Kammer A communicirt. Der untere Theil des Ventils D besteht aus drei concentrisch angeordneten Röhren b*, c* und p, welche mit einander verbunden und wie Fig. 12 zeigt, an die
Vorderplatte gelöthet sind. Die äußere Röhre p ist in
drei verticale Abtheilungen p1, p2, p3 getheilt, und ein Theil dieser Röhre bei p1 ist
herausgeschnitten, um dem Gas den freien Ein- und Austritt in und von der
Kammer A zu gestatten. Das durch b oben in den Meter tretende Gas strömt in der Richtung der Pfeile unter
den Meter in die mittlere Röhre b* des Ventils D, steigt in derselben in die Höhe und gelangt durch
eine Oeffnung in den oberen Theil des Ventils D, Fig. 7. Das Gas
strömt sodann durch die in diesem Augenblicke über der Abtheilung p1 befindliche
Oeffnung q hinab und tritt in die Kammer A, wo es die Scheidewände d
und e in die Fig. 9 dargestellte Lage
zurückdrängt und dadurch der Kurbelachse eine Drehung ertheilt. Indem der an dem
unteren Ende dieser Achse befindliche Treiber l gegen
einen von dem oberen Ende des Ventils D hervorragenden
gabelförmigen Stift r stößt, wird der obere Theil oder
der Deckel dieses Ventils so weit gedreht, daß die Oeffnung q über die Abtheilung q2 gelangt. Bei dieser Lage des Ventils kann das
Gas die Abtheilung p2
hinabströmen und von da, längs des Canales m, Fig. 9 und 10,
fortströmend, die Kammer B füllen und somit die
Scheidewand d nach innen treiben. Dadurch, daß die
Stange i nach innen gedrängt wird, dreht sich die
Kurbelachse h und veranlaßt die andere Stange i die Scheidewand e in die
Kammer C hinein zu treiben. In Folge der Rotation des
Ventils kommt die Oeffnung q an der oberen Seite des
Ventils über die mit der Kammer C in Verbindung stehende
Abtheilung p3, wodurch
die Kammer C sich zu füllen beginnt. Damit dieses jedoch
geschehen könne, muß das Gas in der mittleren Kammer A
hinausgetrieben werden. Letzteres wird durch die an der Achse h befindlichen Kurbeln bewerkstelligt, indem diese die beiden Scheidewände
nahe zusammenbringen, während die oben am Ventile D
befindliche Oeffnung
t über die Abtheilung p1 gelangt, wodurch ein Ausweg gebildet
wird, durch den das Gas aus der Kammer A entweichen
kann. Das Gas steigt sofort die Oeffnung in der Abtheilung p1 hinauf und gelangt durch die Oeffnung
t in den ringförmigen Raum c*, welcher mit der Austrittröhre c in
Verbindung steht. Während das Gas aus der Kammer A
hinausgetrieben wird und die Kammer B sich nun füllt,
gelangt die Oeffnung t über die Abtheilung p2, worauf das in der
Kammer B befindliche Gas durch die Oeffnung t und den ringförmigen Raum c* nach der Austrittröhre c strömt. Auf
dieselbe Weise entweicht das in C befindliche Gas,
während die Oeffnungen in dem Ventile D herumkommen,
durch die Canäle p3,
t und c. Die Kurbelachse
enthält oben ein Getriebe u, Fig. 7, welches ein Rad
v und so fort das zum Zählapparat gehörige System
von Rädern und Getrieben in Bewegung setzt. Die Umdrehungen der Kurbelachse werden
durch die mit diesem Rädersystem verbundenen Zeiger registrirt. An dem Boden des
Meters sind die Schraubenstöpsel w, w angebracht, um die etwa mit dem Gas in den Meter
eingedrungenen und daselbst condensirten Dämpfe herauszulassen.
Tafeln