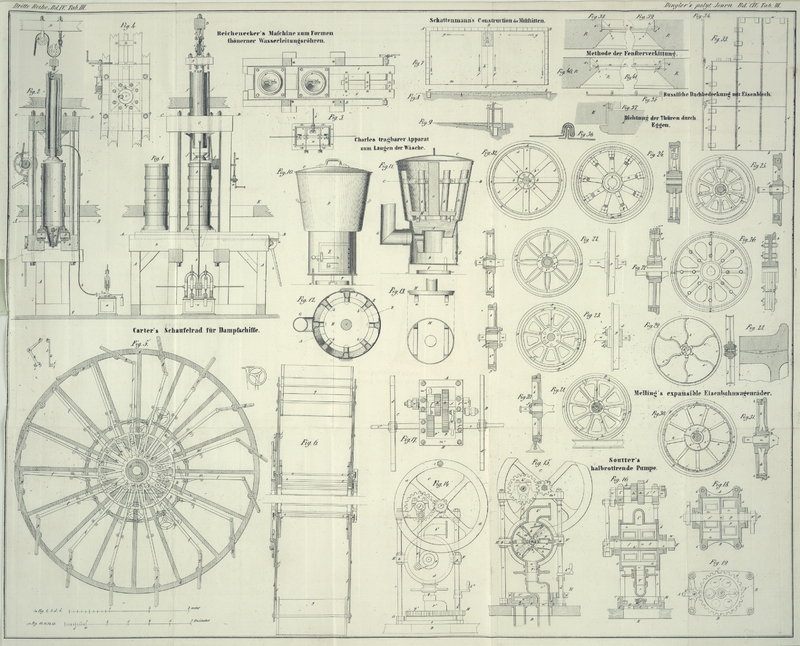| Titel: | J. Sutter's patentirte halbrotirende Pumpe. |
| Fundstelle: | Band 104, Jahrgang 1847, Nr. XXXVII., S. 167 |
| Download: | XML |
XXXVII.
J. Sutter's patentirte halbrotirende
Pumpe.
Aus dem Mechanics' Magazine, 1846, Nr.
1208.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Sutter's halbrotirende Pumpe.
Die Erfindung, welche den Gegenstand dieses Patentes bildet, umfaßt nicht nur eine
neue Construction der Pumpen, sondern auch ein verbessertes Verfahren dieselben in
Betrieb zu setzen.
Fig. 14
stellt eine äußere Ansicht meiner verbesserten Pumpe, Fig. 15 einen
Verticaldurchschnitt derselben nach der Linie AB,
Fig. 16
einen andern Durchschnitt nach der Linie CD; Fig. 17 einen
Grundriß; Fig.
18 einen Horizontaldurchschnitt nach der Linie E,
F und Fig.
19 einen Horizontaldurchschnitt nach der Linie GH dar. Der Cylinder a, Fig.
14, 15, 16 und 18 ist mit vier Hervorragungen b, b versehen,
mit deren Hülfe er in horizontaler Lage an die vier Säulen c,
c, c, c befestigt ist; d, d sind die Deckel der
Cylinderenden; e, e zwei mit Hanf oder einem andern
geeigneten Material geliederte, in der Mitte dieser Deckel befindliche Stopfbüchsen,
in denen zwei Wellen f und g
wasserdicht gelagert sind. Das Innere des Cylinders ist durch vier longitudinale
Platten h, h, h, h und zwei Querplatten j, j in sechs getrennte Kammern k, l, m, n, o, p getheilt. Von diesen Kammern erstrecken sich k und l über die ganze Länge
des Cylinders, m, n, o und p, jedoch nur von den Enden der Cylinderdeckel bis zu den transversalen
Scheidewänden j, j in der Mitte des Cylinders. In den
vier zuletzt genannten Kammern arbeiten vier Kolben q, r, s,
t, von denen die beiden einander gegenüberliegenden q und r mit der Welle f, s und t aber mit der Welle g in einem Stücke gegossen sind. Die mit dem
Cylinderdeckel und den Scheidewänden in Berührung kommenden äußeren Ränder jedes
Kolbens, und eben so die inneren Ränder der horizontalen Theilungsplatten, da wo sie
mit den Kolbenwellen f und g
in Berührung kommen, besitzen eine wasserdichte Metallliederung.
An dem inneren Ende der Kolbenwelle f befindet sich eine
kreisrunde Hervorragung u, welche in eine entsprechende,
an der andern Kolbenwelle g befindliche Vertiefung paßt.
Durch diese Anordnung werden die beiden Wellen veranlaßt genau in derselben
Centrallinie zuzn arbeiten, obgleich sie in verschiedenen Richtungen oscilliren. An den
äußeren Enden der Wellen f und g sind Kurbelarme v und w befestigt, mit deren Hülfe die Bewegung den Kolben mitgetheilt wird.
Jeder der vier Kolben
ist mit einem aufwärts sich öffnenden Ventil x versehen.
Die beiden oberen horizontalen Theile der Scheidewände sind gleichfalls mit vier
Ventilen y, y und eben so die beiden unteren
Abtheilungen der Scheidewände mit vier Saugventilen z, z
versehen; alle diese Ventile öffnen sich aufwärts. Die unterste Kammer l der Pumpe steht mit der Saugröhre a' und die oberste Kammer k
mit der Steigröhre b' in Communication. Kolben und
Ventile wirken ganz auf dieselbe Weise wie bei der gewöhnlichen Druckpumpe, indem
jeder Kolben die Kammer, worin er arbeitet, beim jedesmaligen Steigen entleert. Da
aber die Bewegung den Kurbeln so mitgetheilt wird, daß ein Kolbenpaar sich rasch
bewegt, während das andere Paar seinen todten Punkt erreicht hat, so wird stets ein
Kolben im Steigen begriffen seyn, und somit ein gleichförmiger und ununterbrochener
Wasserstrom erzielt.
Die oberen Ventile y oder die unteren Ventile z können weggelassen werden, indem das gleichzeitige
Vorhandenseyn beider nicht wesentlich nothwendig ist. Die Saugröhre a' der Pumpe ist so eingerichtet, daß sie mit irgend
einer Anzahl von Röhren, die aus verschiedenen Richtungen, z.B. von verschiedenen
Theilen eines Schiffs oder einer Fabrik herkommen, in Verbindung gesetzt werden
kann. p' ist eine Vereinigungsschraube; q' ein kurzes Röhrenstück; r
ein Sförmiges an den Theil q' gelöthetes Stück, dessen unteres Ende an ein in einer Platte s' befindliches Loch befestigt ist. Die Platte s' dreht sich auf dem oberen Theile einer andern Platte
t', worin eine Anzahl Löcher u', u', u', u' ringsherum angeordnet ist. Von der Mitte der Platte t' geht ein Stift V durch
die obere Platte s' und ist oben mit einer Mutter w' versehen, welche die beiden Platten zusammenhält. x' ist eine Handhabe, mit deren Hülfe die Mutter gedreht
und beide Platten angezogen oder locker gemacht werden können. Der Rand der Platte
s' ist mit Zähnen y', y'
versehen, in die ein kleines Getriebe z' greift, welches
auf einer mit Kurbel b'' versehenen Achse a'' festgekeilt ist. Die untere Platte t' ist fest; durch Umdrehung der Kurbel b'' kann man daher die obere Platte s' in Rotation setzen; diese nimmt die Röhre r' mit, bis letztere über dasjenige Loch in der unteren
Platte kommt, welches mit der Quelle oder dem Orte in Verbindung steht, aus dem das
Wasser gehoben werden soll.
m, n ist ein auf den vier Säulen c ruhendes Gestell. c', c', Fig. 14, 15 und 17, sind zwei an den
Kränzen zweier Schwungräder d', d' befestigte Handhaben
oder Kurbelgriffe. Die Schwungräder sind an den Enden einer Welle e' befestigt, welche in Lagern f', f' rotirt und ohne alle Hälse ist, so daß sie sich seitwärts in ihren
Lagern verschieben läßt und auf diese Weise gestattet, zwei auf ihr befestigte Getriebe g, g von verschiedenen Durchmessern mit einem oder dem
andern der an einer zweiten Welle j' befindlichen Räder
h', h' in Eingriff zu bringen. Befindet sich die
Welle e' in der geeigneten Lage, so wird einer der
beiden Sperrkegel k', k' zwischen das im Eingriff
befindliche Getriebe und das Lager f' gebracht, so daß
nun die Welle aus dieser Lage nicht weichen kann. Die Welle j' rotirt in Lagern l', l', und an den beiden
Enden derselben sind rechtwinkelig gegen einander zwei Kurbeln n', n' befestigt, welche zwei Verbindungsstangen o', o' in Bewegung setzen, deren untere Enden mit den
beiden Kurbelarmen v und w
der beiden Kolbenwellen f und g verbunden sind. Je nachdem nun das kleinere oder das größere Getriebe
sich im Eingriff befindet, arbeitet die Pumpe schnell und mit geringem Drucke, oder
langsam und mit starkem Drucke – ein Umstand, welcher diese Pumpe zur
Anwendung als Feuerspritze sehr geeignet macht.
Tafeln