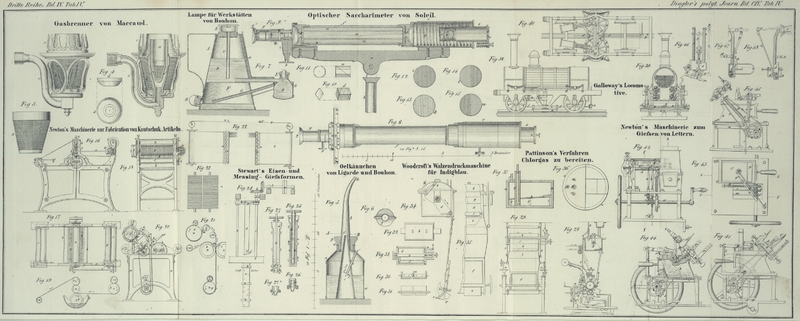| Titel: | Beschreibung eines Oelkännchens zum Schmieren der Maschinen; erfunden von den HHrn. Ligarde und Bouhon. |
| Fundstelle: | Band 104, Jahrgang 1847, Nr. LI., S. 243 |
| Download: | XML |
LI.
Beschreibung eines Oelkännchens zum Schmieren der
Maschinen; erfunden von den HHrn. Ligarde und Bouhon.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement, Febr. 1847, S. 79.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Ligarde's und Bouhon's Oelkännchen zum Schmieren der
Maschinen.
Die jetzt gebräuchlichen Oelkännchen haben bekanntlich mehrere Fehler:
1) wegen ihrer unbequemen Form ist es schwer sie in alle Theile der Maschinen
einzuführen;
2) der Arbeiter kann das Auslaufen der Flüssigkeit nicht nach Be lieben mäßigen; in
sehr vielen Fällen ist er genöthigt, um die erforderliche Menge Oel auf einen
Maschinentheil zu bringen, dasselbe im Ueberschuß auszugießen, welcher rein verloren
ist;
3) oft beschmutzt und beschmiert das Oel, welches ohne Nutzen durch die
Ausgießöffnung entweicht, die Maschinen, und so können auch bisweilen Stoffe, welche
mittelst derselben bearbeitet werden, Flecken erhalten;
4) wenn man aus Ungeschicklichkeit durch einen Stoß etc. das Oelkännchen umwirft,
geht das ausgelaufene Oel verloren und verursacht eine große Unreinlichkeit in den
Werkstätten und bei den Arbeitern;
5) macht man die Ausgießöffnung sehr eng, so läuft das Oel zu langsam aus, daher dem
vorher angegebenen Nachtheil nur auf eine sehr unvollkommene Weise abgeholfen
wird.
Das System der HHrn. Ligarde
und Bouhon zu Paris (place Dauphine, No. 7) hilft diesen Mängeln vollständig
ab.
Fig. 5 ist ein
senkrechter Durchschnitt des Kännchens, welches sie burette
inversable nennen. a ist der Körper des
Kännchens, oder die sogenannte Flasche (la bouteille); b
die Ausgießröhre. Man löthet in das Innere und auf den Boden des Kännchens eine
kegelförmige Kammer c, deren Spitze c' mit einem Loch von kleinem Durchmesser versehen ist.
Man gießt das Oel in die Flasche durch den Hals d,
nachdem man die Ausgießröhre abgeschraubt hat, welche mit einem Pfropf mit Schraube
und Ohren g versehen ist; dieser Pfropf ist in Fig. 6
besonders abgebildet und zwar auf der Linie AB der
Fig. 5.
Die kegelförmige Kammer ist so hoch, daß sich ihre Spitze über dem Spiegel der
Flüssigkeit befindet.
e ist eine kleine Röhre, welche die äußere Luft bei e' empfängt und dieselbe in die Kammer c durch ihr Ende e'' führt.
f ist ein Ansatzröhrchen, welches das Ende e'' der kleinen Röhre e
gegen jedes Auslaufen von Oel beschützt, so daß die Oeffnung e'' nicht durch solches verstopft werden kann.
Wenn man das mit Oel gefüllte Kännchen umstürzt, so läuft die Flüssigkeit, welche
durch ihr Gewicht mitgerissen wird, durch die Oeffnung h
aus, und die Luft, welche in die innere Kammer mittelst der Röhre e dringt, tritt in dem Maaße als das Oel ausläuft durch
die Spitze dieser Kammer aus und steigt an dem Boden der Flasche hinauf, das Oel
durchziehend. Verstopft man die Oeffnung e' mit dem
Finger, so hört das Auslaufen von Oel auf.
Es treten immer einige Tropfen Oel in die Kammer c; es
ist aber klar, daß die Flüssigkeit sich mit der Zeit in dieser Kammer weder
anhäufen, noch darin verweilen kann, denn beim Gebrauch des Kännchens muß das Oel
der Kammer unter dem Luftdruck zuerst auslaufen. Man begreift daher, daß in keinem
Falle das Oel in die Röhre e dringen kann.
Wird das mit Oel gefüllte Kännchen durch einen Stoß umgeworfen, so fällt es auf die
Seite und die Flüssigkeit kann sich nicht verbreiten; da nämlich in der horizontalen
Lage die Ausgießröhre und die Oeffnung c' der Luftkammer
im Niveau sind, so muß der Luftdruck auf die Flüssigkeit an den zwei Oeffnungen
gleichmäßig wirken.
Wir bemerken noch, daß wenn man eine etwas zu große Menge Oel auslaufen ließ, das
Kännchen am besten auf die Art wieder zurecht gerichtet wird, daß man die Oeffnung
des Schnabels in der Flüssigkeit eingetaucht läßt, wo dann in Folge des im Innern
der Flasche entstandenen Vacuums eine Absorption erfolgt.
Das neue Oelkännchen, dessen Construction eben so einfach als sinnreich ist,
entspricht allen Anforderungen in Bezug auf Bequemlichkeit, Reinlichkeit und
Wohlfeilheit, wurde auch bereits von mehreren ausgezeichneten Mechanikern und
Fabrikanten zu Paris in ihren Werkstätten eingeführt.
Silvestre, Berichterstatter.
Tafeln