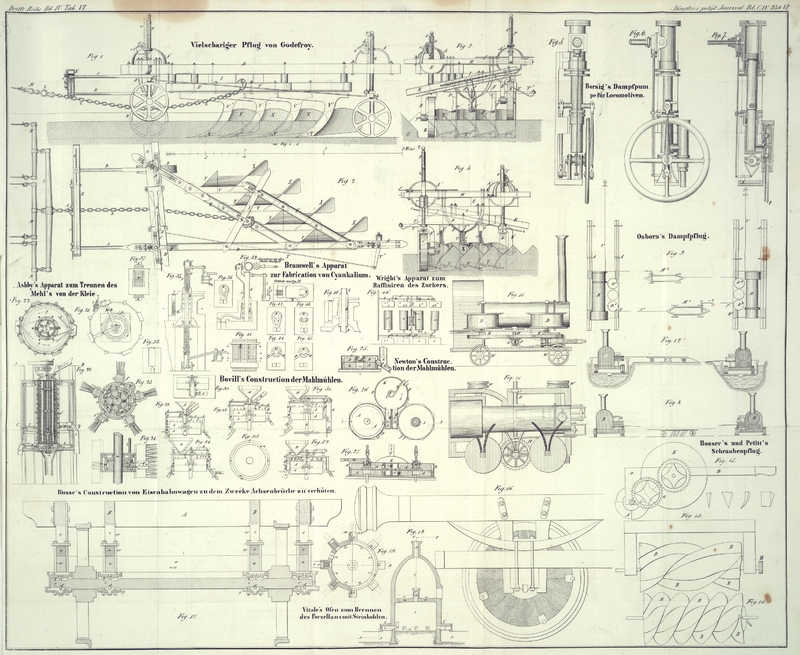| Titel: | Verbesserte Apparate und Oefen um mittelst des Stickstoffs der atmosphärischen Luft Cyanverbindungen (Blutlaugensalz) zu erzeugen, worauf sich Thomas Bramwell, Chemiker zu Newcastle-upon-Tyne, am 8. Oct. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 104, Jahrgang 1847, Nr. XCVIII., S. 447 |
| Download: | XML |
XCVIII.
Verbesserte Apparate und Oefen um mittelst des
Stickstoffs der atmosphärischen Luft Cyanverbindungen (Blutlaugensalz) zu erzeugen,
worauf sich Thomas
Bramwell, Chemiker zu Newcastle-upon-Tyne, am 8. Oct. 1846 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai 1847,
S. 280.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Bramwell's Apparate um mittelst des Stickstoffs der atmosphärischen
Luft Cyanverbindungen zu erzeugen.
Bei der Fabrication von Cyankalium etc. mittelst des Stickstoffs der atmosphärischen
Luft, ließ man bisher die kalte, erhitzte oder verbrannte Luft eine lange Röhre aus
feuerbeständigem Thon hinabziehen, welche durch einen Ofen so stark als möglich
erhitzt wurde, nachdem man die Röhre zuvor mit alkalisirter (in Potaschelauge
getränkter und getrockneter) Holzkohle gefüllt hatte; die atmosphärische Luft trat
dabei nur an einer, höchstens zwei Oeffnungen in die Zersetzungsröhre ein. (Man vergleiche Newton's Patentbeschreibung im polytechn. Journal Bd. XCV S. 293.)
Ich habe bei Anwendung dieses Verfahrens mehrere Verbesserungen desselben
ausgemittelt. Ich lasse nämlich erstens die erhitzte oder verbrannte Luft aus einem
Ofen in die Zersetzungsröhre mittelst zahlreicher in derselben angebrachten langen
und engen Oeffnungen oder Schlitze eintreten. Diese Einrichtung gewährt zweierlei
Vortheile. Sie verhindert die alkalisirte Kohle zu einer Masse zusammenzufließen,
was sehr leicht geschieht, wenn die Luft nur an einer oder zwei Oeffnungen eintritt;
wenn sich diese Oeffnungen über eine beträchtliche Länge der Zersetzungsröhre
erstrecken, entsteht überdieß eine viel größere Säule von erhitzter Kohle, als man
bisher erzielte. Auch habe ich gefunden, daß es sehr vortheilhaft ist, wenn man die
lange Säule stark erhitzter Kohle, durch welche man die Luft streichen läßt, frei
und offen erhält, damit die heiße Luft durch jeden Theil circuliren kann; um die
Schlitze offen zu erhalten, muß man in dem äußeren Mauerwerk Räume frei lassen,
durch welche man eine Stechstange einführen kann, wobei man diese Räume mit Lehm
verstopft und nur von Zeit zu Zeit öffnet.
Meine zweite Verbesserung besteht darin, daß ich die Luft durch die Zersetzungsröhre
aufwärts ziehen lasse, statt abwärts wie es bisher geschah; man kann dann die Kohle
naß (so wie sie aus der alkalischen Auflösung genommen wird) ohne vorläufiges
Trocknen in die Röhre bringen. Die heiße Luft, welche von unten in der verlängerten
Röhre aufsteigt, trocknet zuerst die Kohle aus und bringt dieselbe dann zur vollen
Rothglühhitze, ehe diese Kohle in den stark erhitzten zersetzenden Theil der Röhre
gelangt.
Die dritte Verbesserung bezieht sich auf den Ofen zum Erhitzen des erwähnten
Apparats. Ich habe gefunden daß die größte Hitze in einem Ofen dann entsteht, wenn
das Verbrennungsproduct Kohlensäure und nicht Kohlenoxyd ist. Um dieses Resultat für
das Erhitzen der Zersetzungsröhre zu erzielen, muß man so wenig Luft zulassen, als
bei einem schnellen Zug die Verbrennung unterhalten kann. Mein Ofen hat keine
Roststangen, sondern bloß am Boden einen engen Schlitz, welcher 2 Zoll weit und 12
bis 14 Zoll lang ist; derselbe ist hinreichend, damit die Schlacken ausfließen und
zugleich Luft genug einziehen kann, welche man nicht durch die ganze Masse des über
dem Schlitz befindlichen Brennmaterials streichen läßt. Man leitet nämlich mittelst
eines Fuchses den Zug nach der Zersetzungsröhre ab, nachdem die Luft bloß 3 bis 4
Zoll in dem Brennmaterial aufgestiegen ist; so wird die Verbrennung gänzlich in dieser schmalen
Schicht concentrirt. Ueber dem erwähnten Seitencanal errichtet man eine Kammer für
vorräthiges Brennmaterial; die Kohks oder Steinkohlen in dieser Kammer werden
niemals glühend.
Fig. 35 zeigt
einen nach meiner Erfindung construirten Ofen und Apparat im senkrechten
Durchschnitt. A ist eine gußeiserne Röhre, welche über
der thönernen Zersetzungsröhre angebracht ist und die nasse Kohle aufzunehmen hat.
Die heiße Luft, welche von der Zersetzungsröhre B, B aus
durch die Kohle hinaufzieht, trocknet dieselbe vollständig und erhitzt sie auch
genügend, bevor sie in den zersetzenden Theil der Röhre heruntersinkt, welcher aus
feuerbeständigen Ziegeln mit zahlreichen in den Fugen gelassenen Zwischenräumen oder
kleinen runden Löchern hergestellt ist. Ein Kamin zieht denjenigen Theil der
Producte des Ofens ab, welche nicht in die zersetzende Röhre streichen. Oben ist die
Röhre A durch einen Deckel c
mit hydraulischem Verschluß luftdicht gemacht; diesen nimmt man weg, wenn man eine
Beschickung in den Ofen bringt oder wenn man eine eiserne Stechstange hinabsenken
will, was von Zeit zu Zeit geschehen muß, damit sich im Inhalt der Röhre keine
leeren Zwischenräume bilden können.
Fig. 36 ist
ein Durchschnitt von Fig. 35 bei 1,1.
Fig. 37 ist
eine äußere Ansicht der Zersetzungsröhre.
Fig. 38 ist
ein Querdurchschnitt meines Heizofens; derselbe hat keine Roststangen, sondern bloß
am Boden einen Schlitz von beiläufig 2 Zoll Breite und 12 bis 14 Zoll Länge, je nach
seiner Größe. Sobald die Luft in die eigentliche Brennmaterial-Schicht
dringt, zieht sie durch den Seitencanal R ab, so daß die
Luft im Ofen nur durch eine sehr dünne Schicht des Brennmaterials streichen kann.
Das verzehrte Brennmaterial wird durch das darüber befindliche ersetzt. Bei dieser
Anordnung findet einerseits ein guter Zug statt und andererseits entsteht bloß
Kohlensäure, folglich die möglich höchste Temperatur durch das verzehrte
Brennmaterial. D, Fig. 35, ist der untere
Theil der Röhre, in welchen man das entstandene Product aus ihrem zersetzenden Theil
B durch Drehen der Klappe E herabsinken läßt; dasselbe fällt dann in das Gefäß F, welches Wasser enthält und wird aus diesem von Zeit
zu Zeit zur weiteren Behandlung entfernt. Die Luft muß beständig durch einen
geeigneten sowohl mit der Röhre G als mit der Röhre H communicirenden Apparat ausgepumpt werden; die Röhren
I und J tauchen in
Wasser oder eine Auflösung von Alkali, um ammoniakalische oder flüchtige Producte,
welche aus der Zersetzungsröhre abziehen, zurückzuhalten; das Wasser in den Gefäßen K, L wird von Zeit zu Zeit gewechselt und je nach seiner
Beschaffenheit verwendet.
Fig. 39 ist
der senkrechte Durchschnitt eines andern Apparats, bei welchem die Röhre nicht über
den zersetzenden Theil hinab verlängert ist, sondern das erzeugte Product in einen
Flammofen gelangt, worin man es (wie das gewöhnliche Gemenge mit thierischen
Substanzen) zu einer Masse schmilzt und von Zeit zu Zeit abzieht. Statt des bei Fig. 35
beschriebenen Ofens wird hier ein Flammofen angewandt, aus welchem die erhitzten
Gase in einen die zersetzende Röhre B umgebenden Canal
streichen; sie dringen dann zum Theil durch die zahlreichen Oeffnungen in die Röhre
B, während der Rest in einen Kamin entweicht. Die
Zersetzungsröhre ist von derjenigen in Fig. 35 nur dadurch
verschieden, daß statt der zahlreichen kleinen Löcher in ihr viele enge und lange
Schlitze angebracht sind.
Fig. 40 zeigt
einen senkrechten Durchschnitt eines Zersetzungsofens mit einem ähnlichen Heizofen
wie in Fig.
39. Die Zersetzungsröhre ist mit zahlreichen langen Schlitzen versehen,
wie die äußere Ansicht derselben Fig. 41 zeigt.
Fig. 42 bis
45 sind
horizontale Durchschnitte durch Fig. 41, und zwar Fig. 42 auf
der Linie 1,1; Fig.
43 auf der Linie 2,2; Fig. 44 auf der Linie 3,3
und Fig. 45
auf der Linie 4,4. Durch das äußere Mauerwerk gehen Oeffnungen N, N, damit man zu den Schlitzen gelangen und dieselben
mittelst einer Stechstange reinigen kann, worauf man die Oeffnungen wieder lutirt.
In anderer Hinsicht ist der Apparat wie der in Fig. 35 construirt.
In Fig. 39 ist
eine Zweigröhre o angebracht, um die Röhre A mit der nassen Kohle beschicken zu können; diese
Einrichtung ist deßhalb getroffen, damit der Zug durch die Röhre B nicht unterbrochen wird, wenn der Deckel c weggenommen ist.
Tafeln