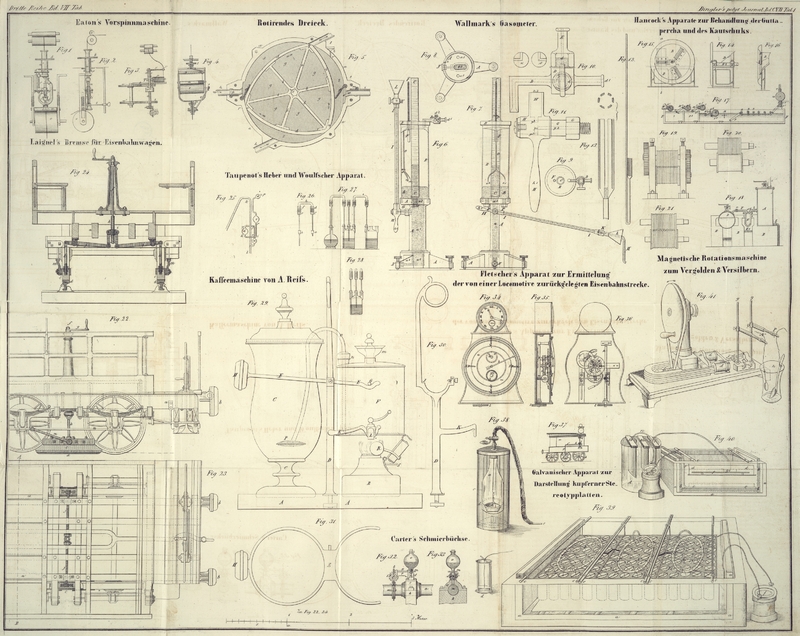| Titel: | Neue Kaffeemaschine von A. Reiß in Wien. |
| Autor: | A. Reiß |
| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. VIII., S. 32 |
| Download: | XML |
VIII.
Neue Kaffeemaschine von A.
Reiß in Wien.
Mit Abbildungen auf Tab. I.
Neue Kaffeemaschine.
Die in Nachfolgendem beschriebene neue
Patent-Kaffeemaschine von A. Reiß in Wien zeichnet sich nicht bloß durch ein
elegantes Aeußere aus, sondern liefert auch einen vorzüglichen
Kaffeeabsud, und bietet demjenigen, welcher sich in seinem
Zimmer den Morgentrank selbst bereitet, überdieß eine
interessante physikalische Spielerei dar. Eine solche kann man
das Bereiten des Kaffees in dieser neuen Maschine deßhalb
nennen, weil im Verlauf derselben drei physikalische Experimente
durchgeführt werden. Außerdem ist an der Weingeistlampe noch
eine kleine mechanische Vorrichtung angebracht, welche
selbstthätig die Flamme in dem geeigneten Augenblick, d.h. dann
wenn der Wasserkessel sich entleert hat, auslöscht, so daß der
leere Kessel nie erwärmt werden kann, also vor dem Schmelzen
geschützt ist, auch wenn derselbe weich gelöthet seyn
sollte.
Das Princip der neuen Kaffeemaschine ist folgendes: wird in einem
hermetisch verschlossenen Gefäß Wasser erhitzt, so nehmen die
sich bildenden Dämpfe eine größere Spannung an als dem Druck
einer Atmosphäre entspricht, und können folglich das Wasser aus
dem Gefäß austreiben, wenn eine Röhre durch den Deckel des
Gefäßes und beinahe bis auf den Boden desselben geht. Das durch
die Röhre ausströmende Wasser hat eine höhere Temperatur, als
beim gewöhnlichen Kochen im offenen Gefäße. Dieses sehr heiße
Wasser ergießt sich in ein Glas, welches neben dem Wasserkessel
steht, und in das vorher die gemahlenen Kaffeebohnen geschüttet
wurden. Die Röhre, welche das Wasser aus dem Kessel in das Glas
führt, reicht auch in dem Glase beinahe bis an den Boden hinab,
und ist an ihrem im Glase befindlichen Ende mit einem sehr
feinen Seiher versehen. Hat sich der Kessel entleert, und
befindet sich also das Wasser im danebenstehenden Glase, so
erlischt die Flamme unter dem Kessel, und derselbe kühlt sich
allmählich ab. Dadurch condensiren sich die
zurückgebliebenen Dämpfe, und deren Spannung wird geringer als
der Druck der äußeren Luft, welche nun durch die nämliche Röhre
den fertigen Kaffeeaufguß wieder in den Wasserkessel
zurücktreibt, aus welchem derselbe durch Oeffnen eines kleinen
Hahns abgezogen werden kann.
Fig. 29 ist eine Ansicht der vollständigen
Kaffeemaschine, wobei der Wasserkessel als gefüllt angenommen
ist;
Fig. 30 eine Ansicht des Griffs, welcher zum
bequemeren Tragen der Maschine dient, und einem Hebel, der
später erwähnt werden soll, den Stützpunkt abgibt.
Fig. 31 ist eine horizontale Ansicht des Hebels, in
welchem der Wasserkessel hängt.
In allen Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben denselben
Gegenstand.
A ist ein Brettchen mit zwei
Vertiefungen, welche das Verrücken der Weingeistlampe B und des Glases C verhüten. In der Mitte des
Brettchens ist der Träger oder Griff D mittelst einer Mutter festgeschraubt. Ungefähr auf
seiner halben Höhe theilt sich der Träger D, so daß dadurch zwei Arme gebildet werden, Fig. 30, zwischen welchen der Hebel E wie ein Wagbalken oscilliren kann.
Der eine Arm dieses Hebels bildet eine offene Gabel, zwischen
welcher der cylindrische Wasserkessel F Platz hat. An letzterem ist auf beiden Seiten ein
vorstehender Stift G angebracht,
welcher sich in die Vertiefung an dem Ende des Hebels E einlegt, so daß der Wasserkessel
schwebend über der Weingeistlampe erhalten wird. Der andere
Hebelarm ist durch einen Ring gebildet, welcher weit genug ist
um das Glas C bei der Bewegung nicht
zu berühren. Ein Gewicht H, welches
an den zweiten Hebelarm angeschraubt ist, hebt den Wasserkessel,
so bald er leer ist, in die Höhe. Der Hebel E nimmt in diesem Fall eine schiefe
Lage an, welche der in der Zeichnung angegebenen entgegengesetzt
ist. Durch die Ansätze J an dem
Träger D ist der Hebel verhindert
eine zu große Schwingung zu machen. Mit dem Träger D aus einem Stück ist ein gebogener
Arm K, dessen Ende den Hahn L umfaßt, wodurch ein Schwanken des
Kessels F verhütet wird. Außerdem
ruht der Kessel, wenn er gefüllt ist, mittelst des Hahns L auf diesem Arm auf.
Der mit concavem Boden versehene Kessel F hat oben eine trichterförmige Oeffnung M, durch welche er gefüllt wird.
Diese Oeffnung wird nach dem Füllen durch einen Kork gut
verschlossen.
Eine zweite auf dem Deckel des Kessels angebrachte Oeffnung N ist ebenfalls durch einen Kork
verschlossen, durch welchen jedoch eine heberförmig gebogene
Röhre O luftdicht geht. Diese Röhre
reicht nahezu bis an den Boden des Kessels, wo sie schräg
abgeschnitten ist, und ihr anderes Ende, welches in dem Glase
sich befindet, ist mit einem sehr feinen Seiher P versehen. Durch den Hahn L kann der Kessel entleert
werden.
Das Glas C ist mit einem gewöhnlichen
Deckel zugedeckt, in welchem sich ein Schlitz befindet, so daß
die Röhre O durch denselben gehen
kann.
Die Weingeistlampe B ist mit einem
Deckel versehen, welcher durch ein Scharnier mit derselben
verbunden ist. Quer über den Deckel ist ein Draht befestigt,
dessen frei stehende Enden abwärts gebogen, und mit
kugelförmigen Gewichtchen R versehen
sind, welche den Deckel jedesmal schließen, wenn derselbe nicht
durch irgendeinen Widerstand daran gehindert wird. S ist ein an der Lampe B befestigter Stift, welcher das
vollständige Zurückschlagen des Deckels verhütet.
Ist der Wasserkessel gefüllt, so nimmt er die in der Zeichnung
angegebene Lage ein, weil er in diesem Fall schwerer als das
Gegengewicht H ist. Der vorher
geöffnete Deckel der Weingeistlampe liegt an dem Boden des
Kessels an, und kann nicht eher zufallen, als nachdem sich der
Kessel F so weit erhob, daß er mit
dem Deckel der Lampe nicht mehr in Berührung ist. Die Lampe wird
also so lange fortbrennen, bis die sich bildenden Dämpfe das
Wasser aus dem Kessel in das Glas C
hinübergedrückt haben. Das Gewicht H
bekommt alsdann das Uebergewicht, hebt den leeren Kessel, und
die Lampe erlischt.
Sobald der Kessel nun anfängt sich abzukühlen, geht der fertige
Kaffeeaufguß wieder in den Kessel (wenn sich nämlich gepulverte
Kaffeebohnen in dem Glase befanden) über, weil die darin
enthaltenen Dämpfe dem Luftdruck im Glase nicht mehr das
Gleichgewicht halten können. Von der Feinheit des Seihers P hängt natürlich auch die Klarheit
des Kaffees ab. Befindet sich der fertige Kaffee wieder in dem
Kessel F, so nimmt letzterer wieder
die in der Zeichnung angegebene Lage ein, so daß beim Oeffnen
des Hahns der Kessel nicht schwanken kann. Ist derselbe geleert,
so ist auch dieß äußerlich sichtbar, weil ihn dann das Gewicht
H in der Höhe erhält.
Tafeln