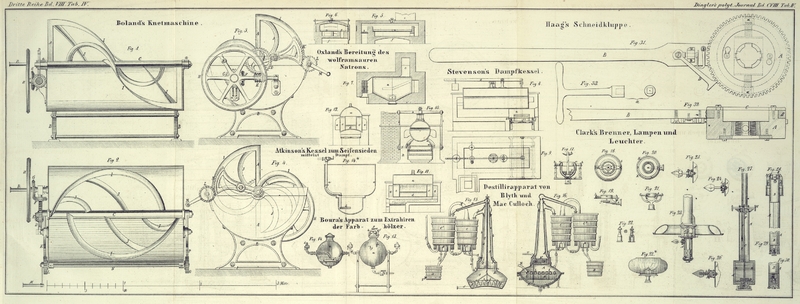| Titel: | Bereitung des wolframsauren Natrons und Anwendung desselben statt der Zinnpräparate als Beizmittel in der Wollenfärberei; von Robert Oxland, Chemiker in Plymouth. |
| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. XXXIX., S. 187 |
| Download: | XML |
XXXIX.
Bereitung des wolframsauren Natrons und Anwendung
desselben statt der Zinnpräparate als Beizmittel in der Wollenfärberei; von Robert Oxland, Chemiker in
Plymouth.
Aus dem London Journal of arts, April 1848, S.
192.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Oxland, über die Bereitung des wolframsauren Natrons und Anwendung
desselben als Beizmittel in der Wollenfärberei.
Das wolframsaure (scheelsaure) Natron kann (nach der Patentbeschreibung des Erfinders
vom 2. Sept. 1847) statt der verschiedenen Zinnpräparate in der Wollenfärberei als
Beizmittel entweder für sich allein oder in Verbindung mit Säuren angewandt werden;
in letzterm Falle löst man es vorher in einer mehr als hinreichenden Menge Wasser (1
Loth wolframsaures Natron in 1 1/4 Pfd. Wasser) auf und setzt dann Säure zu bis
alles Alkali gesättigt und noch etwas überschüssige Säure vorhanden ist.Die Wolframsäure, aus einem wolframsauren Salze mit Säuren abgeschieden, ist
ein citronengelbes zartes Pulver, welches im Wasser unauflöslich ist.A. d. R. Um Wolle zu färben, kocht man sie zuerst in einer Auflösung welche auf
angegebene Art mit Salpetersalzsäure bereitet ist und hierauf in der Färbeflotte;
oder die Auflösung kann auch mit der Flotte vermischt und das Tuch darin gekocht
werden, ohne alle andere Vorbereitung als das gewöhnliche Reinigungsverfahren; mit
Blauholz erhält man bei dieser Behandlung eine violette Farbe, welche bei
fortgesetztem Kochen in Schwarz übergeht.
Zur Bereitung des wolframsauren Natrons benutzt der Patentträger das Wolfram (das im
Mineralreich vorkommende wolframsaure Eisen- und Manganoxydul); wo man
Tungstein (wolframsauren Kalk) haben kann, verwendet man ihn statt des Wolframs und
behandelt ihn auf dieselbe Art. Das Wolfram kommt theils allein, theils in
Gesellschaft von ZinnerzenDas Wolfram findet sich ziemlich häufig auf Zinnerzlagerstätten im
Erzgebirge, auf Gängen im Grauwackengebirg zu Straßberg und Neudorf am Harz
etc.A. d. R. vor. Wenn man die Zinnerze anwendet, wird das Erz auf gewöhnliche Weise
vorbereitet bis es zum Schmelzen hergerichtet ist; nachdem dann das Erz getrocknet
worden ist, vermengt man es mit soviel calcinirter Soda als dem Wolfram äquivalent
ist, welches das Erz beigemengt enthält: angenommen z.B. das Erz enthalte 20 Proc.
Wolfram, so sind in 100 Theilen desselben 15 Theile Wolframsäure, für welche 3 1/2
Theile kohlensaures Natron das chemische Aequivalent bilden; benutzt man daher eine
käufliche Soda welche 50 Proc. Alkali enthält, so sind von derselben 7 Theile
erforderlich. Mit dem Gemenge von Erz und Soda wird der unten beschriebene Ofen
beschickt. Man kann statt der Soda auch 8 Theile feinpulverisirtes Glaubersalz, mit
dem vierten Theil seines Gewichts Kohlenpulver vermengt, anwenden; die Beschickung
im Ofen muß dann aber längere Zeit der Hitze ausgesetzt werden, nämlich bis gar
keine Verbrennung mehr sichtbar ist.
Die aus dem Ofen gezogene Beschickung besteht aus dem ursprünglichen Zinnoxyd, dem
auflöslichen wolframsauren Natron, ferner Eisen- und Manganoxyd nebst etwas
Kieselerde. Das wolframsaure Salz wird daraus auf folgende Weise durch Auslaugen
gezogen: Man stellt drei hölzerne Kufen von etwa 5 Fuß Höhe und 3 Fuß Weite neben
einander; unter jeder ist ein Gefäß von dem dritten Theil ihres Inhalts, welches die
aus dem Zapfenloch in der Seite jeder Kufe auslaufende Flüssigkeit aufnimmt; in
jeder Kufe ist ferner vor dem Zapfenloch ein Filter angebracht, aus etwas Stroh oder
Werg bestehend, über welche man ein mit Löchern versehenes Metallblech legt und
durch einige reine Steine niederhält. Die erste Kufe wird zum Theil mit Wasser
gefüllt und dann werden die Beschickungen aus dem Ofen in erkaltetem Zustande
hineingebracht, bis die Kufe nahezu voll ist; man füllt dieselbe dann ganz mit
Wasser und läßt sie etwa eine halbe Stunde lang stehen; hierauf wird der Zapfen
theilweise gezogen, damit die klare Auflösung von wolframsaurem Natron in das unten
befindliche Gefäß abläuft; aus letzterm kommt sie in Pfannen, worin man sie bis zur
Bildung einer Salzhaut abdampft, worauf man sie in Kühlgefäßen krystallisiren läßt.
Die erste Kufe, aus welcher Flüssigkeit abgezapft wurde, wird mit frischem Wasser wieder
angefüllt; wenn die abgezogene Flüssigkeit in derselben nur noch 17°
Baumé zeigt, bringt man sie nicht mehr in die Abdampfpfannen, sondern
verwendet sie statt bloßen Wassers zum Auslaugen einer neuen Portion calcinirter
Masse in der zweiten Kufe; letztere hält man beständig mit der Flüssigkeit gefüllt
welche von der ersten abläuft, bis diese Flüssigkeit nur noch 1 1/2 bis 2°
Baumé zeigt; sobald die Flüssigkeit in dem Untersatz der zweiten Kufe nur
noch 17° Baumé zeigt, benutzt man sie auf angegebene Art zum Auslaugen
frischer calcinirter Masse in der dritten Kufe u.s.f.
Fig. 5 ist ein
Längendurchschnitt des Calcinirofens, Fig. 6 ein
Querdurchschnitt und Fig. 7 ein horizontaler Durchschnitt desselben. a ist eine Eisenplatte, in zwei Stücken gegossen, welche die Sohle des
Ofens bildet; sie ist 9 Fuß lang, am weitesten Theil 6 Fuß breit, und 1 Zoll dick;
die Flamme und erhitzten Gase von der Feuerstelle b
streichen über sie und circuliren dann unter ihr, ehe sie in den Schornstein c treten. Die Beschickung wird in den Ofen durch das
Loch d gebracht; abgezogen wird sie durch eine Oeffnung
in der Sohlenplatte (die man während des Calcinirens durch eine Eisenplatte e geschlossen erhält) in den darunter befindlichen
gewölbten Behälter f. Je nachdem das Erz grob oder fein
gemahlen ist, enthalten die Beschickungen 6 bis 10 Ctnr. desselben; wenn der Ofen
immer in der Rothglühhitze erhalten wird, kann man in 24 Stunden 8 Beschickungen
abziehen.
Der Patentträger gibt auch noch zwei Methoden an, um aus dem wolframsauren Natron
metallisches Wolfram zu gewinnen. Die erste besteht darin, das wolframsaure Natron
mit kalter Salzsäure zu digeriren, die erhaltene Auflösung zu beseitigen und den
Rückstand noch so oft mit Salzsäure zu behandeln, bis alles wolframsaure Natron
zersetzt ist; die zurückbleibende Wolframsäure wird mit kaltem Wasser ausgewaschen
und dann auf Ziegelsteinen getrocknet; um sie zu Metall zu reduciren, vermischt man
sie dann mit rohem Oel oder Theer oder feinem Kohlenpulver, bringt das Gemenge in
einen mit Kohle gefutterten Tiegel und setzt es etwa eine Stunde lang einer starken
Rothglühhitze aus. Die zweite Methode besteht darin, das wolframsaure Natron mit
feinem Kohlenpulver zu vermengen und das Gemenge in einem mit Kohle gefutterten
Tiegel etwa eine Stunde lang einer starken Rothglühhitze auszusehen; die
Wolframsäure wird dann zu Metall reducirt und das Natron welches mit ihr verbunden
war, in kohlensaures Natron verwandelt, welches man durch Auslaugen der Masse
gewinnt.
Tafeln