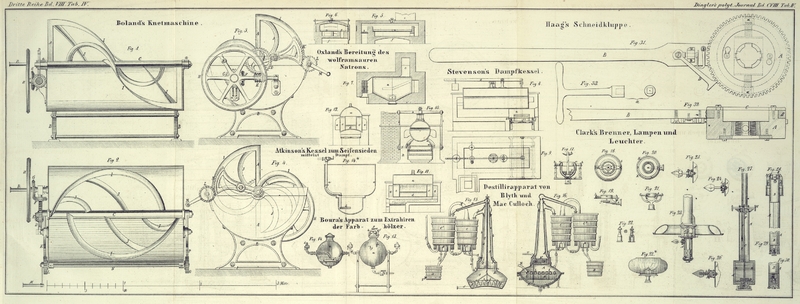| Titel: | Verbesserter Apparat zum Destilliren und Rectificiren, worauf sich Alfred Blyth und John Mac Culloch in London am 9. Sept. 1847 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. XL., S. 189 |
| Download: | XML |
XL.
Verbesserter Apparat zum Destilliren und
Rectificiren, worauf sich Alfred
Blyth und John Mac
Culloch in London am 9. Sept.
1847 ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem London Journal of arts, April 1848, S.
173.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Blyth's und Mac Culloch's Apparat zum Destilliren und
Rectificiren.
Das Destilliren und Rectificiren geschieht in einem einzigen Apparat und die
Operation geht ununterbrochen fort, von dem Zeitpunkt an wo der Apparat mit der zu
destillirenden Flüssigkeit beschickt wurde, bis dieselbe sowohl destillirt als
rectificirt ist, ohne daß hiebei viel mehr Handarbeit oder viel mehr Brennmaterial
erforderlich ist als gewöhnlich zum Destilliren allein.
Fig. 15 ist
ein senkrechter Durchschnitt dieses Apparats zum Destilliren und Rectificiren. A ist der untere Theil der Hauptblase, in welchen am
Anfang jeder Operation die Maische durch das Rohr und den Sperrhahn a eingelassen wird; der obere Theil b dieser Blase endigt sich in einen kugelförmigen Helm,
von welchem ein Schnabel c den Dampf in das
Schlangenrohr im Kühlfaß C leitet; in das Kühlfaß kommt
kaltes Wasser oder die Flüssigkeit womit die Blase am Anfang der nächsten Operation
beschickt werden soll. B, d ist die Rectificirblase; sie
ist im oberen Theil der Hauptblase so angebracht, daß zwischen den zwei Blasen
ringsherum ein enger Raum für den Durchzug des aufsteigenden Dampfs bleibt. Der
Dampf welcher von der Flüssigkeit in der Blase A
aufsteigt, erhitzt den Boden der Blase B, daher er dem
Inhalt derselben Wärme mittheilt; dabei verdichtet sich der wässerigste und
unreinste Theil des Dampfs und fällt in Tropfen von dem Boden der Blase B in die darunter befindliche Flüssigkeit; der
weingeisthaltigste und reinste Theil des Dampfs steigt hingegen zum kugelförmigen
Helm hinauf, gelangt aus dem Schnabel C in das erwähnte
Schlangenrohr und verdichtet sich darin; der verdichtete Spiritus läuft aus dem
Schlangenrohr in sehr warmem Zustande in das sogenannte Sammelbecken (safe) G und aus diesem durch
das Rohr g in den unteren Theil der Rectificirblase B, so daß dieselbe beständig mit dem zu rectificirenden
Spiritus beschickt erhalten wird. Die Wärme welche der Blase B, wie erwähnt, mitgetheilt wird, ist zwar nicht bedeutend, aber doch
hinreichend, um den geistigsten Theil der Flüssigkeit in dieser Blase in Dampf zu
verwandeln, welcher in einen kugelförmigen Helm am oberen Ende der Blase B aufsteigt und durch den Schnabel n in ein
Schlangenrohr im Faß C' (welches man mit kaltem Wasser
füllt) abzieht, worauf er als verdichteter Spiritus in ein anderes Sammelbecken H gelangt; aus diesem Becken kann der flüssige Spiritus
durch das Rohr p in ein anderes Schlangenrohr abziehen,
welches im Faß D mit kaltem Wasser umgeben ist; in
letzterem wird er so weit abgekühlt, daß er nach dem Ablaufen bei q sogleich auf gewöhnliche Art magazinirt werden
kann.
Wenn sich die Flüssigkeit in der Blase B hoch genug
angesammelt hat, läuft der Ueberfluß durch das Rohr K in
die Blase A ab; am unteren Theil der Blase ist ein (in
der Zeichnung nicht abgebildeter) Sperrhahn angebracht, damit man die Flüssigkeit
aus dieser Blase ganz oder theilweise in die Blase A
abziehen kann; ferner ist am untersten Theil der Blase A
ein weites Rohr S angebracht und mit einem Sperrhahn
versehen, um auch aus dieser Blase die Flüssigkeit abziehen zu können. Der untere
Theil der Blase A ist eingemauert und wird auf
gewöhnliche Art durch einen Ofen erhitzt.
Der Dampf welcher, wie erwähnt, in dem Raum zwischen den zwei Blasen aufsteigt, ist
der reinste und weingeisthaltigste Theil des aus der Flüssigkeit entweichenden
Dampfs; und da ein Theil von ihm auf den Flächen b, d zu
Tropfen verdichtet wird, so sind in geeigneter Lage zwei kreisförmige Rinnen r, s zum Sammeln desselben angebracht; die angesammelte
Flüssigkeit gelangt von der Rinne s durch das Rohr t in die Blase B hinab. Die
Flüssigkeit im Kühlfaß C wird allmählich warm, wo sie
dann spiritushaltige Dämpfe entbindet; damit von diesen nichts verloren geht, ist
das Faß C mit einem dicht passenden Deckel versehen, aus
welchem ein Rohr oder Schnabel Q sich bis zum
Schlangenrohr im Kühlfaß C' der Rectificirblase
erstreckt; oder dieses Rohr kann auch mit dem Rohr p
verbunden werden, welches aus dem Becken H in das Faß
D geht. Das Kühlfaß C'
kann man entweder mit kaltem Wasser beschicken oder mit der zu destillirenden
Flüssigkeit; in letzterm Fall muß die Flüssigkeit von Zeit zu Zeit durch das Rohr 8
abgezogen werden, um diejenige Flüssigkeit im Faß C
wieder zu ersetzen, welche aus demselben zum Beschicken der Blase A (mittelst des Rohrs a)
abgezogen wurde; das Kühlfaß C' wird mit Wasser oder der
zu destillirenden Flüssigkeit vermittelst des Rohrs 7 beschickt.
Sollen Flüssigkeiten destillirt werden welche Satzmehl etc. enthalten, so wenden die
Patentträger einen Rührer an, wie es gewöhnlich geschieht, damit sich diese
Substanzen nicht am Boden der Blase absetzen können; dieser Rührer besteht aus zwei
langen Armen 2, welche am unteren Ende einer senkrechten Welle 1 befestigt sind und
von denen die Ketten 3
herabhängen, welche also auf dem Boden der Blase A
herumschleifen, wenn man die Welle 1 in Umdrehung setzt.
Obgleich oben gesagt wurde, daß die Blase A durch einen
Ofen unter ihr erhitzt werden soll, so kann dieß doch auch durch Dampf geschehen,
welchen man zwischen dem Boden der Blase und einem Dampfgehäuse einleitet, wie es
bei x im senkrechten Durchschnitt, Fig. 16, zu sehen ist;
oder der Dampf kann in Röhren geleitet werden, welche innerhalb der Blase in deren
unterem Theil herumgewunden sind; oder man kann ein Dampfgehäuse außerhalb und
Röhren innerhalb zugleich benutzen.
Es ist nicht wesentlich, daß der obere Theil b der Blase
A den entsprechenden Theil d der Blase B in sich einschließt; die
Construction des in Fig. 15 abgebildeten Apparats kann daher ohne Abänderung seiner
Wirkungsweise folgendermaßen modificirt werden: Der Boden h der Blase B wird vergrößert, so daß er mit
der Blase A bei i bündig
ist; die aufrechten Seiten der Blase B werden nahe am
Boden h, sowie auch der obere Theil d ganz weggelassen, so daß diese Blase äußerlich bloß
durch den Boden h und die Seiten b begränzt ist und daher die obere Blase genannt werden kann. Der aus der
Flüssigkeit in der Blase A aufsteigende Dampf wirkt auf
den Boden h, und der wässerigste Antheil desselben
verdichtet sich, wie erwähnt, unter jenem Boden; der spiritusreichste Antheil
hingegen, anstatt rings um den oberen Theil d der Blase
B aufzusteigen, steigt durch ein weites Rohr auf
(durch punktirte Linien 9 angedeutet), welches im Centrum dieser Blase befestigt ist
und zieht von dem oberen Ende der Röhre 9 durch den Schnabel n in das Schlangenrohr des Kühlfasses C; der
andere Schnabel c muß mit dem Schlangenrohr in dem
Kühlfaß C' verbunden werden, so daß die Verbindungen der
zwei Schnäbel c und n mit
den zwei Schlangenröhren die umgekehrten von denen in Fig. 15 sind. In dem Rohr
9 kann man eine kreisförmige Rinne befestigen, um die Tropfen von verdichteter
Flüssigkeit zu sammeln und dieselben durch eine Röhre, ähnlich t, in die Blase B zu
führen.
Bei dieser Abänderung des Apparats kann man den inneren Raum der Blase B auch in zwei, drei oder mehr Fächer abtheilen, nämlich
durch senkrechte Scheidewände, welche von der Centrumröhre 9 nach den Seiten b ausgehen; jedes Fach dient dann als eine besondere
Rectificirblase, und in jedes kann man ein besonderes Ingrediens geben um dem
rectificirten Spiritus Aroma zu ertheilen.
Die Patentträger erleichtern auch das Destilliren und Rectificiren in dem
beschriebenen Apparat dadurch, daß sie in demselben ein System von Luftröhren mit zahlreichen
absteigenden Zweigröhren anbringen, durch welche ebensoviele dünne Luftströme in die
Flüssigkeit in der Hauptblase oder der Rectificirblase oder in beiden Blasen
hinabgedrückt werden können. Fig. 16 ist ein
senkrechter Durchschnitt des mit solchen Luftröhren versehenen Destillir- und
Rectificir-Apparats. K ist ein Luftrohr, um Luft
von einem Gebläse der Blase A zuzuführen; dieses Rohr
ist mit einem innerhalb der Blase A angebrachten System
horizontaler Luftröhren L verbunden, welches mit engen
Zweigröhren x versehen ist, die unter die Oberfläche der
Flüssigkeit hinabreichen; die Luft entweicht an den offenen Enden dieser Röhren x und verursacht bei ihrem Aufsteigen an die Oberfläche
eine Bewegung in der ganzen Flüssigkeit; durch diese ihre Vermischung mit der
Flüssigkeit befördert die Luft (sie mag heiß oder kalt seyn) sehr die Dampfbildung.
Diese Luft gelangt dann mit dem Dampf in das Schlangenrohr des Kühlfasses C, worin sich der Dampf verdichtet, während die Luft in
das Becken G zieht und aus letzterm durch ein Rohr
entweicht; damit aber der entweichenden Luft kein spiritushaltiger Dampf beigemengt
bleiben und folglich verloren gehen kann, thut man gut, die entweichende Luft
vermittelst des erwähnten Rohrs aus dem Becken G noch in
eine andere Schlange zu leiten, um solchen Dampf zu verdichten ehe die Luft in die
Atmosphäre entweicht. Auf ähnliche Weise wird dieses System auch bei der Blase B angewandt, wie Fig. 16 zeigt, worin U das von dem Gebläse ausgehende Rohr bezeichnet, V die Röhren innerhalb der Blase und y die absteigenden Zweigröhren.
Diese Anwendungsweise von Luft ist ein sehr gutes Mittel, um die Dampfbildung solcher
Flüssigkeiten zu befördern, welche, wie z.B. gegohrene Würze und Melasse, durch
fremdartige Substanzen verdickt und daher nicht ganz klar sind; auch ist sie für
unreines Steinkohlenöl oder Terpenthinöl zu empfehlen.
Tafeln