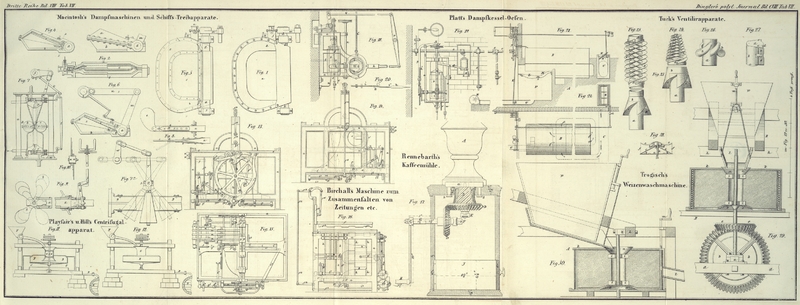| Titel: | Verbesserungen an Dampfkesselöfen, worauf sich John Platt, Maschinenfabrikant zu Oldham in Lancashire, am 11. Jan. 1847 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 108, Jahrgang 1848, Nr. LXXXV., S. 404 |
| Download: | XML |
LXXXV.
Verbesserungen an Dampfkesselöfen, worauf sich
John Platt,
Maschinenfabrikant zu Oldham in Lancashire, am 11.
Jan. 1847 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts, Mai 1848, S.
237.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Platt's Verbesserungen an Dampfkesselöfen.
Den Gegenstand der Erfindung bildet:
1) die Anbringung eines Ventils oder Dämpfers, welcher in geeigneten Intervallen Luft
in den Hauptcanal zwischen dem Ofen und dem Schornstein zuläßt, so daß der Hauptzug
durch den Ofen gehemmt wird; dieser Dämpfer wird durch die Wirkung des mit dem
Dampfkessel in Verbindung stehenden Dampfvisirs (steam-gauge) geöffnet oder geschlossen;
2) die Zulassung eines durch das erwähnte Visir zu regulirenden Luftstroms in den
Aschenfall;
3) die Schließung und Oeffnung des Speisungsapparates durch das Dampfvisir;
4) eine solche Form und Anordnung der Roststäbe, daß an dem der Brücke zunächst
liegenden Ende des Ofens eine Rothgluth entsteht, wodurch der vom frischen
Brennmaterial darüber streichende Rauch verzehrt wird.
Fig. 18
stellt den Apparat in Anwendung auf einen gewöhnlichen Cylinderdampfkessel im
Seitenaufrisse und Fig. 19 in der Frontansicht dar. a, a ist das
Gestell, welches das cylindrische Gehäuse b, b des
Dampfvisirs trägt; c, c ein innerer an seinem oberen
Ende geschlossener Cylinder, welcher durch den Hebel und das Gewicht d, d äquilibrirt ist. Der Raum zwischen beiden Cylindern
ist durch Wasser oder eine andere geeignete Flüssigkeit abgesperrt. Durch die Röhre
e strömt der Dampf aus dem Dampfkessel in das Innere
des Cylinders c, c. Jede Veränderung des Dampfdruckes
wird nun machen, daß der eben in der Schwebe gehaltene Cylinder steigt oder sinkt
und durch Vermittlung der senkrechten Stange f und des
gebogenen Hebels g die Stellung der Excentricumstange
h ein wenig verändert. Der Kranz i, i* des Excentricums k
ist, wie auch der Durchschnitt Fig. 20 zeigt, so
eingerichtet, daß immer nur eine Kante desselben mit dem Excentricum in Berührung
ist. Das Excentricum wird durch das Rad l und dieses
durch die an der senkrechten Achse n befindliche Schraube
m in Umdrehung gesetzt. Die Achse n wird von dem Speisungsapparat aus durch einen Riemen
umgetrieben. Die Excentricumstange h hängt an einem Seil
h*, das an die Decke befestigt ist, und da sie durch
die Hebel und Stangen p, q, r mit der Welle o in Verbindung steht, so wird diese bei erfolgender
Rotation des Excentricums k einen Theil einer Umdrehung
machen und zwar nach der einen oder der andern Richtung, je nachdem die eine oder
die andere Seite des Kranzes i, i* mit dem Excentricum
in Berührung ist. Dadurch wird auch der Hebel s, welcher
vermittelst der Stange t mit der Klappe des Feuercanals
verbunden ist, die letztere öffnen oder schließen.
Die Verbindung des Apparates mit dem Dampfkessel, dem Ofen und den Feuercanälen ist
aus Fig. 21
und 22 zu
entnehmen. Fig.
21 stellt einen cylindrischen Dampfkessel mit dem in Rede stehenden
Apparat im Längendurchschnitte, Fig. 22 im Grundrisse
dar. A ist das Mauerwerk, welches den Dampfkessel B trägt; C der nach dem
Schornstein führende Hauptcanal, welcher durch den senkrechten Canal D mit der Atmosphäre communicirt. Der Canal D wird durch eine Klappe E,
die vermittelst der Stangen und Hebel t mit der Schraube
s verbunden ist, geöffnet oder geschlossen. u, Fig. 18 und 19, ist eine
Röhre, welche das überflüssige Wasser vom Dampfvisir abführt; v eine Röhre, um zum Behuf der Reinigung Dampf durchzublasen. Wenn nun in
Folge gesteigerten Dampfdruckes der innere Cylinder c in
die Höhe geht, so bringt der Hebel g die Seite i* des Kranzes mit dem Excentricum k in Berührung; dadurch wird das Ventil E geöffnet, so daß der Zug des Schornsteins die Luft
durch den Canal D und auf diese Weise den Zug durch den
Ofen vermindert. Ist der Dampfdruck zu gering, so wird das Ventil E durch die Wirkung des Dampfvisirs geschlossen und der
zweite Theil der Erfindung tritt alsdann in Wirksamkeit. Der Aschenfall F ist geschlossen und mit einem Canal G versehen, der ihn mit dem Ventilator H verbindet. Der Canal G ist
mit einer Klappe I versehen, die in Folge der
Schwingungen der Welle o, mit der sie durch den Hebel
w und die Stange K
verbunden ist, geöffnet oder geschlossen wird. Die Schwingung der Welle o zieht ferner den Riemen, welcher den Speisungsapparat
treibt, vermittelst des Hebels x und der Gabel y nach der festen oder losen Rolle, wodurch die Speisung
in geeigneten Intervallen unterbrochen wird. z ist die
Treibwelle des Speisungsapparates mit der festen und losen Rolle 1 und 2. Fig. 22 zeigt
die eigenthümliche Gestalt und Anordnung der Roststäbe L
und M. Das Ende M ist erhöht, so daß an
diesem Ende stets eine hohe Gluth stattfindet, wodurch der von dem frisch
aufgegebenen Brennmaterial darüber hinwegstreichende Rauch consumirt wird.
Tafeln