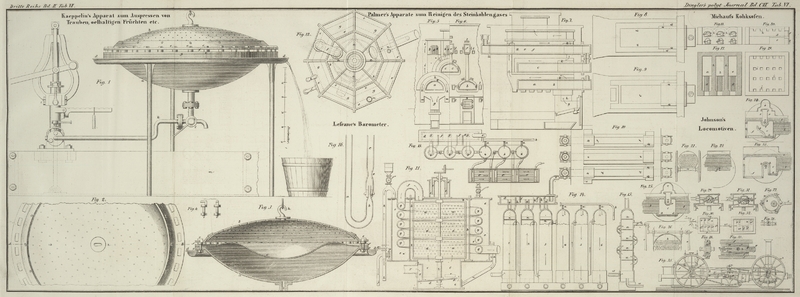| Titel: | Verbesserungen an Locomotiven, worauf sich William Beckett Johnson, Ingenieur in Manchester, am 12. Junius 1847 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. XCVI., S. 268 |
| Download: | XML |
XCVI.
Verbesserungen an Locomotiven, worauf sich
William Beckett Johnson,
Ingenieur in Manchester, am 12. Junius 1847 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts, April 1848, S.
158.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Johnson's Verbesserungen an Locomotiven.
Vorliegende Verbesserungen in der Construction der Locomotive bestehen
1) in der Anordnung der Treib- oder Kuppelachsen in solchen Lagen, daß eine
größere Stabilität der Wirkung erzielt wird;
2) in neuen mechanischen Anordnungen, um den Dampf mit Expansion wirken zu lassen und
die Bewegung der Maschine rückgängig zu machen;
3) in der Construction eines expansiblen Schiebers;
4) in der eigenthümlichen Construction der Locomotive und
5) in einer neuen im Falle der Gefahr anzuwendenden Signalvorrichtung, welche in einer durch die
Wirkung der Luft in Thätigkeit gesetzten Pfeife besteht.
Die Figuren 21
und 22
stellen eine Einrichtung zur Tieferlegung des Dampfkessels im Quer- und
Längendurchschnitte dar. Dieser Zweck wird dadurch erreicht, daß man die
erforderliche Anzahl der unteren horizontalen Röhrenreihen ausläßt und die
Treibachse a durch eine im unteren Theile des
Dampfkessels angebrachte Vertiefung b führt. Diese
Vertiefung befindet sich so nahe als möglich an der unteren Röhrenreihe.
Fig. 23 stellt
eine andere Anordnung zur Tieferlegung des Dampfkessels im Längendurchschnitte dar.
In diesem Falle ist der Feuerkasten mit einer hohlen Brücke b versehen, durch welche die Treibachse a
geht. Die Flamme streicht von dem Feuerkasten f über die
Brücke b in die Kammer c und
von da in die Röhren t. An dem Boden der Kammer c ist zur Bequemlichkeit der Reparatur und Reinigung der
Röhren eine Thür d angebracht.
Fig. 24 zeigt
eine andere Anordnung zum Tieferlegen des Dampfkessels. Hier wird der Zweck dadurch
erreicht, daß man in dem oberen Theil des Feuerkastens eine Vertiefung r anbringt. Diese Vertiefung tritt durch die Dampfkammer
s und dient zur Aufnahme der Treib- oder
Kuppelachse a. Die Flamme streicht aus dem Feuerraum
über die Brücke g und unter dem Theil r hinweg in die Kammer c und
von da in die Röhren t. Zur Bequemlichkeit der Reparatur
und Reinigung der Röhren ist der Boden der Kammer c mit
einer Thür d versehen. Ueber der Vertiefung r ist eine Kuppel o
angeordnet, um eine Verbindung zwischen den beiden Theilen der Dampfkammer
herzustellen.
Eine weitere Einrichtung zum Tieferlegen des Dampfkessels ist Fig. 25 im
Längendurchschnitte dargestellt. Zwischen den Röhren t,
t ist eine Kammer c
angeordnet, in deren oberem Theile eine umgekehrte Brücke r angebracht ist; durch diese Brücke geht die Treib- oder
Kuppelachse a. Die Hitze streicht aus dem Ofen durch die
erste Röhrenreihe in die Kammer, unter r hinweg und so
fort durch das zweite Röhrensystem in die Rauchkammer. Die Thüren d und die Kuppel o haben den
gleichen Zweck wie die gleichnamigen Theile in Fig. 24.
Fig. 26 stellt
einen verbesserten Mechanismus zum Betrieb der excentrischen Scheiben dar, welche
die Schiebventile oder Speisungspumpen in Thätigkeit setzen. s ist eine über den Kessel b sich erstreckende
Achse, an deren Enden zwei rechtwinkelig zu einander gestellte Kurbeln c, c befestigt sind. Diese
Kurbeln werden durch zwei Stangen r, r in Rotation gesetzt, welche mit ähnlichen an der
Treibachse der Maschine angebrachten Kurbeln in Verbindung stehen. Die Excentrica können an
der Achse s innerhalb oder außerhalb der Lager i, i angeordnet werden.
Diese Einrichtung hat den Vortheil, daß die Excentrica, da sie nicht an der
Treibachse festgekeilt sind, gestatten den Dampfkessel näher an die Treibachse zu
legen und ihm einen größeren Durchmesser zu geben; auch sind die Excentrica zum
Behuf der Reinigung und Reparatur leichter zugänglich; der Locomotivführer hat sie
beständig vor Augen und ihre Dauerhaftigkeit ist dadurch erhöht, daß sie dem von der
Bahn aufgeregten Staub nicht so unmittelbar ausgesetzt sind.
Fig. 27 stellt
ein verbessertes Excentricum in der Seitenansicht, Fig. 28 im Grundrisse
dar. s ist die Achse mit der excentrischen Scheibe b; r, r, r sind Frictionsrollen, welche in einer an
der Peripherie der Scheibe b angebrachten Rinne laufen.
Diese Rollen sind zwischen zwei Ringen a, a gelagert, an welche die gewöhnliche Excentricumstange
o befestigt ist. Die Vortheile dieses Excentricums
sind eine geringere Reibung, größere dem Ventil mitgetheilte Stetigkeit der
Bewegung, und geringere Reparaturkosten, indem nur die kleinen Lager der
Frictionsrollen der Abnützung ausgesetzt sind.
Die Figuren 29
und 30
stellen ein Expansions-Dampfventil im Längendurchschnitt und im Grundrisse
dar. v ist das gewöhnliche Schieberventil, welches auf
zwei flachen Platten oder Ventilen p, p1 läuft. Letztere
sind neben einander angeordnet und werden durch die Federn s, s in dichter Berührung exhalten. Die
Ventile p, p1 sind mit Oeffnungen o, o1
o, 2
o3 versehen, welche so
angeordnet sind, daß sie mit den an der unteren Fläche befindlichen Oeffnungen
übereinstimmen. Letztere sind so vertheilt, daß die beiden Canäle o, a mit dem einen Ende des
Cylinders h, und die beiden andern Canäle o,3
a1 mit dem andern Ende
des Cylinders g communiciren. e ist der Entleerungscanal. Es ist nun einleuchtend, daß, wenn die in den
Bereich des Locomotivführers führende Stange r in
Bewegung gesetzt wird, der um f drehbare Hebel l mit Hülfe der Stangen y,
y1 die beiden
Ventile p, p1 nach entgegengesetzten Richtungen in Bewegung
setzen wird. Auf diese Weise kann der Eintritt des Dampfs in den Cylinder durch die
Canäle o, o3 bis zu jedem Grade der Expansion regulirt und
durch Fortsetzung der Bewegung ganz abgesperrt werden. Wird die Bewegung
fortgesetzt, so daß die Platten oder Ventile in die entgegengesetzte Lage gelangen,
so gestatten die Oeffnungen o,1
o2 dem Dampf den Weg
durch die Canäle a, a1 und von da nach den entgegengesetzten Enden des
Cylinders, wodurch die Bewegung der Maschine rückgängig gemacht wird. Um also die
Maschine mit Expansion vor- oder rückwärts gehen zu lassen, und den Dampf abzuschneiden, bedarf
es nur der gehörigen Bewegung der Stange r. Die
Vortheile dieser Anordnung bestehen in der Einfachheit ihrer Construction, indem
jede Maschine nur eines einzigen Excentricums bedarf und die Vorrichtung zum Heben
der Excentricumstangen in und außer Eingriff, und ebenso das Drosselventil ganz
wegfällt. In Folge des einfachen Mechanismus zum Betrieb der Ventile vereinigt sich
die ganze Controle der Maschine rücksichtlich der beschriebenen Operationen in einer
einzigen Handhabe.
Die Figuren 31
und 32
stellen eine andere Methode, den Dampf mit Expansion wirken zu lassen, ihn
abzusperren und die Richtung seiner Wirkung umzukehren, im Längendurchschnitte und
Grundrisse dar. v ist das gewöhnliche auf einer festen
Platte f laufende Schieberventil. Die Platte f ist mit den gewöhnlichen Dampfcanälen s, s1 und dem Entleerungscanal e versehen. Die Canäle s, s1 und e sind in der Mitte durch eine metallene Rippe getheilt,
so daß sie die Bewegung eines flachen Ventils p
unterhalb der festen Fläche f gestatten. Das Ventil p besitzt gewisse Canäle oder Oeffnungen o, o,1
o,2
o3 (Fig. 32) und läuft auf
einer Fläche, in welcher die Canäle so vertheilt sind, daß die Canäle o, a nach dem einen Ende und
die Canäle a1, a2 nach dem
entgegengesetzten Ende des Cylinders g führen. Wenn
daher die Stange r1
nach der Richtung des Pfeils bewegt wird, so kann der Eintritt des Dampfs in die
nach den Enden des Cylinders h, g führenden Canäle o, o2 bis zu jedem beliebigen Grad der
Expansion regulirt werden, und wenn man die Bewegung fortsetzt, so daß das Ventil
p in die Mitte der Ventilbüchse kommt, so wird der
Dampf dadurch ganz abgesperrt; bewegt man endlich das Ventil bis an das
entgegengesetzte Ende der Ventilbüchse, so lassen die Oeffnungen o,3
o1 den Dampf durch die
Canäle a, a1 nach den entgegengesetzten Enden der Cylinder
strömen, wodurch die Bewegung der Maschine umgekehrt wird. Diese
Expansionsvorrichtung gewährt außer den mit Bezug auf die vorhergehende Anordnung
bereits beschriebenen Vortheilen, noch den besonderen Vortheil, daß der Fläche des
gewöhnlichen Ventils v stets eine feste Fläche f, worauf es sich bewegt, dargeboten wird. Die Fig. 35 im
Seitenaufrisse dargestellte Maschine ist mit solchen Ventilen versehen.
Die Figuren 33
und 34
stellen einen expandirbaren Schieber oder Leitblock (guide-block) im Längen- und Querdurchschnitte dar. p ist die auf gewöhnliche Weise an den Block b befestigte Kolbenstange; i
der Bolzen, an den die Verbindungsstange befestigt ist. An dem Block b befinden sich zwei Rinnen zur Aufnahme der Keile w, w. Die äußeren Flächen
der Keile schließen sich an die Platten s, s, die zu dem Ende mit ähnlichen Rinnen, wie der Block b, versehen sind. Diese Rinnen erhalten die Keile in
ihrer geeigneten Lage. An jedem Ende der Platten befinden sich Hervorragungen g, die an den Block b
passen, um das Abgleiten der Platten s, s von den Keilen zu verhüten, c ist eine an den Block b befestigte Schraube
mit Muttern n, n, um den
Keilen erforderlichen Falles eine Bewegung zu ertheilen und sie in ihrer richtigen
Lage zu erhalten. Wenn man nun den Keilen in der Richtung des Blocks eine Bewegung
ertheilt, so dehnen sich die Platten verhältnißmäßig aus, so daß sie den Raum
zwischen den Leitstangen f, f bei erfolgender Abnützung der Platten ausfüllen. Der Vortheil dieses
ausdehnbaren Blockes besteht darin, daß die Leitstangen, wenn sie einmal in
richtiger Lage befestigt sind, in dieser Lage verharren können, wenn auch die
Platten s, s sich abnützen,
und daß diese allein nach erfolgter Abnützung ersetzt werden müssen, und nicht der
ganze Leitblock, wie dieses gewöhnlich der Fall ist.
Fig. 35 stellt
eine verbesserte Construction der Locomotive in der Seitenansicht dar. f ist der Feuerkasten; b der
Dampfkessel; s die Rauchkammer; c sind die zwischen den Rädern w, w1 außen liegenden Dampfcylinder. Die Cylinder
liegen schief und setzen durch Vermittlung des gewöhnlichen Kolbens, der
Kolbenstange p und der Lenkstange r das Rad w und die Treibachse s in Rotation; letztere ist auf die aus Fig. 24 ersichtliche
Weise durch die Dampfkammer und den Feuerkasten geführt. Der Kurbelzapfen o, an den die Lenkstange befestigt ist, nimmt auch die
Kuppelstange y auf, und setzt somit durch die Kurbel t die Welle n in Rotation.
Von der Kurbel t aus wird durch Vermittlung der Stange
m das Rad w4 und folglich auch die Achse d in Rotation gesetzt; letztere Achse tritt durch die
Rauchkammer s. Die Achse n
geht über den Dampfkessel hinweg und ist mit beiden Maschinen verbunden; sie enthält
die excentrischen Scheiben zur Bewegung der Schieberventile.
Der letzte Theil meiner Erfindung betrifft die Anwendung einer Signalpfeife, welche
dadurch in Thätigkeit gesetzt wird, daß man durch sie Luft in einen luftleeren
Recipient strömen läßt. Dieser Recipient kann durch eine mit einer Achse oder einem
Rade in Verbindung stehende Pumpe luftleer gemacht werden.
Tafeln