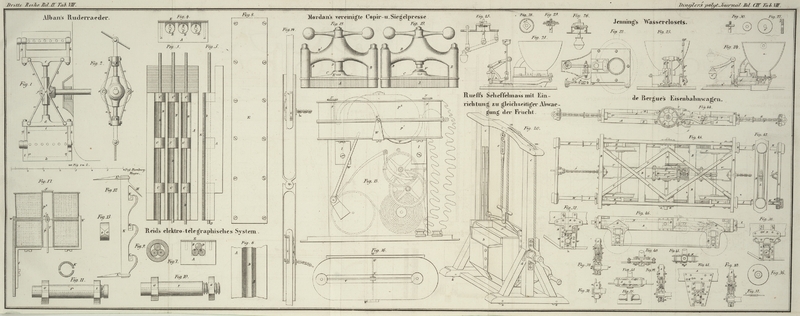| Titel: | Verbesserungen an Wasserclosets, worauf sich Josiah George Jennings zu London am 3. Juni 1847 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 109, Jahrgang 1848, Nr. LXXIV., S. 426 |
| Download: | XML |
LXXIV.
Verbesserungen an Wasserclosets, worauf sich
Josiah George Jennings
zu London am 3. Juni 1847 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, April 1848,
S. 247.
Mit Abbildungen auf Tab.
VIII.
Jennings' Verbesserungen an Wasserclosets.
Fig. 21 stellt
das Bassin und den Apparat eines mit meinen Verbesserungen ausgestatteten
Wasserclosets in der Seitenansicht,
Fig. 22 im
Grundrisse,
Fig. 23 in der
hinteren Ansicht und
Fig. 24 im
Durchschnitte dar.
In allen diesen Figuren dienen gleiche Buchstaben zur Bezeichnung gleicher Theile.
a ist das Bassin; b das
Ventil, dessen eigenthümliche Einrichtung und Wirksamkeit den ersten Theil meiner
Verbesserungen bildet. An den unteren Theil des Ventils b ist die Platte c festgeschraubt. d ist eine andere Platte, welche mit Hülfe von vier
Gelenken e, e mit der Platte
c verbunden, und an die Stange f befestigt ist, die durch eine Stopfbüchse tritt. g ist die Handhabe, durch die das Ventil b bewegt wird. Diese Handhabe ist mit dem um h1 drehbaren
Winkelhebel h verbunden. Der Zapfen h1 befindet sich an
dem Arm h2, dessen
Achse in geeigneten Lagern sich dreht; der Hebel h ist
bei h3 an den Hebel
h4 befestigt. An
der Achse des Arms h2
ist der an seinem Ende gabelförmige Arm h5 befestigt; dieser ist mit einem Bolzen versehen,
der durch die geschlitzte Säule h6, woran die Ventilstange befestigt ist, geht. Das
Aufziehen der Handhabe veranlaßt die Stange h6 sich herauszubewegen und das Ventil mit zu
ziehen, wobei sie durch die festen Führungen h7 geleitet wird. Das Gewicht h8 hat den Zweck, die
Theile wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückzubringen.
Wenn das Ventil b in Wirksamkeit gesetzt wird, so bewegt
es sich zuerst eine kurze Strecke abwärts und tritt dann rasch zurück. i ist eine Röhre, welche in die kleine Cisterne i1 tritt und in das
daselbst befindliche Wasser taucht. Wenn die Cisterne überfließt, so läuft das
Wasser durch die Oeffnung i2, durch welche eine Bürste i3 geht, an der das Ventil b bei seiner rückgängigen Bewegung vorüberstreift und somit gereinigt
wird.
Fig. 25 stellt
ein Ventil, welches das Wassercloset mit Wasser versieht und Fig. 26 ein anderes
Ventil im Durchschnitte dar. Das erstere wird mittelst eines Hebels und einer
Zugstange, das andere am Kopf der Spindel selbst gehoben. Das Ventil besteht aus der
mit Leder eingefaßten Platte x; die obere Kante des
Cylinders y bildet den Ventilsitz. x1 ist die
Ventilstange, auf deren Hals x2 die Lederscheibe x3 mittelst einer Scheibe und
Schraubenmutter x4
befestigt wird, so daß sie wenn es nöthig ist, leicht durch eine neue ersetzt werden
kann.
Fig. 27 zeigt
die Lederscheibe im Grundriß und in der Randansicht; dieselbe kann auch aus
Gutta-percha oder vulkanisirtem Kautschuk angefertigt werden.
Fig. 28 ist
ein Grundriß der Schraubenmutter und Platte x4;
Fig. 29 stellt
das Ventil im Durchschnitt und
Fig. 30 den
oberen Theil der Ventilspindel in der Seitenansicht dar.
Tafeln